Excerpt
Inhalt
Vorwort
Teil 1: Kant
eklatant, Herr Kant!
1 Allgemeine Einleitung
2 Vorbereitung zum Hauptteil
(erkenntnistheoretischer) Hauptteil
3 Bedingungen allgemein
4 Verschiedene Arten von Bedingungen
5 Rahmenbedingungen
6 Kernbedingungen
7 Wechselwirkungen, Gesetze, Ding an sich
8 “weil ohne ...“, – Sinnlose Bedingungen
9 Grundsätzliche Definitionen (Bedingungen, Kausalität, Ursache, Wirkung)
10 Resümee des Hauptteils
11 Psychologische Wirkung in sich geschlossener bzw fixer Aspekt (Fernsehen, Farben, Bilder usw.)
12 Kompatibilität: Grenzen des “technisch“ bedingten Einflusses auf “geistige“ Informationsinhalte
13 Funktion der “Welt der Erscheinungen“ und der “Welt der Dinge an sich“
14 Ist die “Welt der Dinge an sich“ geordnet?
15 Farben, die Zeit, Maße
16 Träume (1)
17 “Stetige“ Lügen sind letztlich Wahrheiten
18 Träume (2)
19 Idealismus
20 Erfahrung ist grundsätzlich unabhängig von derr Struktur eines Subjekts
Beilage 1 [Auszug, Original* S. 313]
Beilage 2 [= “Bemerkungen“, Original S. 330-1]
Beilage 3 [= Anhang III, Original S. 350-2]
Beilage 4 [= Original S. 446-7]
Zusammenfassung
Literatur
Internetbeiträge
Register
Dank, Impressum
*[Mit “Original“ ist das übergeordnete dreiteilige Gesamtwerk gemeint von dem hier nur der erste Teil vorliegt.]
Vorwort [speziell zu Teil 1, Kant]
Wir bringen die Ordnung selbst in die Natur – so wird behauptet.
Ist Ordnung im erkenntnistheoretischen Wesen aber ein solch freier Aspekt, dass er sich bedingungslos von einer Sache auf eine andere – von dieser Dimension zu jener übertragen lässt? Ist es prinzipiell möglich, dass wir beispielsweise den Straßenverkehr mit Vorschriften und Gesetzen der Bauordnung regeln? – wäre es möglich, die nächste Raumfahrt zum Mond mit den Wasserstandspegeln des Rheins zu berechnen? – kann es erfolgsversprechend sein, eine Wüstenexpedition nach theoretischen Vorgaben der Polarforschung auszurüsten?
Nach Kant gibt es rein äußerlich in der absoluten Realität keine Zeit, keinen Raum. Gemäß seiner Theorie steht den Sinnen lediglich roher Stoff, bzw. zufällige unbestimmte Impulse der Außenwelt zur Verfü-gung – angeblich ist alles andere im Grunde subjektives Beiwerk.
Ist es aber zulässig den Zufall in wohldefinierte logische Formen zu kleiden? – ist es zulässig raum- und zeitlose Aspekte in Koordinaten der Zeit und des Raumes zu pressen – exakt in Koordinaten die jene Aspekte definitiv nicht haben? Ist es zulässig, völlig unkoordinierte äußere zufällige Impulse innerlich als intelligente Befehle aufzufassen?
Ordnung bedingt Sachdienlichkeit. Wenn wir, nach Kant, der objek-tiven Natur unsere subjektiven Gesetze aufzwingen, so kann dies kaum der natürlichen Sache dienen – so verhalten wir uns, objektiv gesehen, also zwangsläufig falsch. Und doch empfinden wir dabei als hätten wir richtig gehandelt – wie um alles in der Welt sollte das möglich sein?
Die Erfahrung lehrt, dass sich Subjekte nach äußeren Objekten ausrichten müssen. U. a. um skeptischen Argumenten der Täuschung auszuweichen, koordiniert Kant hingegen das Objekt gemäß dem Subjekt. Damit nimmt er dem Subjekt jedoch den eigentlichen Reiz sich überhaupt nach Äußerlichkeiten zu richten:
Wenn uns die äußere Welt tatsächlich nichts als rohen Stoff eines unbestimmten völlig unbekannten “etwas“ liefert, so macht es keinen Sinn z. B. die Augen nach links oder rechts zu bewegen, wenn links wie rechts uns gleichermaßen nichts als unbestimmtes “etwas“ reizt.
Wer die Welt diktiert, benutzt sie ultimativ quasi als eine Art Treibstoff – dann aber würde der Realität bloße Energie zur Erfahrung abverlangt und keine objektive äußere Welt. – Damit hätten wir ganz grob bereits einen Eindruck von dem was uns hier erwartet.
Den Ausgangspunkt zu dieser nicht sehr Kant-freundlichen Kritik bildet aber eine spezielle Betrachtung des Begriffs der Bedingung. Kant pauschalisiert entsprechend willkürlich – unmittelbare Folge: eklatante Widersprüche, einige haben wir soeben angedeutet.
Vorwort [zum Werk insgesamt]
Unsere gegenwärtige Welt ist voller Probleme. Horrende Staats-verschuldung, Banken-Krise, Klimaschutz, Terrorismus, Kernkraft, Multikulti, Ozonloch, Arbeitslosigkeit, ... und dazu eine auf pures Vergnügen getrimmte Spaßgesellschaft, die scheinbar alles umso lockerer sieht, je ernster die Lage wird und das drohende Ende eher zur Super-Show genüsslich vermarktet und konsumiert als sich dadurch warnen zu lassen.
Man könnte entsprechend sehr viel verbessern – die Frage ist jedoch, ob wir das wirklich wollen? Die kurzsichtige Flickschusterei mit der gegenwärtig überall in der Westlichen Welt hantiert wird, lässt vermuten, dass wir aus falscher Liebe überaus treu zu Systemen stehen, die häufig menschlichen Schwächen – ja Laster – hervorragende Bedingungen bieten.
Diese Systeme versprechen einerseits direkte Sicherheit, Solidarität, Freiheit, ... zwingen andererseits aber Abhängigkeit, Bevormundung, Wachstumswahn, Konsumzwang und allerlei trügerische Ideale auf – treiben zudem Selbstgefälligkeit, Prestigesucht und Egoismus erst recht vorwärts – und züchten damit indirekt Pulverfässer der verschiedensten Art heran, die langfristig das Maß unmittelbarer Gefahren übersteigen.
Wir werden also die Zweckmäßigkeit des einen oder anderen gesellschaftlichen Systems (Krankenkassen, Pflegekassen, Beamten-tum, freie Marktwirtschaft, Demokratie, ...) gegebenenfalls in Frage stellen und untersuchen, inwiefern allgemeines Fehlverhalten durch jene Systeme schleichend begünstigt wird.
Bis zu den Krankenkassen, darüber hinaus, bis zur großen Politik, zu Ethik und Religion liegt noch ein recht weiter Weg vor uns und der verläuft zunächst über eine sehr persönlich geführte Kritik zur Erkenntnistheorie Kants – wieso? Nun, um das – vor allem aber um unsere groteske, nicht gerade privilegierte Ausgangssituation einigerma-ßen zu erklären – müssen wir schon noch etwas weiter ausholen.
Das “Ich“ ist kaum eine absolute Größe, es schwankt ständig zwischen dem wie man sich selbst sieht, wie man die anderen wahrnimmt und wie man sich selbst durch die anderen erkennt. Das Ich ist eine vage Relation des Äußeren zum Inneren und lässt sich weder rein subjektiv noch objektiv eindeutig erfassen.
Zudem entziehen sich Kriterien der Motivation jeder exakten Definition. Was uns heute sehr interessiert, kann uns morgen bereits langweilig vorkommen, ohne dass jener Motivationsverfall irgendwel-chen klar erkennbaren Grund aufweisen müsste.
Wissen ist bei weitem nicht ausschließlich positiv. Denn es bindet unwillkürlich an das was man weiß. Verhältnismäßig umfangreiche, vollständige Fakten können die Phantasie regelrecht blockieren. Die besten Möglichkeiten liegen zudem nicht unbedingt im Bereich der bereits erschlossenen Erkenntnis. Was können wir überhaupt wissen in absoluter Sicht? Haben einzelne Kriterien der Erfahrung – Ideale, Universalien – absoluten Charakter oder sind sie etwa alle relativ – relativ vor allem unter dem Aspekt Kontrast ? Ist Glück nicht gewissermaßen von Unglück abhängig und umgekehrt?
Sprache und Wissen beziehen sich generell auf das Allgemeine. Dieser vermeintlich simple Fakt beinhaltet jedoch bereits ein erhebli-ches philosophisches Problem. Denn die Situation jedes Einzelnen ist individuell, und demzufolge nicht allgemein. Sprache kann indes nur funktionieren, wenn sie sich allgemeiner Begriffe bedient, die für jeden und nicht lediglich für ein einzelnes Individuum verständlich sind. Das führt zwangsläufig zu einem Paradox:
Je allgemeinverständlicher sich eine Sprache gestaltet, umso pau-schaler, unschärfer und willkürlicher ist sie. (Einheitliche Weltsprache, wie auch das landläufig breite Zurücktreten regionaler Mundarten, ist, so gesehen, ein bedenklicher kultureller Rückschritt!) Sprache und menschliche Erkenntnis bilden im Grunde einen mehr oder weniger willkürlichen Kompromiss ohne Anspruch auf absolute Objektivität.
Das wird nun keineswegs besser, wenn wir zudem noch rein gefühlsbedingte Aspekte – Motivation – in die Waagschale legen.
Und doch gibt es die Wissenschaft, die scheinbar alles kann, alles weiß, oder zumindest sich gerne den Anflug absoluten Wissens gibt. Wissenschaftliche Unfehlbarkeit, falls sie nicht ohnehin bereits besteht, ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Der vollends durchgenormte, standardisierte Mensch, das völlig kontrollierte Leben – patente Aussichten für Politik und für die zunehmend, quasi als Ersatzreligion hochgepuschte Wissenschaft.
Die Wissenschaft befreit uns von manchen Geißeln der Natur, leider ist sie dabei sich in mehrfacher Hinsicht allmählich selbst zur ultimativen Geißel zu entwickeln – zum quälenden Monster, das ganze Generationen von Menschen in eine gnadenlose Abhängigkeit drückt und sich beispielsweise dem verhältnismäßig humanen natürlichen Tod eines alten, des Lebens gesättigten Bürgers grundsätzlich und vehement in den Weg stellt, als ginge es um Millionen Menschen (es geht ganz sicher um gewisse Millionen oder gar Milliarden!) andererseits jedoch bezüglich werdenden Lebens willkürlich mit einer unverkennbaren Lässigkeit zwischen Leben und nicht lebenswertem Leben differenziert.
Dabei hat die Natur generell, und die menschliche Gesellschaft im Besonderen, Bedarf gerade nach relativ unvollkommenen Subjekten. Denn Perfektion bedeutet ultimativ Stillstand und Sättigung und ist vom natürlichen und menschlichen Standpunkt letztlich also uninteressant.
Leben ist an und für sich wohl ein Kompromiss zwischen Ideal und Chaos. Die Wissenschaft zielt indes gnadenlos aufs Ideal und auf Erfolg und zielt damit über das eigentliche Leben bei weitem hinaus. Denn motivierend ist keinesfalls immer das Erreichen bzw. die Realisation von Zielen, sondern oftmals eher ein Scheitern bzw. ein grundsätzlicher Mangel. Hunger, der sich beispielsweise eindeutig auf einen Mangel bezieht, ist bezüglich des Essens, wesentlich moti-vierender als die Realisation der Zielvorgabe: ein voller Magen. Man könnte glatt behaupten: Mangel motiviert – Erfolg ernüchtert!
Eindeutige Werte, Ideale, Normen usw. sind in unserer technischen relativ fortschrittlichen Welt unentbehrlich. Emotional bedeutend sind jedoch grundsätzlich eher sich bewegende und verändernde, als irgend-welche fixe, eindeutige Aspekte. Damit klafft unsere Gesellschaft zwischen künstlichen Angeboten der verschiedensten Art einerseits und tatsächlichem Bedarf andererseits mehr und mehr auseinander.
Um dennoch Machbares an den Mann zu bringen wird bewusst, vorrangig im medizinischen Bereich, willkürlich um Bedarf gerungen, bzw. wird durch überzogene Idealisierung in mehr oder weniger allen Lebensbereichen künstlich Bedarf geweckt, der nicht in jeder Bezie-hung nützlich ist. Einem gelifteten, durch Medikamente, Operation oder irgendwie durch medizinisch-technische Hilfen äußerlich vervollkommnenden Menschen mag der eine oder andere Makel abhanden gekommen sein, gleichzeitig vielleicht jedoch auch ein nicht unbedingt unbedeutender Lebensanreiz.
Denn der eigentliche Lebensanreiz besteht, der allgemeinen Mei-nung zum Trotz, nicht in unmittelbarer Nähe bestimmter Idealzustände, als vielmehr aus relativer Ferne zu solchen lockenden, letztlich jedoch enttäuschenden Irrlichtern. Mangel, Leid, ungünstige Umstände, schwierige Situationen, Aggression, Stress und ganz besonders unver-zügliche Lebensgefahr können enorm motivieren und die Psyche stabi-lisieren – der steigende Trend zu gefährlichen Extremsportarten deutet bereits darauf hin. Die leistungsfähigsten und erfolgreichsten Men-schen sind durchweg keineswegs Idealtypen – ganz im Gegenteil: sie haben in der Regel mindestens ein belastendes persönliches Malheur, irgendeinen gravierenden Tick, oder stehen relativ permanent unter starkem Stress.
Die physisch wie psychisch kräftigsten Geschöpfe der Natur finden sich eher im rauen Norden als im milden Süden – die Starken sind durchweg die Gestressten, nicht die Verhätschelten – deuten diese Argumente nicht bereits systematische Zusammenhänge an?
Es besteht jedenfalls ein prinzipieller Widerspruch zwischen idealen Umständen und deren effektivem Nutzen, den die Wissenschaft und in erster Linie der gesundheitliche Bereich der Medizin generell schlicht zu unterschlagen scheint. Das wird am Thema des Rauchens sehr deutlich:
Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Rauchen heutzutage als unein-geschränkt schädlich zu betrachten, und von allen Seiten wird fanatisch gebetsmühlenhaft gegen jenen Genuss propagiert. Wie fast immer, wenn Menschen zum Fanatismus getrieben werden, werden sachliche Argumente mit Füßen getreten, dementsprechend zwängen sich subjektive Gefühlsregungen, und damit nicht selten Heuchelei und Realitätsverzerrung, unwillkürlich in die jeweilige Diskussion hinein.
So wird beispielsweise oft unterschlagen, dass alles was Spaß macht und was gut schmeckt in der Regel auch gesund ist, zudem, dass wir normalerweise gegen alles, das uns offensichtlich nicht bekommt eine instinktive Abneigung oder gar Ekel entwickeln und dass der Begriff Gift ohnehin nicht absolut, sondern sehr relativ, sehr individuell ist.
Ganz besonders aber wird in der Raucherdiskussion gerne vergessen, dass wir grundsätzlich Stress brauchen – relativ maßvoller Stress, in welcher Form auch immer, ist gesund! Rauchen bedeutet vieles, vor allem aber Stress – das ist prinzipiell bei einer Kneippkur, bei Reizklima oder beim Sport nicht anders. Das eigentlich Gesunde am Sport, an einer Kneippkur ... ist Stress! Wenn Stress durch Kneippkur, durch Reizklima und Sport gesundheitlich positiv bewertet wird, der Stress durch Rauchen hingegen negativ, so ist dies nicht unbedingt zwingend logisch, ganz gleich was übliche Statistiken dazu melden!
Denn statistisch, somit empirisch (wissenschaftlich) induktiv, lässt sich im philosophisch strengen Sinne absolut nichts beweisen. Dabei wäre es eventuell wesentlich leichter, zu beweisen, dass Rauchen nicht generell schädlich sein kann als umgekehrt, zumindest dann, wenn Rauchen letztlich tatsächlich nicht (pauschal) schädlich ist.
Nicht dass ich hiermit eine Lanze für das Rauchen brechen möchten (ich bin Nichtraucher) oder jenes Thema überhaupt von großer Bedeu-tung für uns wäre, so könnte man dennoch fragen, was es zu bedeuten hätte, wenn Rauchen den allgemeinen Erwartungen zuwider letztlich nicht grundsätzlich schädlich wäre. In diesem Falle würde ein korrekter Beweis der Schädlichkeit des Rauchens logischerweise schlicht und einfach unmöglich sein! – und alle Versuche das Rauchen dennoch pauschal als ungesund zu entlarven wären vergebens.
Der Verbissenheit, mit der Antiraucheradvokaten durchweg argu-mentieren, ist indes zu entnehmen, dass für sie eine solche Möglichkeit nicht existiert – nicht existieren kann – womöglich, weil sie aus persönlichen Beweggründen den betreffenden Fall für sich längst ent-schieden haben und lediglich der Form halber eines Beweises bedür-fen. Die Tatsache, dass der entsprechende Beweis (als Philosophen erkennen wir, wie gesagt, statistisch erbrachte Beweise nicht an) nach wie vor aussteht, lässt jedoch die angedeutete Möglichkeit offen – ja deutet glattweg darauf hin, dass Rauchen den allgemeinen Erwar-tungen zum Trotz nicht generell schädlich ist. Also wäre es gegebe-nenfalls wesentlich einfacher zu beweisen, dass Rauchen nicht generell schädlich ist, als umgekehrt gesichert darzulegen, dass jener Genuss der Gesundheit uneingeschränkt in jedem Falle schadet.
Davon abgesehen hängen die Mittel und Wege für die Erhebung einer Statistik, oder für die Inszenierung wissenschaftlicher Forschung, ganz wesentlich von den subjektiven Erwartungen und Wünschen der Forscher, von der öffentlichen Meinung, von Sponsoren, vom Stand der Wissenschaft usw. ab, was insgesamt, auf die eine oder andere Art und Weise in die jeweiligen Ergebnisse einfließt, womit letztlich der Willkür kaum zu begrenzende Möglichkeiten erwachsen.
Was heute als gesund gilt, wird nicht selten morgen als schädlich erkannt – das Rauchen galt beispielsweise einst als wahrer medizini-scher Segen. Eier sind gesund sagen die einen und stützen sich dabei auf wissenschaftliche Befunde. Eier sind nicht gesund sagen hingegen andere und stützen sich dabei ebenfalls auf wissenschaftliche For-schungsergebnisse, die ihnen am besten ins Konzept passen – wem soll man da glauben?
Wissenschaftlich lässt sich offenbar fast alles beweisen, was nicht sonderlich verwunderlich sein sollte, denn die Wissenschaft gibt sich generell mit Methoden bloßer Wahrscheinlichkeitswerte, resultierend aus Beobachtung, zufrieden, die prinzipiell jederzeit umkippen können. Aufgrund mehrheitlicher Beobachtungen zu urteilen ist praktisch, ist genau genommen aber falsch, denn die Wahrheit ergibt sich nicht auto-matisch aus der Mehrheit – gegebenenfalls eher aus der Minderheit!
Zudem gilt nach heutiger allgemeiner wissenschaftlicher Überzeu-gung für “wissenschaftlich“ u. a. die Bedingung der “Falsifikation“. Das heißt, als wissenschaftlich kommen lediglich prinzipiell widerleg-bare Aspekte in Betracht. Damit gibt die Wissenschaft zu, dass es ihr vor allem ums Praktische und nicht um das absolut Wahre der Dinge geht. Wahrheit die dem Augenschein untersteht – so etwas muss irgendwann einmal buchstäblich ins Auge gehen.
Das führt im Extremfall dazu, dass sich wissenschaftlich scheinbar nicht lediglich alles beweisen, sondern zudem wieder alles gegen-beweisen lässt. Jede wissenschaftliche Aussage verbleibt also ultimativ unter einem gewissen Fragezeichen, ein absoluter Beweis wäre nicht verbesserungsfähig und damit an und für sich nicht wissenschaftlich.
Die Philosophie, abgesehen relativ wissenschaftlicher Philosophie eines Aristoteles oder des englischen Empirismuses – vom Pragmatismus der Amerikaner ganz zu schweigen – baut hingegen vorwiegend auf qualitativ höchste, deduktive Argumente, die sich nicht auf Beobachtung, sondern auf logisch unumstößliche Kriterien gründen. Es besteht in dieser Hinsicht ein kategorischer Unterschied zwischen bloßer wissenschaftlicher Wahrscheinlich-keit und philosophischer Gewissheit.
Die Wissenschaft zielt in erster Linie auf praktischen Erfolg und präzise Vorhersagen, die Philosophie hingegen eher auf absolute Wahrheit. Es ist daher völlig klar dass Erstere allgemein beliebter ist – die Wahrheit war noch nie sonderlich populär in der Geschichte, entlarvt sie doch vor allem unsere Schwäche, während die Wissenschaft wohl eher unsere Stärke repräsentiert, was wiederum zur Überheblichkeit, gegebenenfalls gar zur systematischen Lüge verleitet, da ist jene Disziplin in der Tat nicht sonderlich zimperlich. Die Wissenschaft ist sicherlich nicht gerade ein Unschuldslamm oder das gute Gewissen der Menschheit, auch wenn sie sich selbst gerne so sieht. Eine Strategie, die prinzipiell praktischen Erfolg der Wahrheit vorzieht, ist bis zu einem bestimmten Grad, besonders in materieller Hinsicht, durchaus nützlich, sie läuft jedoch früher oder später eklatanten Widersprüchen entgegen. Das zeigt sich derzeit deutlich im gesundheitlichen Bereich.
Das soll nun allerdings nicht heißen, dass es im Lager der Philosophie nichts auszumisten gäbe, ganz im Gegenteil, wie wir sehr bald am Beispiel Kants zeigen werden.
Kranksein, klimatisch-physikalische und soziale Aggression, und Leiden generell, können die körperliche und psychische Konstitution positiv beeinflussen – u. a. gewinnt der Körper dadurch in der Regel jeweilige Resistenz und erfährt zudem eine Erhöhung und Stärkung seiner selbst – vorausgesetzt eine entsprechende Heilung geht in der Hauptsache aus der körpereigenen Abwehrbereitschaft hervor – vorausgesetzt eine körpereigene Mobilmachung wird nicht etwa durch äußere künstliche pharmazeutische Produkte überflüssig gemacht.
Mit Vitaminpillen, Medikamenten, bewusster, scheinbar besonders gesundheitsorientierter Lebenshaltung, Nichtrauchen und zunehmender Optimierung und Idealisierung in mehr oder weniger allen Lebensbe-reichen wird ein relativ gesunder Körper letztlich vielleicht zu wenig gestresst – geht somit wohl eher geschwächt als gestärkt aus dem Rennen und wird zudem extrem Abhängig von all seinen künstlichen äußeren Mitteln und Mittelchen. Wir sind alle mehr oder weniger beschränkt und das hat durchaus seine guten Seiten: Mangel motiviert, während Erfolge und erreichte Ideale letztlich eher ernüchtern.
Wenn jedoch Mangel eher motiviert als relativ ideale Umstände, so heißt dies, dass unsere aktuell gnadenlos nach Idealen strebende Gesund-heitsauffassung im Prinzip nicht stimmt – nicht stimmen kann! – zudem dass weite Teile der erfolgsorientierten Wissenschaft, unsere allgemei-ne Lebensauffassung, eventuell gar alles gesellschaftliche Leben im Wesentlichen auf unglaublichen Widersprüchen beruht.
Doch dazu bräuchten wir zunächst eine solide Basis. Jene Basis, auch wenn dies ein sehr weiter Sprung sein sollte, bietet sich im Zusammenhang mit der Erkenntnistheorie Kants an, nicht zuletzt, weil wissenschaftliches Denken heutigentags an Grundzüge jener Theorie ganz wesentlich gebunden ist. (Ultimativ ist Religion unser Funda-ment, das schließt Wissenschaftlichkeit ja nicht unbedingt aus – oder?)
Gemäß Kant bringen wir mittels apriorischer, gesetzlicher, subjekti-ver Bedingungen – Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt – selbst die Ordnung in die Natur. Dabei behandelt Kant insbesondere die Kriterien Bedingung, Ordnung , Gesetze in äußerst fragwürdiger Manier. Ist es z. B. so ohneweiters möglich, dass eine völlige Unordnung geordnet wird. Zudem beschränkt Kant einerseits jene subjektiven Bedingungen und das Gesetzliche direkt auf das Allge-meine – andererseits erstreckt er exakt jene gesetzlichen Bedingungen indirekt auf das Absolute, und damit auf das Einzelne/Individuell, indem er die Natur insgesamt absolut – und damit nicht lediglich formal, äußerlich, sondern innerlich, inhaltlich in jeder Einzelheit durch die subjektiven Bedingungen abhängig macht – insgesamt eine höchst kontroverse Angelegenheit!
Zur Technik: Wir werden im Folgenden sehr gerne auf Zitate zurückgreifen, die wir unsererseits ausnahmslos in kursiv setzen. Zitate die im zitierten Original in ihrer ganzen Länge ebenfalls in kursiv stehen, werden also belassen – handelt es sich hingegen lediglich um einzelne Wörter die im Original kursiv erscheinen, so werden diese in “Normal“ versetzt um deren offenbar vom jeweiligen Autor gewünschte Betonung möglichst zu erhalten.
Mit Fachbegriffen halten wir uns zurück, zum einen um das Werk auch für Nicht-Studierende möglichst attraktiv zu halten. Zum anderen führen Fachaus-drücke gerade in der Philosophie leicht in einen sich selbst widersprechenden Schematismus, der an nichtssagende standardisierte politische Phrasen erinnert, die Kompetenz vortäuschen ohne echtes persönliches Engagement zu beinhalten.
Mit Vorliebe werden wir uns immer wieder im absoluten Bereich bewegen – Natur, Politik ... aus dem sich kaum sogleich auf den Alltag schließen lässt – da sollte man wirklich vorsichtig sein!
Mit nicht minder starker Präferenz werden wir oft – je später umso häufiger – das rein Natürliche dem Ethisch-Religiösen gegenüberstellen.
Bevor wir weitergehen sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Werk in seiner ganzen Tendenz, in allen drei Teilen: Kant (Erkenntnis-theorie, Philosophie), Karnickel (Gesundheit, Soziales), Karnonen (Politik, Religion) permanent gegen den Strom zu schwimmen scheint. Machen wir uns nichts vor: “Utopische Schwärmerei“, so würde uns die Fachwelt begrüßen, oder: “Rücksichtslos naiv!“ Diese Vermutung ist nicht ganz ohne Geschichte.
Nun, wir wollen keine falschen Hoffnungen wecken, aber doch vermitteln wovon wir überzeugt sind, ob das gut oder weniger gut klingt.
Zugegeben, es spricht zunächst eindeutig gegen uns, dass kein Verlag gefunden werden konnte, der dieses Werk (von sich aus) übernimmt. Ein bestimmtes fachliches Vorgespräch (→ Anhang III, S. 350-2 [202-4]) könnte diesen negativen Eindruck wohl kaum entlasten.
Manchmal scheinen Außenseiter allerdings einen zumindest vagen Vorteil zu haben (→ Anhang IV, S. 475), ein geschicktes Händchen oder schlicht ganz unverschämtes Glück, und/oder es sind in der Tat höhere Mächte im Spiel. Der bloße Fakt: Außenseiter kann bereits ein glücklicher Umstand sein, wenn er als positive Herausforderung angenommen wird und Phantasie und Inspiration belebt.
Das eventuelle Glück des Außenseiters ist dem Fachmann jedoch äußerst verhasst – es ist ihm ein Ärgernis – stellt es doch ein Fragezeichen hinter all seine mühselig erkämpften formalen Qualifikation, auf die er wohl nicht wenig stolz ist und mit denen er sich im Grunde uneingeschreckt im Vorteil sieht.
Der natürliche Mensch ohnehin, aber offenbar auch alle unsere öffentlichen Systeme, verlangen vor allem nach Selbstbestätigung, u. a. auch Universitäten, aller vorgeblicher Wissenschaftlichkeit zum Trotz. Haben wir mit diesem Werk erleben dürfen, dass vorwiegend, wenn nicht ausnahmslos, brave Mitläufer gefördert werden, solche, die das eigene System, die eigene Ideologie, die ei-gene Strategie, den eigenen Stolz auf die eine oder andere Weise schmeichelnd bestätigen oder zumindest dazu keine nennenswerte Gefahr darstellen?
Allerdings hat bisher kein Fachmann dieses Werk in seiner uns hiermit vorliegenden Gesamtheit [zu Kant] einsehen können und keinem Fachmann haben wir uns diesbezüglich persönlich vorgestellt. Und da diese Arbeit sich mit völlig eigensinnigen Ideen in Spiele wagt, in denen alle Rollen und Regeln im Kern längst fest vergeben sind, haben wir wohl selbst ordentlich dafür gesorgt, dass wir in keiner Richtung Fuß fassen konnten! Die Engländer haben uns seinerzeit vielleicht zu sehr verwöhnt: “You don’t talk much, which is a shame, because you have a lot to say. I expect great things from you!“ (Einer unserer Uni-Lehrer, England, öffentlich während eines Seminars.)
Notorisches Ärgernis oder nicht, Inspiration ist generell besonders launisch – widersetzt sich offenbar bewusst formaler Ordnung und Logik. Und wie zur Bestätigung wurden hier Kapitel 18 und 19 komplett nachträglich eingebaut, nachdem eigentlich schon alles fertig war. Das Buch wurde also keineswegs in einem Zug geschrieben. Ohnehin scheint die Diskussion stellenweise eher rück-wärts als vorwärts zu verlaufen – damit muss man immer rechnen. Unkonven-tioneller Inhalt verlangt wohl auch unkonventionellen Stil – für Kritiker allerdings gleich wieder ein zusätzlicher Punkt, um uns abzuweisen – letztlich vielleicht mit Recht, wer weiß? Wir lassen uns gerne eines Besseren belehren und kleben nicht absolut fest an unseren persönlichen Ideen. Oberflächlichkeit, Arroganz oder etwa Ignoranz wäre entsprechend jedoch nicht sehr überzeugend.
Teil 1: Kant
eklatant, Herr Kant!
1 Allgemeine Einleitung
Ist die Welt tatsächlich so wie wir sie empfinden oder ist sie in Wirklichkeit ganz anders? In unserem praktischen Alltag spielt eine solche Frage durchweg keine Rolle. Doch sie ist berechtigt. Denn alle unsere Empfindungen sind bedingt – sind bedingt, zum einen durch die verschiedensten subjektiven materiellen Gegebenheiten (Nervenzellen, Nervenbahnen, ganze Systeme organisierter Zellen: Gehirn, Ohren, Augen usw.) – sind zum anderen abhängig von rein theoretischen Gegebenheiten, die aller Körperlichkeit weit vorangehen und mit Raum, Zeit, Verstand, Bewusstsein... auf das eigentliche Wesen bedingter Welterkennung überhaupt zielen. (Es geht hier überwiegend um jene theoretischen Bedingungen!)
Da wir die Welt also nicht direkt erleben, sondern indirekt mittels unserer subjektiven Bedingungen, ist es naheliegend an-zunehmen, dass jene subjektiven Bedingungen unsere bewusst wahrgenommenen Empfindungen der Außenwelt in der Art beeinflussen, wie z. B. das Aufsetzen einer Brille – eine zusätzliche künstliche Bedingung somit – unseren Seheindruck in der Regel deutlich verändert. Das wiederum hätte zur Folge, dass wir die Welt grundsätzlich nicht so empfinden, wie sie an sich tatsächlich ist – womit wir im Kern bereits das eigentliche Grundproblem aller Philosophie umschrieben haben. Vor allem Kant nimmt jene Problematik sehr ernst:
Immanuel Kant (1724-1804) geht davon aus, dass unsere be-wusst wahrgenommenen Sinnesempfindungen grundsätzlich von unseren subjektiven Gegebenheiten, insbesondere von den soge-nannten Verstandeskategorien und Anschauungsformen (des Raumes und der Zeit) abhängen. Wie weit aber reicht diese grundsätzlich unterstellte Abhängigkeit? Sind Bedingungen und Abhängigkeitsverhältnisse allgemein notwendigerweise mit einer inhaltlichen Beeinflussung verbunden?
Anders formuliert, auch wenn man unterstellt, dass wir bezüg-lich unserer bewusst wahrgenommenen Sinnesempfindungen auf Kantsche Kategorien und Anschauungsformen absolut an-gewiesen sind – beinhalten diese Bedingungen notwendigerweise eine Beeinflussung aller nachfolgenden bewusst erlebten Empfindungen? Sind Bedingungen immer auch Ursachen des Bedingten? Welche Bedeutung haben Bedingungen in Relationen von Ursache und Wirkung, welche Rollen können sie übernehmen und welche können sie nicht, übernehmen und welche Konsequenzen sind damit eventuell verbunden? Ist es überhaupt möglich dem empirisch Zufälligen von subjektiver Seite – oder generell – Ordnung vorzuschreiben?
Solche Fragen werden, auch in Fachkreisen, kaum gestellt. Dass alles Bedingte durch die jeweiligen Bedingungen inhalt-lich gezwungenermaßen beeinflusst wird scheint allgemein dermaßen einleuchtend zu sein, dass selbst die an und für sich höchst kritische Disziplin der Philosophie an diesem Punkt offenbar nicht zu rütteln wagt, möglicherweise jedoch sehr zu unrecht! Denn falls es tatsächlich gelingen sollte (wir werden uns bemühen) nachzuweisen, dass Kants Kategorien und For-men der Anschauung letztlich weder praktisch noch theoretisch Einfluss auf die jeweiligen bewusst wahrgenommenen Sinnes-empfindugen haben können, so fällt sein ganzer Transzenden-taler Idealismus schlagartig wie ein Kartenhaus in sich zusam-men, was sodann einen Domino Effekt in der Philosophie zur Folge haben könnte, denn die angesprochene Problematik ist keineswegs rein Kantscher Natur, sondern geht auf eine über Jahrtausende geführte Tradition zurück und betrifft den eisernen Kern der Philosophie in seinem tiefsten Wesen.
Wir konzentrieren uns indes voll auf Kant, da er seine Philosophie – teils mit äußerst penibler Gründlichkeit und deutlichem Hang zur Weitschweifigkeit, teils mit sträflicher Nachlässigkeit zu entscheidenden Details – insgesamt bewusst exakt auf die hier soweit vorgestellte Problematik gründet.
“Der Kern der Kritik wiederum, die transzendentale Differenz von Erscheinung und Ding an sich, wird allenfalls von einem naiven Realismus bezweifelt.“ (Otfried Höffe, 2004, Seite 70)
Das sieht man im englischen Sprachraum doch ganz ähnlich:
“Most of the central problems in philosophy remain to this day those towards which Kant pointed us. Above all, Kant was the great discoverer of the true nature of the problem of experience. His formulation of that problem appears inescapable, [warten wir’s ab] but neither he nor anyone else has yet succeeded in providing a satisfactory solution to it [das könnte sich jedoch irgendwann einmal ändern] . Consequently, one thing which nearly all major figures in contemporary philosophy have in common – though they may be as far apart in other respects as Wittgenstein and Heidegger – is that either the problems they confront or the methods they use in confronting them are in some recognizable sense Kantian.”
(Brian Magee, The Philosophy of Schopenhauer, 1983, Seite 234-5)
Mit “inescapable problem of experience” meint Mr. Magee sicherlich den scheinbar unvermeidlichen subjektiven Einfluss auf Erfahrungsinhalte.
“Es besteht kein Zweifel, daß die Philosophie Kants die selbstverständliche, bewußte, öfter noch unbewußte Grundlage des heutigen wissenschaftlichen Denkens und nicht nur dieses ist. Man versucht zwar, ihn in Einzelheiten zu verbessern oder weiterzuführen; aber wer nicht Kantianer ist, der gilt überhaupt nicht als ernstzunehmender Philosoph, und nur voller Mitleid und Verachtung blickt man von der Kantianischen Höhe der Er-kenntnis auf ihn herab. [Das können wir mit einem persönlichen Beispiel nur bestätigen! → S. 202-3.] [...] Dazu kommt, daß Kant sein System, das auf der Grundlage der Naturwissenschaft beruht, mit so genialer Einsicht und scharfsinniger Folgerichtigkeit durchge-führt hat, daß man, sobald man auf seine Voraussetzung ein-geht, seinen Folgerungen nur durch Trugschlüsse oder Über-schreitungen des Systems zu entgehen vermag.“
(August Brunner, Kant und die Wirklichkeit des Geistes , 1978, Seite 9)
Demnach hat Kant offenbar das eigentliche Erkenntnisproblem radikal gelöst – das aber hat er gerade eben nicht! → u. a. S. 97-0.
Dennoch, wer sich in dieser Hinsicht frontal und unverblümt gegen Kant gibt (so wie wir) gibt sich mehr oder weniger ge-gen die gesamte philosophische Elite unserer Zeit – unsererseits also eher ein dreistes als bescheidenes Unterfangen, zugegeben!
Das heißt allerdings nicht, dass es zu Kant grundsätzlich an Kritik mangelt, im Gegenteil. Bereits zu Kants Zeiten wurden bald Namen wie Jacobi, Schulze, Trendelenburg, Eberhard, Garve, Feder, Maimon (und viele andere) bekannt, mit denen sich zu Kant relativ unverblümte Kritik verbindet. Selbst Einstein, der allgemein eher als Physiker, denn als Philosoph in Erscheinung trat, war z. B. mit dem von Kant propagierten subjektiv-absoluten Charakter des Raumes und der Zeit nicht einverstanden.
Gemäß Kant können wir niemals wissen wie die materielle Welt “außerhalb“ (in absoluter Sicht) tatsächlich beschaffen ist.
“Da nun die Sinne nach dem jetzt Erwiesenen uns niemals und in keinem einzigen Stück die Dinge an sich selbst, sondern nur ihre Erscheinungen zu erkennen geben, diese aber bloße Vorstellungen der Sinnlichkeit sind, >> so müssen auch alle Körper mitsamt dem Raume, darin sie sich befinden, vor nichts als bloße Vorstellung in uns gehalten werden, und existieren nirgend anders, als bloß in unseren Gedanken <<. Ist dieses nun nicht der offenbare Idealismus?“
(Kant, Prolegomena § 13, Anmerkung II, siehe auch: KrV B146-B168, B294-315, zur Kürzelbezeichnung “KrV“→ S. 26.)
Kant hatte indes nicht tatsächlich die Absicht für den Idealismus, etwa eines Berkeleys, eine Lanze zu brechen – keineswegs (siehe z. B: KrV B274-279)!
Kant behauptet somit nicht lediglich, dass unsere subjektive Beschaf-fenheit unsere Erfahrung beeinflusst – das hätte er wohl in wenigen Sätzen abgehakt. Er behauptet vielmehr, dass alle unsere Vorstellungen etwa vom Raum oder von der Zeit, von Größe, Form, Kausalität usw. quasi subjektive Erfindungen sind – dass folglich der Raum und die Zeit in der absoluten Realität nicht existieren. Auch das hätte er mit relativ geringem Aufwand erledigen können (etwa im Stil eines Berkeley) würde er nicht gleichzeitig an der absoluten Realität festhalten. D. h. Kant ist überzeugt, dass alle Dinge die wir sehen, hören fühlen ... in der absoluten Realität tatsächlich existieren – er ist allerdings ebenso überzeugt, dass die Dinge in der absoluten Wirklichkeit keineswegs zu vergleichen sind mit den Produkten unserer Sinnesempfindungen, Letzteres begründet durch die subjektiv bedingte Form aller menschli-cher Erfahrung – durch den generell unterstellten Einfluss unserer individuellen Konstitution also (einschränkend: → S. 186-8).
Und diesen Spagat zwischen Realismus (andere würden sagen: Materia-lismus, → S. 98) und Idealismus (bzw. zwischen Rationalismus und Empi-rismus) kann offenbar auch ein Genie nicht in wenigen Worten erledigen.
Kant versuchte bewusst die zu seiner Zeit vorherrschenden philosophischen Richtungen a) den Rationalismus (Descartes, Spinoza, Leibniz, ...) und b) den Empirismus (Locke, Berkeley, Hume ...) weitestgehend zu verschmelzen und war zudem sehr darauf bedacht, den Skeptikern möglichst jeglichen Boden zu entziehen: Die Welt spielt sich nicht nur in unseren Köpfen ab, wie der klassische Idealismus (zu dem relativ viele Vertreter des Englischen Empirismus gehören) im Wesentlichen behauptet, sondern die Welt existiert tatsächlich – äußerlich wie innerlich, subjektiv wie objektiv – und ist grundsätzlich unabhängig, z. B. unabhängig von Individuen die eine solche Welt auf die eine oder andere Art empfinden mögen. (Dieser Ausgangslage sollten wir uns bewusst bleiben – leider wird sie selbst von Experten speziell hinsichtlich des Begriffs: Ding an sich selbst völlig ignoriert.)
Doch der Haken an der Sache ist, so Kant, womit er die Grenze zum Realismus generell (und zu den oben erwähnten Rationalisten im Besonderen) zieht, dass wir prinzipiell, also auch im Idealfall, die Dinge nie und nimmer erfassen können so wie sie tatsächlich sind, denn auch im Idealfall müssen die Sinneseindrücke gewisse subjektive, apriorische, d. h. erfahrungsunabhängige Informati-onsverarbeitungs-Programme durchlaufen um überhaupt bewusst empfunden werden zu können (vergleiche zu S. 98, oben).
Diese subjektiven apriorischen IV-Programme, Kant nennt sie (Verstandes-)Kategorien (12, – die Kausalität als wichtigste Kategorie) und “reinen“ Formen der (sinnlichen) Anschauung (Raum und Zeit), sind es im Grunde, die zwangsweise, so Kant, alle Information bestimmen, mitbestimmen oder beeinflussen.
Denn alle sensuelle Eindrücke müssen jene Programme not-wendigerweise durchlaufen, wobei jenen ursprünglichen Ein-drücken subjektive grundlegende Erfahrungsinhalte, z. B. eine bestimmte räumlich-zeitliche Zuordnung, angeblich seitens der Anschauungsformen aufgeprägt werden.
Kant unterscheidet zwischen apriorischen reinen Anschau-ungsformen (Raum u. Zeit) und aposteriorischen bzw. empiri-schen, somit nicht reinen Formen – nicht rein von empirischen Erfahrungsinhalten. Letztere könnte man als vorwiegend durch äußere Umstände gegebene Sinnesinformation, als sense data, bezeichnen (speziell zu Anschauungen → S. 54, 56-7, 100).
(Es gibt freilich auch innere sense data, das heißt rückbezüg-lich auf den eigenen Körper. “Innere“ und “rückbezüglich“ sind in diesem Zusammenhang jedoch beide keine sehr glücklich gewählten Formulierungen, denn aus Sicht der jeweiligen Sinnesorgane ist jede sensuelle Empfindung nach außen gerichtet – der eigene Körper ist beispielsweise für die Augen ebenso äußerlich wie der Bildschirm meines Notebooks dem ich gerade diese Gedanken aufzwinge – wie der Mond – wie die Sterne – wie die Empfindung der Welt insgesamt.)
Alle Informationen über die Dinge dieser Welt müssen einer Seele zunächst mit Hilfe der erwähnten Programme in der Weise angepasst werden, sodass eine Empfindung, betreffend dieser Information, überhaupt erst möglich wird, was Kant zufolge prinzipiell Einflussnahme beinhaltet, die dementspre-chend jeglichen Zugang zu absoluter Objektivität und zu absoluter Realität grundsätzlich auszuschließen scheint.
Denn, vergleichbar z. B. mit einem Lichtbündel, das beim Durchlaufen einer gefärbten Linse von jener Linse offensicht-lich (später wird das allerdings weniger ersichtlich) beeinflusst wird, werden alle Sinneseindrücke die unsere IV-Programme durch-laufen, ebenfalls unweigerlich beeinflusst bzw. (mit-)bestimmt.
Wolfgang Röd drückt diesen, in unserer sich anschließenden Diskussion extrem wichtigen Umstand, so aus:
“Wenn etwas nur dadurch zum Gegenstand der Erfahrung wird, daß es mit Hilfe der Anschauungsformen und der Kategorien bzw. im Rahmen der Grundsätze des reinen Verstandes gedeutet wird, dann heißt das, daß die Wirklichkeit, wie sie unabhängig von Deutungen sein mag, prinzipiell nicht erfahren oder erkannt werden kann.“ (W. Röd, Der Weg der
Philosophie, Band II, Verlag C.H. Beck, 2000, Seite 156)
Hans Joachim Störig sagt dazu: “Der Sinnesapparat des Menschen ist so organisiert, daß alles, was wir überhaupt wahrnehmen, uns in der Form des Nebeneinander im Raum erscheinen muß. Erscheinen! Wenn die Sinne Empfindungen liefern, so muß allerdings wohl etwas vorhanden sein, das von außen auf sie einwirkt. Mehr läßt sich aber über dieses äußere Etwas gar nicht sagen. Die Schranke, die mir dadurch gezogen ist, daß dieses Äußere mir immer nur in der Form >>erscheint<<, wie sie mir meine Sinne zuleiten, kann ich niemals überspringen. Von dem was hinter der Erscheinung steht, vom Ding an sich (Noumenon nennt es Kant auch) kann ich nichts wissen .“ (H. J. Srörig, Kleine Weltge schichte der Philosophie, 4. Auflage, 2003, Seite 453)
Otfried Höffe bemerkt zu diesem in der Philosophie offenbar allgemein akzeptierten, ja scheinbar absolut unwiderlegbaren Tatbestand ganz ähnlich:
“Weil die Erfahrung auf vorempirische Begriffe, die Katego-rien, angewiesen ist, macht nicht die Erfahrung diese Begriffe, sondern machen diese Begriffe die Erfahrung möglich, so daß >>die Kategorien von Seiten des Verstandes die Gründe der Möglichkeit aller Erfahrung enthalten<< (B 165ff.).“ (O. Höffe,
Kants Kritik der reinen Vernunft, 4. Auflage 2004, Seite 149)
(Eine ausführlichere Stellungnahme zu diesem entscheidenden Punkt zitieren wir gesondert, → Seite 330-1 [Original, hier aber S. 200-1].)
“Also ist es nur die Form der sinnlichen Anschauung dadurch wir a priori Dinge anschauen können, wodurch wir aber auch die Objekte nur erkennen, wie sie uns (unsern Sinnen) erschei-nen können, nicht wie sie an sich sein mögen [...]“ (Prol. §10)
Gemäß Kant würden wir folglich die Welt ganz anders empfinden, wären wir nicht auf die uns eigene diesbezügliche Hardware angewiesen – könnten wir die Welt ohne jedes Hilfsmittel direkt erleben.
Der reine Fakt, dass wir auf subjektive Hilfen bezüglich der Realitätsempfindung überhaupt angewiesen sind beinhaltet nach Kant bereits eine nicht zu umgehende subjektive Einfluss-nahme. Jene subjektive Hilfen sind in erkenntnistheoretischer Relation ein notwendiges Übel – unerbittlicher Preis dafür (aus der Sicht Kants): Die Sinnesinterpretation wird von jenen subjektiven Hilfen abhängig und somit inhaltlich beeinflusst.
Damit ist eine Sinnesinterpretation im Grunde von zwei völlig verschiedenen Kriterien abhängig: zum einen vom entsprechen-den Objekt selbst, zum anderen von den erwähnten subjektiven Hilfen. Die Abhängigkeit zum Objekt ist in dieser Verbindung ganz natürlich und gewissermaßen erwünscht, die aber zu jenen subjektiven Hilfsmitteln hingegen nicht, denn Hilfsmittel gehören an und für sich nicht zum Objekt. Wir möchten Objekte so sehen wie sie tatsächlich sind, frei von jeglicher subjektiver Einmischung. Leider scheint genau dies prinzipiell nicht möglich zu sein, da unsere Sinnesinterpretation nicht nur vom Objekt, sondern, wie gesagt, eben auch von unseren subjektiven Hilfen abhängt. Demzufolge beeinflussen die subjektiven Bedingungen, namentlich die Kategorien und Anschauungs-formen, zwangsweise alle involvierten Wahrnehmungen.
Jener Gedankengang, den Kant sich rapide zu Eigen macht, scheint gar generell zu unterstellen, dass jede Art von erfüllter Bedingung alles nachfolgend Bedingte zwangsläufig beein-flusst, was allerdings ein sehr grober und bezüglich seines relevanten Systems letztlich ein fataler Fehler sein könnte!
Denn “etwas zu ermöglichen“ und “etwas zu beeinflussen“ ist keineswegs das Gleiche. Erfüllte Bedingungen “können“ gegebenenfalls alles Nachfolgende beeinflussen, was allerdings notwendigerweise mit einer Rückwirkung (!) verbunden ist – jene Ereignisse sind sodann generell relativ einmalig.
Andererseits bewirken bestimmte erfüllte Bedingungen, besonders im technischen Bereich, z. B das Einschalten eines Hauptschalters, dass der eine oder andere Vorgange im Ganzen ermöglicht wird, ohne dass sich dadurch ein erkennbarer Einfluss der Bedingungen auf das Bedingte ergibt. Solche Ereignisse sind an sich beliebig wiederholbar.
Vorgänge, die beliebig oft wiederholbar sein sollen, erfordern direkt, dass zugehörige Bedingungen absolut keinen Einfluss auf jene Vorgänge haben. Der aktuelle technische Stand der Welt – Elektronik, Computertechnik usw. – wäre praktisch nicht möglich, würde sich im Geiste Kants tatsächlich mit jeder Bedingung automatisch Einfluss (von der Bedingung auf das Bedingte) verbinden. – Jede Uhr hat zahlreiche Bedingungen. Würde jede einzelne Bedingung einer Uhr auf jene Uhr selbst inhaltlich einwirken, könnte es prinzipiell keine genau-gehende, bedingte, künstliche Zeitmesser geben. Tatsächlich haben wir jedoch Uhren die sehr genau gehen (von einigen Chaoten abgesehen) was ganz sicherlich kein bloßer Zufall ist.
Es gibt Uhren mit sehr verschiedenem Aufbau, mit also sehr verschiedenen Bedingungen – Armbanduhren, Kirchenuhren, Quarzuhren, Atomuhren usw. – die dennoch alle den aktuellen Wert der Zeit übereinstimmend anzeigen, obwohl sie völlig unterschiedlichen technischen Bedingungen unterliegen.
Wenn aber Bedingungen grundsätzlich in jedem Fall Einfluss auf das jeweils Bedingte hätten, dürfte es, wie erwähnt, nicht so etwas wie verschiedene Uhren geben, die dennoch übereinstim-mend die Zeit angeben.
Was hat die Technik mit der Erkenntnistheorie zu tun? – könnte man hier einwenden. Vielleicht mehr als man zunächst annehmen möchte, denn gerade in der Elektronik und der Computertechnik – wie eben auch in der Erkenntnistheorie – geht es nicht zuletzt um die Verarbeitung von Information.
Informationsvermittlung, und ganz besonders eine inhaltliche Veränderung einer Information, ist in der Regel mit Energieaus-tausch verbunden.
Wenn jedoch “inhaltliche Einflussnahme“ generell unter dem Energie-Aspekt zu sehen ist, treten für Kant in diesem Tone eine ganze Palette Probleme auf, die wir weder hier noch später in diesem Werk alle behandeln können – auch im Hauptteil können wir uns diesbezüglich lediglich auf einige offenkundige Kriterien beziehen. Dass wir erkenntnistheoretische Argumente überhaupt in Relation zu physikalischen Aspekten setzen, hat in dieser Branche nicht unbedingt Tradition. Erkenntnistheore-tische Diskussionen setzen sich leider allzu oft über technische und physikalische Aspekte hinweg, als ob Letztere nicht existieren würden. Technik und Physik mögen an und für sich als empirisch gelten.
Dennoch dürfte es legal sein sie zu apriorischen Überle-gungen heranzuziehen, insbesondere dann, wenn es um den Bereich der Informationsverarbeitung bzw. um deren (absoluten) Wahrheitsgehalt geht.
Es ist jedenfalls unumgänglich exakt zu differenzieren was genau von Kants Kategorien im erkenntnistheoretischen Kontext abhängt und was nicht bzw. wie weit der Einfluss jener subjek-tiven Vorgaben tatsächlich reichen kann und welche Grenzen er grundsätzlich nicht zu überschreiten vermag.
Alle Empfindungen sind “Kopfsache“. Ein Idealist würde eventuell gar sagen, dass Leben ohnehin reine Kopfsache sei. Wir haben innere Empfindungen zu denen gemäß unserer Sinne äußere Objekte entsprechen. Allein dieser Fakt hat soweit aus strenger philosophischer Sicht noch keinerlei Beweiskraft. Ein Beweis schließt die Möglichkeit der Täuschung kategorisch aus.
Jeder weiß hingegen, dass unsere Sinne zuweilen recht störanfällig sind und wir, so oder so, Täuschungen der verschie-densten Art relativ machtlos gegenüberstehen. Könnte folglich der Lebenseindruck insgesamt etwa ein Irrtum sein?
Andererseits, wenn alles Täuschung wäre verliert alles seine Berechtigung – letztlich auch der Begriff der Täuschung selbst! Dass wir uns gegebenenfalls täuschen, beweist die Realität der äußeren Welt, denn einer rein inneren Welt fehlt jegliche Grundlage sich überhaupt zu täuschen, da ohne “Übertrag“.
Unsere Lebenseindrücke sind differenziert, jene Differen-zierung ließe sich im Wesentlichen darauf zurückführen, dass die Welt schon so ist, wie wir sie wahrnehmen. Alle unsere Wahrnehmungen sind lediglich innere Bilder unseres Geistes – wie kommt hingegen unser Geist zu jenen Bildern – sind jene Abbildungen getreue, relativ verzerrte oder völlig entstellte Repräsentanten der jeweiligen äußeren Objekte? Existieren überhaupt äußere Objekte? Ist die Welt nicht letztlich ein einziges großes Ich – somit rein innerlich – oder wird uns die Welt in Form eines Hologramms, einer Computeranimation oder ähnlicher Tricks lediglich vorgespielt?
Zunächst einmal lässt sich die Möglichkeit prinzipieller unumgänglicher Täuschung wesentlich schwerer begründen als eine relativ naive Hinnahme der gegebenen Fakten.
Ein Hologramm, eine Computeranimation und vergleichbare künstliche Mittel der Täuschung können immer nur isolierte einzelne Kriterien erfolgreich imitieren, nicht hingegen komplexe und schon gar nicht die höchst komplexe Welt insgesamt.
Nimmt man beispielsweise an, dass die äußere Welt ein künstlich erzeugtes Hologramm ist, so bleibt dennoch irgendwo eine Lücke zwischen künstlicher Animation und dem realen Ich, die sich auf die eine oder andere Art und Weise bemerkbar machen müsste – eine weitere künstliche Animation um diesen Makel zu beseitigen würde einen unendlichen Regress eröffnen.
Ein unendlicher Regress wäre in diesem Beispiel jedoch ohnehin unumgänglich, da jeder einzelne künstliche Aspekt letztlich ein zusätzliches Hologramm benötigt um jenes Künstli-che des künstlichen Einzelaspekts im vollen Zusammenhang echt wirken zu lassen.
Täuschend wirkt aber vor allem diesbezüglich der Fakt, dass wir uns innerlich Dinge vorstellen können, die äußerlich nicht gegeben sind, zumindest nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Im Traum halten wir alles was wir träumen für äußerlich real – wir wachen auf und erkennen, dass alles, was wir soeben erträumten nur innerlich geschah – wir also getäuscht wurden (→ S. 174, 180). Vornehmlich Idealisten nehmen sich diesen bedenklichen Fakt vorzüglich zu Herzen und behaupten, dass die äußere Welt nicht notwendig ist, um uns Vorstellungen zu ermöglichen.
“But though it were possible that solid, figured, moveable substances may exist without the mind, corresponding to the ideas we have of bodies, yet how is it possible for us to know this? Either we must know it by sense, or by reason. As for our senses, by them we have the knowledge only of our sensations, ideas, or those things that are immediately perceived by sense, call them what you will: but they do not inform us that things exist without the mind, or unperceived, like to those which are perceived. This the materialists themselves acknowledge. It remains therefore that if we have any knowledge at all of external things, it must be by reason, inferring their existence from what is immediately perceived by sense. But what reason can induce us to believe the existence of bodies without the mind, from what we perceive, since the very patrons of matter themselves do not pretend, there is any necessary connexion betwixt them and our ideas? I say it is granted on all hands (and what happens in dreams, phrensies, and the like, puts it beyond dispute) that it is possible we might be affected with all the ideas we have now, though no bodies existed without, resembling them. Hence it is evident the supposition of external bodies is not necessary for the producing our ideas: since it is granted they are produced sometimes, and might possibly be produced always in the same order we see them in at present, without their concurrence.” Berkeley, 1985, S. 82
Wenn selbst Materialisten zugeben, dass unsere “Ideen“ keiner realen äußeren Dinge bedürfen, so scheint dies dem Idealismus uneingeschränkt alle Türen zu öffnen. Indes Berkeley übersieht, dass rein innere Vorstellungen, besonders im Traum, eine völlig andere Qualität haben als solche, die wir mit direkter Hilfe der Sinne formen (→ S. 173-6, 180). Warum sollten wir überhaupt Empfindung haben, wenn alles von innen aus möglich ist? Berkeley scheint Menschen gekannt zu haben, die keine Sinne hatten und dennoch munteres geistiges Innenle-ben vorweisen konnten. Wenn aber ein Mensch tatsächlich von Geburt an keinen Blick nach Außen hat, so ist er erfahrungsge-mäß extrem benachteiligt. Auch wenn innerlich alles stimmt – aus bloßer Möglichkeit der Erfahrung lässt sich nicht auf Erfahrung schließen, aber bleiben wir zunächst eng bei Kant:
Die Grundbegriffe “a priori“ (vor aller Erfahrung, bzw. erfahrungs un abhängig) “a posteriori“ (nach der Erfahrung bzw. erfahrungsabhängig) “subjektiv“ und “objektiv“, “notwendig“ und “zufällig“ sind für Kant von ausschlaggebender Bedeutung, ebenso die Begriffe “analytisch“, “synthetisch“ und “a priori synthetisch“ – Kant macht vorneweg aus Letzteren regelrecht eine Wissenschaft für sich (die allerdings nicht unbedingt in jeder Beziehung überzeugt und uns nicht direkt interessiert). Erfahrung hat für Kant in absoluter Sicht im Grunde zufälligen Charakter (mit eher menschlichem Blick erklimmt sie bei ihm hingegen mit Leichtigkeit die Höhe der Objektivität – ein besonderer Umstand seiner Erkenntnistheorie, zu dem sich bereits ganze Berge von Problemen gesellen). Mit “a priori“ verknüpft Kant “Notwendigkeit“ (weil frei von Erfahrung) – mit “a posteriori“ “Zufälligkeit“ (weil abhängig vom Zufall der Erfahrung – siehe auch Bemerkung S. 331 [Original, hier aber S. 201]).
Immerhin scheint zumindest alles Apriorische zweifelsfrei rein subjektiven Ursprungs zu sein – überhaupt haben wir auf subjektiver Seite zunächst lediglich apriorische Kriterien vorliegen. Woher also kommen die aposteriorischen Elemente? Von außen? Außen liegen lediglich die Dinge an sich selbst vor. Diese wiederum sind im absoluten Tenor real – sind somit wohl an sich kaum empirisch zufällig, auch wenn sie vermittelst der subjektiven Sinnesinterpretation, gemäß Kant, der Ursprung des empirischen, zufälligen Empfindens sind. Warum sollte überhaupt irgendetwas in unseren Erscheinungen zufällig, unbestimmt sein, wo doch Kant alle Erscheinungen generell unter bestimmte subjektive Gesetzmäßigkeit stellt? Ist es überhaupt möglich dem Zufall eine Ordnung aufzuzwingen?
Das sind keine nebensächlichen Fragen! Die Tatsache, dass wir in den verschiedensten Lebensbereichen üblicherweise Ordnung schaffen können, verleitet sehr leicht zu der Annahme, dass sich grundsätzlich alles ordnen lässt – das aber könnte ein kategori-scher Fehler sein, zumindest im absoluten Bereich, und in der Erkenntnistheorie sind wir halt generell in jenem Feld!
Man kann sein Zimmer aufräumen, seinen Garten, die Schul-mappe, einen Schrank ... wo an sich alles seinen Platz hat.
Dass aber alles seinen Platz hat, setzt eine gewisse Grund-ordnung voraus, setzt vor allem voraus, dass die zu ordnen-den Kriterien der soeben erwähnten Grundordnung ent-sprechen. Genau das aber ist bei Kant nicht der Fall! Der eigentlich zu ordnende Stoff hat bei ihm definitiv nicht die Qualität des entsprechend ordnenden Systems, sondern erhält jene Qualität erst durch Letzteres (in diesem Falle durch das System unserer subjektiven Gründe der Erfahrung).
Wo soll die Ordnung anfangen, wo aufhören, wenn seitens des zu ordnenden Stoffs diesbezüglich keinerlei Anhaltspunkte bestehen? (Mehr zu “Ordnung“ → u. a. S. 165-6, 198)
Mit dem Begriff der Objektivität verbindet Kant sehr eigen-willige Vorstellungen, die teilweise erheblich vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichen – wir werden sogleich (S. 27-8) aus-drücklich darauf hinweisen. Man sollte ohnehin nicht erwarten, dass Kant ein von A bis Z durchgehend schlüssiges Programm bietet, wo jeder Stein exakt auf den anderen passt – keineswegs!
Kant ist nach wie vor relativ interessant – weniger weil er ein in sich abgeschlossenes klares System anbietet, als vielmehr vielleicht, weil er dazu eher das genaue Gegenteil präsentiert – weil seine Erkenntnis-theorie immer noch ein offenes Spiel darstellt, weil jene Theorie insgesamt relativ vage ist und erhebliche Lücken aufweist.
Nicht dass Kant die Absicht hätte uns zu täuschen, aber sein Trans-zendentaler Idealismus bringt es notwendigerweise mit sich, dass relativ deutliche Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs bei ihm nicht selten zu völlig unbestimmten Begriffen verwässern.
So redet Kant oft von Begriffen des Grundes, der Ursache, von “affiziert werden“, von etwas, das etwas anderes “rührt“ usw. mit einer kaum zu übersehenden – vom Standpunkt des Transzendentalen Idealismuses praktisch unvermeidbaren – Doppelzüngigkeit. Damit das Ganze trotz markanter Gegensätze dennoch halbwegs im Lot bleibt, ist Kant zu einigen äußerst einschneidenden Kompromissen gezwungen.
a priori (rein, d. h. vor aller, bzw. unabhängig von aller Erfahrung) – analytisch – Allgemeine – Begriffe – Gesetz – Notwendigkeit – notwen-dige Bedingungen d. Möglichk. d. Erfahrung – Kategorien – reine An-schauung – Ganze – (potentielle) Fülle – pauschal – reine Vorstellungen,
synthetische Einheit a priori des Mannigfaltigen der Erfahrung.
a posteriori (abhängig von Erfahrung) – empirisch – nicht notwendig – Zufall – Sinnlichkeit – empirische Gesetze – (empir.) Vorstellungen.
dazwischen: transzendental, Schema, synthetisch (generell), Einzelne (konkrete Vorstellung, individueller Einzelfall), empirische Gesetze ...
Eine herausragende Bedeutung bekommt später die Frage:
Woher genau kommt das “Einzelne“ bei Kant? Kant führt das Einzelne als eine besondere Verstandes-Kategorie – ein zweifelhafter Kunstgriff, verstehen sich Kategorien doch generell als “allgemeine“ Begriffe. Wie also kann das Allgemeine gleichzeitig Einzelnes sein? Allgemeine, Gesetz, potentielle Fülle, Ganze werden wir in jener Beziehung dem Einzelnen, Individuellen frontal gegenüberstellen.
Nebst den weiter oben erwähnten Begriffen: Grund der Erkenntnis, affizieren und rühren, sollten wir nun solche wie Objektivität, Zufall, Ordnung, Gesetze, a priori notwendig und a posteriori empirisch unter dem Systeme Kants in etwas breiterer Form betrachten, wobei wir uns im Wesentlichen auf Kants Kritik der reinen Vernunft (Kürzel “KrV“ generell, z. B: “KrV A158“ konkret) und seiner (bzw. seinen) Prolegomena (Kürzel “Prol.“ generell, z. B: Prol. § 53 konkret) stützen werden.
Wir sind aber noch in der Anlaufphase, d. h. es geht zunächst weniger um irgendwelche Details an sich, als vielmehr darum, das jeweilige Umfeld für spätere Ziele vorzubereiten:
2 Vorbereitung zum Hauptteil
“Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, darin ist gar kein Zweifel; denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren [...]“ (KrV B1)
Jene Gegenstände, und damit quasi die Realität an sich, sind in diesem Bezug jedoch offenbar nicht genug. Denn ganz im Geiste Humes ist Kant der Meinung, dass Erfahrung lehrt:
“[...] daß auf eine Erscheinung gewöhnlicher Maßen etwas Andres folge, aber nicht, daß es notwendig darauf folgen müsse, noch daß a priori und ganz allgemein daraus als einer Bedingung auf die Folge könne geschlossen werden.“ (KrV A112)
“Nun ist aber der Schluß von einer gegebenen Wirkung auf eine bestimmte Ursache jederzeit unsicher; weil die Wirkung aus mehr als einer Ursache entsprungen sein kann.“ (KrV A368)
“[...] so daß alle Dinge der Sinnenwelt durchaus zufällig sind, mithin auch immer nur empirischbedingte Existenz haben [...]“
(KrVA560/B588, siehe auch KrVA562/B590ff. B142, A114)
Mittels des Zufalls lassen sich Wahrheit und Objektivität kaum begründen. Dennoch findet Kant, dass wir Bezug zur Objektivität und zur Wahrheit haben (obgleich nicht mit absoluter Gültigkeit), die sich auf subjektive gesetzliche Vorgaben aufbaut (Anschauungsformen, Kategorien bzw. Verstandesregeln):
“Ob nun aber gleich diese Verstandesregeln nicht allein a priori wahr sind, sondern so gar der Quell aller Wahrheit, d. i. der Übereinstimmung unserer Erkenntnis mit Objekten, dadurch, daß sie den Grund der Möglichkeit der Erfahrung [...] in sich enthalten [...]“ (KrV B296)
Dabei handelt es sich allerdings lediglich um subjektiv-reale Objekte, denn der Zugang zur objektiven Realität, mit absoluter Sicht, ist uns nach Kant nun einmal prinzipiell verwehrt – ein Fakt den er gerne verbannen möchte. Denn Kant will möglichst ein Repräsentant des common sense sein – sein T. Idealismus nötigt ihn hingegen zu eklatanten Kompromissen die sich zuwei-len mit dem common sense grundsätzlich kaum vereinbaren, was unschwer u. a. am Beispiel des Begriffs der Zeit zu ersehen ist:
“ Sie [die Zeit] ist nur von objektiver Gültigkeit [...]
Die Zeit ist also lediglich eine subjektive Bedingung unserer (menschlichen) Anschauung (welche jederzeit sinnlich ist, d. i. so fern wir von Gegenständen affiziert werden,) und an sich, außer dem Subjekte, nichts. Nichts desto weniger ist sie in Ansehung aller Erscheinungen, mithin auch aller Dinge, die uns in der Erfahrung vorkommen können, notwendiger Weise objektiv.
“[...] alle Dinge, als Erscheinungen (Gegenstände der sinnlichen Anschauung), sind in der Zeit; so hat der Grundsatz seine gute objek-tive Richtigkeit und Allgemeinheit a priori. [Sehr gut! – aber leider:]
Unsere Behauptungen lehren demnach empirische Realität [!?] der Zeit, d. i. objektive Gültigkeit in Ansehung aller Gegenstände, die jemals unsern Sinnen gegeben werden mögen. [...] Dagegen bestreiten wir der Zeit allen Anspruch auf absolute Realität.“ (KrV A34-5/B51-2, ferner: KrV BXXVII, B44/A28/B44, A57/B81, A89-0/B122, B137, A111, A239)
Kant ist sich natürlich bewusst, dass seine Behandlung des Begriffs der Objektivität, soeben am Beispiel der Zeit kurz vorgestellt, nicht wirklich befriedigt, denn mit Objektivität verbinden wir im allgemeinen Sprachgebrauch einen absoluten und keinen lediglich subjektiven Bezug zur Realität. Jener Begriff ist allgemein sozusagen die rettende Insel nach der sich die Menschheit, umringt mit den Trümmern der eigenen subjektiven Unzulänglichkeit, sehnt.
Nun, absolute Objektivität zielt bei Kant auf Dinge an sich selbst. Da Letztere für uns angeblich unerkennbar sind und sich menschliche Erkenntnis ohnehin nach den Kategorien und An-schauungsformen richtet, bezieht Kant menschliche Objektivität auf jene subjektiven Formen und nicht auf die Dinge an sich:
“[..] dadurch denn die Kategorien, als bloße Gedankenformen, objektive Realität, d. i. Anwendung auf Gegenstände, die uns in der Anschauung gegeben werden können, aber nur als Erscheinungen bekommen; [...]“ (KrV B150-1 – Original kursiv)
“objektive Realität“, wie soeben zitiert – Objektivität generell, wird somit bei Kant, wie erwähnt, menschlich-subjektiv. Objektivität ist damit aber nicht gleich willkürlich zufällig! Sie wird garantiert durch apriorische subjektive Bedingungen (d. M. d. E. ) und Letztere sind Ge-setze mit notwendiger, allgemein-menschlicher Gültigkeit (u. a. KrV B4, B163-5) während empirische Allgemeinheit (ein höchst problematischer Begriff) allenfalls in den meisten Fällen gilt – das absolut Reale der Dinge an sich bleibt so oder so völlig unerreicht. Im apriorischen Bereich wirkt Kant sehr stark, umso schwächer indes im empirischen:
“Es ist aber hierbei gar nicht die Meinung, das unbedingtnotwendige Dasein eines Wesens zu beweisen, oder auch nur die Möglichkeit einer bloß intelligibelen Bedingung der Existenz der Erscheinungen der Sin-nenwelt hierauf zu gründen, sondern nur eben so, wie wir die Vernunft einschränken, daß sie nicht den Faden der empirischen Bedingung verlasse, und sich in transzendente und keiner Darstellung in concreto fähige Erklärungsgründe verlaufe [...] Es wird also dadurch nur gezeigt, daß die durchgängige Zufälligkeit aller Naturdinge und al-ler ihrer (empirischen) Bedingungen, ganz wohl mit der willkürlichen Voraussetzung [autsch!] einer notwendigen, obzwar bloß intelligibelen Bedingung zusammen bestehen könne, also kein wahrer Widerspruch zwischen diesen Behauptungen anzutreffen sei [...]“ (KrV A562/B590)
“[...] daß ein Urteil nichts andres sei, als die Art, gegebene Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Apperzeption zu bringen. [...] wenn gleich das Urteil selbst empirisch, mithin zufällig ist, z. B. die Körper sind schwer. Damit ich zwar nicht sagen will, diese Vorstel-lungen gehören in der empirischen Anschauung notwendig zu einander, sondern sie gehören vermöge der notwendigen Einheit der Apperzeption in der Synthesis der Anschauungen zu ein-ander, d. i. nach Prinzipien der objektiven Bestimmung aller Vorstel-lungen, so fern daraus Erkenntnis werden kann, welche Prinzipien alle aus dem Grundsatze der transzendentalen Einheit der Apperzeption abgeleitet sind. Dadurch allein wird aus diesem Verhältnis ein Ur-teil, d. i. ein Verhältnis, das objektiv gültig ist [...]“ (KrV B141-2)
“Nur daran also, daß diese Begriffe die Verhältnisse der Wahrneh-mungen in jeder Erfahrung a priori ausdrücken, erkennt man ihre objektive Realität, d. i. ihre transzendentale Wahrheit, und zwar freilich unabhängig von der Erfahrung, aber doch nicht unabhängig von aller Beziehung auf die Form einer Erfahrung überhaupt, und die synthetische Einheit, in der allein Gegenstände empirisch können erkannt werden.“ (KrV A221-2/B269)
“Nun kann der Gegenstand einem Begriffe nicht anders gegeben werden, als in der Anschauung, und, wenn eine reine Anschauung noch vor dem Gegenstande a priori möglich ist, so kann doch auch diese selbst ihren Gegenstand, mithin die objektive Gültigkeit, nur durch die empirische Anschauung bekommen, wovon sie die bloße Form ist. Also beziehen sich alle Begriffe und mit ihnen alle Grundsätze, so sehr sie auch a priori möglich sein mögen, dennoch auf empirische Anschauungen, d. i. auf data zur möglichen Erfahrung. Ohne dieses haben sie gar keine objektive Gültigkeit, [...]“ (KrV A239/[B298])
Mit Empirisch (und Synthetisch) scheint Kant, wieder alles auf den Kopf zu stellen, was eine Seite zurück (vorliegendes Werk, S. 28) im bloßen apriorischen Bereich subjektiver Bedingungen d. Erfahrung noch gerade stand! Überhaupt ist der Mix: a priori zu a posteriori ein permanentes Problem, das im Laufe der KrV einen Kopfstand nach dem anderen provoziert. Die gesetzlich-objektive Kraft liegt zunächst eindeutig allein im Apriorischen begründet (→ S. 99, obere Hälfte). Damit erreicht Immanuel jedoch noch nicht das Individuelle – er benötigt zusätzlich das Empirische – ja gar empirische Gesetze – ein gewisser Zickzackkurs ist somit zwangsläufig vorprogrammiert (KrV 127-8, → u. a. S. 75, B164-5). Denn das eigentliche Wesen des Gesetz-lichen ist generell, über Kant hinaus, ja gerade seine “allgemeine“ nicht-individuelle Zuständigkeit (u. a. → S. 83, 94, auch: KrV A113)!
Mit empirischen Mitteln kann Kant sich diesbezüglich eigentlich nur selbst widersprechen, weit überzeugender wirkt er, wie erwähnt, hinge-gen a priori, auch wenn sich dadurch sofort neue Probleme ergeben:
“Die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein, und würden sie auch nicht darin finden können, hätten wir sie nicht, oder die Natur unseres Gemüts ursprünglich hineingelegt. Denn diese Natureinheit soll eine notwendige, d. i. a priori gewisse Einheit der Verknüpfung der Erscheinungen sein. Wie sollten wir aber wohl a priori eine synthetische Einheit auf die Bahn bringen können, wären nicht in den ursprünglichen Erkenntnisquellen unseres Gemüts subjektive Gründe solcher Einheit a priori enthalten, und wären diese subjektive Bedingungen nicht zugleich objektiv gültig, indem sie die Gründe der Möglichkeit sein, überhaupt ein Objekt in der Erfahrung zu erkennen.“
(KrV A125-6, siehe auch: KrV A158-9/B197-8, B122, B126, B140-2, B269/A222, Prol. § 15-21)
Kant erweckt hier ganz offensichtlich bewusst den Eindruck, als ob subjektive Gründe der Möglichkeit der Erfahrung den Weg zu absoluter Objektivität verbauen. Wie jedoch kommt er zu einer solch gewichtigen Unterstellung?
Dazu würde er etwa sagen: Das liegt doch klar auf der Hand! Erfahrung ist bedingt durch subjektive apriorische Bedingungen, somit zeigt Erfahrung grundsätzlich Züge jener subjektiven Bedingungen – im Gegensatz zu den Dingen an sich selbst. Demnach würden unsere subjektiven Bedingungen der M. d. Erfahrung inhaltlich in genau jene Erfahrung einfließen und also unweigerlich jeglichen Zugang zur absoluten Realität prinzipiell unmöglich machen.
Suppe ist Suppe – bedingt durch Löffel u. Teller (...) gäbe es da mit Kant jedoch erhebliche Bedenken (→ S. 95) – ob versalzen oder nicht!
Weil ohne A kein B – ultimative Kurzform des letzten Zitats – hat das jedoch zwangsweise inhaltliche Konsequenz zu B?
Regeln/Gesetze können die Wirkung bestimmter Fakten und Werte in bestimmten Umständen beschreiben. Kant lässt hingegen die Gesetze selbst wirken, d. h. ohne Fakten, Letztere erzeugt er eben mittels jener Regel, ganz wie er Ordnung der Welt diktiert, ohne dass jene Welt an sich Elemente jener Ordnung enthält – er nötigt sie ihr einfach auf! – insgesamt ein willkürlicher Schritt das Einzelne über das allgemeine Ganze unlogisch zu erzwingen.
“Nun heißt aber die Vorstellung einer allgemeinen Bedingung, nach welcher ein gewisses Mannigfaltige, [...] gesetzt werden kann, eine Regel, und wenn es so gesetzt werden muß, ein Gesetz.“ (KrV A113 Original kursiv, - “allgemeinen“ u. “Gesetz“ unsererseits betont.)
Kant hat natürlich auch Humor: “Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten [...].“ (KrV BXVI – auch im Original kursiv)
Kant ist zuweilen gar ein vorzüglicher Witzbold – er nimmt seine Scherze gegebenenfalls ganz außerordentlich ernst, etwa nach dem Motto: Es gelingt, weil es gelingen muss!
“Man versuche es daher einmal [...]“ Nun, den Versuch wollen wir ihm gerne zugestehen. Ein Versuch, gerade wenn er nicht recht gelingt, kann jedoch leicht zur fixen Idee werden. Kant macht bereits einen schwerwiegenden systematischen Fehler, indem er im weiteren Verlauf der KrV diesen Versuch unbedingt als unfehlbare Tatsache verkaufen will und dabei vergisst, dass er nur auf Probe fährt – er ist zu unkritisch zu sich selbst (vergleiche zu S. 108)!
Wenn die zitierten Gegenstände (KrV BXVI) – was für Gegenstände? – gemeint sind sicherlich die Dinge der absoluten Realität, also die Dinge an sich selbst – Kant hätte sich hier präziser ausdrücken können! Die Dinge an sich selbst sind hingegen keine Gegenstände im klassischen Sinne – sie werden mit Kants System erst zu Gegenständen durch die Anwendung der subjektiven Kategorien und Anschauungsformen – aber soweit sind wir an dieser relativ frühen Stelle der KrV anscheinend noch nicht. (Doch an diesem Punkt gehen die Meinungen oft ziemlich weit auseinander, siehe dazu z. B. Hans Vaihinger, Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, 2. Auflage 1922, 1970, Seite 172-5)
Wenn also “die Gegenstände“ sich nach uns richten müssen, so heißt dies letztlich, dass, entsprechend subjektiver Zielvorga-ben, eine inhaltliche Umformung stattfindet. In diesem Falle hätten die subjektiven Vorgaben keine Art passiver Filterfunk-tion – eine Filterfunktion wäre in diesem Zusammenhang relativ problemlos – sondern die Funktion einer vom Subjekt selbst ausgehenden kreativ wirkenden Zielvorgabe.
Dieser vermeintlich kleine Unterschied ist bedeutsam. Etwas “herauszufiltern“ ist prinzipiell keine kreative Neugestaltung als vielmehr ein Auswahlverfahren unter grundsätzlich bereits voll-ständig gegebenen Kriterien. Eine Zielvorgabe macht hingegen in diesem Sinne eine schöpferische Neugestaltung erforderlich.
Aus diesem relativ einfachen Sachverhalt resultiert nun ein erhebliches Problem. Denn eine Zielvorgabe beinhaltet keines-wegs automatisch die Mittel um ein solches Ziel zu erreichen. Da Kant in keiner Weise andeutet worauf sich die involvierte Notwendigkeit gründen sollte (ausgenommen seinen “Hauptfehler“ der vor allem aus KrV B197, B161, A128 resultiert – siehe u. a. Seite 93-4, 111, 116) wäre er folglich genötigt, seine diesbezüglichen, subjektiven Vorgaben (namentlich die Verstandeskategorien und Anschauungsformen) einerseits als Ziel und andererseits gleichzeitig als Wegbereiter zu jenem Ziel zu betrachten – somit quasi Pfeil und Ziel in einem. Abgesehen dieses logischen Widerspruchs in den sich Kant hier verfängt (dessen er sich selbst offenbar nicht einmal im Ansatz bewusst wird) deutet sich u. a. mit unserem letzten Zitat eine ganz bestimmte, in unserem Sinne sehr wichtige Grundhaltung an:
Kant geht offenkundig grundsätzlich – fast wie selbstver-ständlich – davon aus, dass relativ fixe, gesetzliche Vorgaben von schöpferischer Wirkung im positiven Sinne sein können, ohne sich jemals ernsthaft zu fragen, ob und unter welchen Voraussetzungen dies überhaupt möglich ist – ein eventuell schwerwiegender Unterlassungsfehler!
Der bereits mehrfach genannte Begriff “a priori“ ist für Kants gesamte Erkenntnistheorie außerordentlich wichtig, denn damit gedenkt sich unser Königsberger Philosoph freimachen zu können von aller Erfahrung, die, besonders im Sinne Humes, dem Kant entsprechend folgt, wie wir gleich sehen werden, schein-bar grundsätzlich empirisch und damit relativ unbestimmbar ist und offenbar generell zufällige Charakterzüge trägt. Im folgenden Zitat wiederholt Kant für uns zunächst einige bereits erwähnte Aspekte – darüber hinaus macht er eine sehr bemerkenswerte Verknüpfung, welche das aposteriorisch Unbestimmte (das Empirische der Erfahrung) mit dem a priori Notwendigen verbindet, was im Kern praktisch das Grundprinzip seines Transzendentalen Idealismusses beinhaltet:
“Erfahrung [...] Sie sagt uns zwar, was da sei, aber nicht, daß es notwendiger Weise, so und nicht anders, sein müsse. Eben darum gibt sie uns auch keine wahre Allgemeinheit, und die Vernunft, welche nach dieser Art von Erkenntnis so begierig ist, wird durch sie mehr gereizt, als befriediget. Solche allgemeine Erkenntnis nun, die zugleich den Charakter der innern Notwendigkeit haben, müssen, von der Erfahrung unabhängig, vor sich selbst klar und gewiß sein; man nennt sie daher Erkenntnisse a priori: da im Gegenteil das, was lediglich von der Erfahrung erborgt ist [...] nur a posteriori, oder empirisch erkannt wird. Nun zeigt es sich [...] daß selbst unter unsere Erfahrung sich Erkenntnisse mengen, die ihren Ursprung a priori haben müssen, und die vielleicht nur dazu dienen, um unsern Vorstellungen der Sinne Zusammenhang zu verschaffen. Denn, wenn man aus den ersteren auch alles wegschafft, was den Sinnen angehört, so bleiben dennoch gewisse ursprüngliche Begriffe und aus ihnen erzeugte Urteile übrig, die gänzlich a priori, unabhängig von der Erfahrung entstanden sein müssen, weil sie machen, daß man von den Gegenständen, die den Sinnen erscheinen, mehr sagen kann, wenigstens es sagen zu können glaubt, als bloße Erfahrung lehren würde, und daß Behauptungen wahre Allgemeinheit und strenge Notwendigkeit enthalten, dergleichen die bloß empirische Erkenntnis nicht liefern kann.“ (KrV A1, A2 – steht auch im Original in kursiv). (In der B-Version moduliert und erweitert Kant diesen Gedankengang noch etwas (KrV B1, B2, auch → S. 56, 187).)
Die erwähnte Verknüpfung a priori zu a posteriori hat, was aus dem letzten Zitat nicht direkt hervorgeht, einen markanten Schönheitsfehler, der sich quer durch Kants System zieht und wesentlich dazu beiträgt, dass – fast wie die Relativi-tätstheorie Einsteins – jenes System sich grundsätzlich unserem “normalen“ Vorstellungsvermögen zu entziehen scheint.
Denn Notwendigkeit ergibt sich in allgemeiner Bedeutung eher aus der Umwelt, als aus irgendeiner persönlichen Situation, während Zufälligkeit oder Unbestimmbarkeit eher dem Persön-lichen beigemessen wird – bei Kant ist es hingegen genau umgekehrt: Notwendigkeit ergibt sich bei ihm grundsätzlich nicht aus der erfahrenen Umwelt, sondern aus den prinzipiell bestimmbaren, im jeweiligen Subjekt selbst verankerten, apriorischen Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt:
“[...] und, da Erfahrung Erkenntnis durch verknüpfte Wahr-nehmungen ist, so sind die Kategorien Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, und gelten also a priori auch von allen Gegenständen der Erfahrung.“ (KrV B161 – steht auch im Original kursiv)
Auf unsere subjektiven Bedingungen ist Verlass, auf die Erscheinungen der erfahrbaren Umwelt ist hingegen kein Verlass, weil unseren Erscheinungen sich nicht nur aus apriorischen, demnach bestimmten -, sondern eben auch aus aposteriorischen bzw. empirischen, also unbestimmten Elemen-ten zusammensetzt.
Die apriorischen Elemente sind als fest vorgegebene Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt in uns selbst verankert (wo, wie, wann ... genau, spielt hier keine Rolle). Die empirischen Elemente der Erfahrung erhalten wir hingegen durch unsere Sinnesorgane, von der relativ äußeren Umwelt – von der absoluten Realität, wenn man so will.
Die erfahrbare Welt wird somit erst durch eine subjektive Einmischung objektiv, woraus sich die im Verhältnis zum allgemeinen Sprachverständnis schlicht groteske Behandlung der Begriffe der Objektivität und der Wahrheit bei Kant ergibt, wie aus den beiden folgenden kurzen Auszüge nochmals zu ersehen ist:
“[...] die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung, und haben darum objektive Gül-tigkeit [...].“ (KrV A158/B197, siehe auch z. B. A125-6, B141-2, B197/A158)
“[...] denn alles ist wirklich, was mit einer Wahrnehmung nach Gesetzen des empirischen Fortgangs in einem Kontext stehet. Sie sind also alsdenn wirklich, wenn sie mit meinem wirklichen Bewußtsein in einem empirischen Zusammenhang stehen, ob sie gleich darum nicht an sich, d. i. außer diesem Fortschritt der Erfahrung wirklich sind.“ (KrV A493, siehe auch A110-4)
Der zunächst offensichtliche Vorteil, den Kant sich durch verschiedene apriorische Maßnahmen erspielt, geht ihm im Laufe des Gefechts verloren, bzw. zeigt sehr bald seine Schattenseiten. Denn, nebst den unmittelbar zuvor erörterten Einwänden, verliert sich damit der ureigentliche Grund unserer Erkenntnis scheinbar mehr, als dass er sich auf irgendeine Art und Weise bestätigt.
Während Berkeley, der klassische Vertreter des Idealismuses, immerhin relativ eindeutig sagen kann, dass bezüglich der Erfahrung alles von Innen kommt (und der Inhalt des Inneren letztlich auf Gott zurückgeht) und Vertreter des Rationalis-muses, vorzüglich Befürworter des Materiellen Realismuses, sich relativ einig sind, dass entgegen Berkeley, der ultimative Grund unserer Erfahrung von Außen, von der unabhängigen Realität stammt (wobei bekanntlich Materialisten durchweg zum Atheismus tendieren), lässt sich diesbezüglich bei Kant kaum eine ähnlich eindeutige Feststellung treffen.
Kant hat eine sehr realistische Seite: er ist von der grundsätz-lich bewusstseinsunabhängigen absoluten Realität überzeugt. Er ist zudem überzeugt, dass sich unsere Gegenstände der Erfahrung, unsere Erscheinungen also, im Grunde auf bewusstseinsunab-hängige, absolut wahre, absolut wirkliche Dinge, die sogenannten Dinge an sich selbst, beziehen. Solche relativ “unbedingte“ Dinge der absoluten Realität entziehen sich jedoch, so Kant, prinzipiell unserem Vorstellungsvermögen, da wir uns alles lediglich “bedingte“ vorstellen können – bedingt insbesondere durch die uns eigenen subjektiven Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt. (Letztere wären sodann, gemäß Kant, die Verstandeskategorien und die reinen Formen der Anschauung.)
Im Zusammenhang mit seiner Widerlegung des Idealismuses schreibt Kant dazu:
“Ich bin mir meines Daseins als in der Zeit bestimmt bewußt. Alle Zeitbestimmung setzt etwas Beharrliches in der Wahrnehmung voraus. Dieses Beharrliche aber kann nicht eine Anschauung in mir sein. Denn alle Bestimmungsgründe meines Daseins, die in mir angetroffen werden können, sind Vorstellungen, und bedürfen, als solche, selbst ein von ihnen unterschiedenes Beharrliches, worauf in Beziehung der Wechsel derselben, mithin mein Dasein in der Zeit, darin sie wechseln, bestimmt werden könne. Also ist die Wahrnehmung dieses Beharrlichen nur durch ein Ding außer mir und nicht durch die bloße Vorstellung eines Dinges außer mir möglich. Folglich ist die Bestimmung meines Daseins in der Zeit nur durch die Existenz wirklicher Dinge, die ich außer mir wahrnehme, möglich.“
(KrV B275-6 – steht im Original auch kursiv)
Kant versucht, wie zuvor bereits erwähnt, bewusst eine Brücke zwischen Rationalismus und Empirismus und damit praktisch zwischen Realismus und Idealismus zu schlagen. Die sogenannten Dinge an sich selbst, wären seiner realistischen Seite zuzuschreiben – man könnte sie insgesamt als die “abso-lute“ Bedingung (oder Ur-Grund) der Möglichkeit jeglicher Erfahrung überhaupt benennen. Die “subjektiven“ Bedingungen der Möglichkeit jeglicher menschlichen Erfahrung (Verstandes-kategorien und Anschauungsformen) gingen sodann hingegen vollständig auf Kants idealistisches Konto.
Unglücklicherweise (unglücklich für den nach absoluter Wahrheit trachtenden Philosophen) gesellt sich, gemäß Kant, gerade zum “absoluten“ Status der Dinge an sich selbst letztlich empirische Elemente bedingt durch die erfahrungsabhängige Art der Informationsübertragung (→ S. 27). Was genau ist jedoch tatsächlich empirisch in jener Übertragung? – darüber kann man lange rätseln! Das Empirische ist bei Kant eingefasst zwischen einerseits absoluten Aspekten der Dinge an sich selbst und andererseits apriorischen, somit ebenfalls absoluten Aspekten der subjektiven Bedingungen der Erfahrung überhaupt – woher also nehmen, wenn nicht stehlen? Von den Sinnesorganen natürlich! – woher sonst? Das ginge nun leider auch nicht.
Denn Kant ist der Meinung dass unsere Sinne im Grunde nicht irren. (KrV B350) Aus taktischen Gründen stellen wir diesen speziellen “empirischen“ Umstand jedoch nochmals zurück.
Ungeachtet also der Frage worauf exakt sich das Empirische der Erfahrung gründet, hat Kant im Wesentlichen zwei grund-verschiedene Fundamente (Dinge an sich selbst und subjektive apriorische Erfahrungsbedingungen) auf denen er seine Erkenntnistheorie aufbaut, was nicht unbedingt ein Widerspruch sein müsste, wären, aus allgemeiner Sicht, relativ eindeutige, einfache Begriffe, wie beispielsweise Fundament, Grund, Ursache usw. bei Kant nicht in aller Regel bereits erheblich subjektiv vorgeprägt, die sich somit nicht direkt und problemlos (wenn überhaupt) auf den absoluten Bereich (auf den ja alle Erkenntnistheorie an und für sich hinstrebt) anwenden lassen. Spätestens im Zusammenhang mit der Kausalität und ver-wandter Ausdrücke wie Ursache, Wirkung, Grund, affizieren, herrühren usw. rächt es sich für Kant, dass er, obgleich besten Willens Idealismus und Realismus (und wohl auch Materialismus) verträglich zu verschmelzen, sich scheinbar nie ernsthaft fragt, ob eine solche Verschmelzung prinzipiell überhaupt möglich ist. Zumindest wirft dieser Themenbereich, den wir im Folgenden etwas näher betrachten werden, einige, hauptsächlich für trans-zendentale Idealisten, ergo für Anhänger der Erkenntnistheorie Kants, unbequeme Fragen auf.
“Die Einheit der Apperzeption aber ist der transzendentale Grund der notwendigen Gesetzmäßigkeit aller Erscheinungen in einer Erfahrung.“ (KrV A127 – steht auch im Original kursiv)
Gesetzmäßigkeit und der damit mehr oder weniger zwangsläufig verbundene Begriff der Kausalität sind bei Kant jedoch ohnehin äußerst heikle Aspekte:
“Denn was wird zur Naturnotwendigkeit erfordert? Nichts weiter als die Bestimmbarkeit jeder Begebenheit der Sinnenwelt, nach beständigen Gesetzen, mithin eine Beziehung auf Ursache in der Erscheinung, wobei das Ding an sich selbst, was zum Grunde liegt, und dessen Kausalität unbekannt bleibt.“ (Prol. 3. Teil, §53)
Kant will mit, “transzendentale [r] Grund“, und, “dessen Kausalität unbekannt bleibt“, sicher sagen, dass die Begriffe des Grundes und der Ursache im zitierten Falle nicht im allgemeinen Sinne mit der Kausalität zu verknüpfen sind, weil die Kausalität als solche lediglich eine subjektive menschliche Bedingung ist und somit keinen Bezug zu absoluten Aspekten jenseits des Subjektiven hat. Beinhaltet hingegen der erste Teil des letzten Zitates, “nach Gesetzen, mithin eine Beziehung auf Ursache in der Erscheinung“, nicht einen absoluten Bezug – exakt jenen absoluten Bezug, den der nachfolgende Teil scheinbar nicht wahrhaben will?
Mit dem soeben gefallenen Stichwort “Kausalität“ verbindet sich für Kant besonders in diesem Zusammenhang ein zusätz-liches Problem, da er den Begriff der Freiheit als zusätzliche Kausalitätsvariante, neben der natürlich gegebenen, ins Auge fasst:
“Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zu Erklärung derselben anzunehmen notwendig.“ (KrV A444/B472, siehe auch KrV
A632/B660, A538-9/B566-7)
Kant stellt für diese “Thesis“ gar einen seitenlangen sogenannten Beweis auf, was ihn allerdings nicht davon abhält sogleich dazu eine Antithesis zu setzen (“Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur.“ KrV A445/B473) die er sodann mit derselben Ent-schiedenheit zu beweisen verspricht, wie das krasse Gegenteil: die ursprüngliche Thesis. Kant führt solche Widersprüche auf einen sogenannten “Widerstreit der Gesetze (Antimonie) der reinen Vernunft“ zurück (KrV B434). Den Beweis einer Thesis, den er mit dem Beweis einer Gegenthesis, und also auch seine eigene Beweisführung, wieder in Frage stellt, ist indes ein extrem eigenwilliges Kunstwerk menschlicher Vernunft. Eine Thesis mag eine Antithesis haben, sind beide jedoch scheinbar erwiesen, so ist logischerweise mindestens einer von beiden Beweisen falsch – da hilft dann auch alle nachträgliche Flickschusterei nichts.
In ähnlich fragwürdiger Weise verfährt Kant u. a. mit dem Begriff des Grundes und mit dem Verb “affizieren“ (in vergleichbaren Zusammenhängen) wie wir bereits teilweise feststellen konnten. In der Form, wie Kant jenen Begriff bzw. jenes Verb benutzt beinhalten Letztere oft, wenn nicht aus-schließlich, bereits einen weiteren Begriff, nämlich den der Kausalität – akkurat jene Kausalität, die sich als subjektive Bedingung unseres menschlichen Denkens (Kategorie der Kausalität) gemäß Kant auf absolute Aspekte definitiv verbietet:
“[...] die Kategorien sind daher am Ende von keinem andern, als einem möglichen empirischen Gebrauche [...].“ (KrV A146/
B185, ähnlich äußert sich Kant z. B. KrV B146-7, A139/B178, A696/B724)
Dennoch schwingt ständig, und gerade auch bei empirischen Aspekten, bei Kant der Begriff der (absoluten) Kausalität hintergründig mit, auch wenn der Königsberger äußerst bemüht ist dies so gut als irgend möglich zu verbergen:
“Denn die Welt ist eine Summe von Erscheinungen, es muß also irgend ein transzendentaler, d. i. bloß dem reinen Verstand denkbarer Grund derselben sein.“ (KrV A696/B724, im Zusammenhang mit der Theologie)
“Das transzendentale Objekt, welches den äußeren Erscheinungen, imgleichen das, was der innern Anschauung zum Grunde liegt, ist weder Materie, noch ein denkend Wesen an sich selbst, sondern ein uns unbekannter Grund der Erscheinungen [...].“
(KrV A379-0 – steht auch im Original kursiv, siehe auch Prol. § 49, § 53, ferner § 13)
Besonders der soeben zitierte Ausdruck: “Grund der Erscheinungen“ zielt eindeutig über das Empirische hinaus, und bezieht sich auf exakt jene Dimension, zu der jegliche Anwendung der Verstandeskategorien, nach Kant, eigentlich prinzipiell unmöglich sein sollte (KrV A146/B185). Davon abgesehen, ganz so unbekannt ist in dem letzten Zitat der Ausdruck: “unbekannter Grund“ wohl doch nicht, denn der vorhergehende Term: “transzendentales Objekt“ auf den sich jener Ausdruck bezieht, birgt bereits eine gewisse Information im positiven Sinne.
“Ob nun aber gleich diese Verstandesregeln nicht allein a priori wahr sind, sondern so gar der Quell aller Wahrheit, d. i. der Übereinstimmung unserer Erkenntnis mit Objekten, dadurch, daß sie den Grund der Möglichkeit der Erfahrung [...] in sich enthalten [...].“
(KrV A237)
“Man sieht Dinge sich verändern, entstehen und vergehen; sie müssen also, oder wenigstens ihr Zustand, eine Ursache haben.“
(KrV A589/B617)
Eine offenbar selbstverständliche Feststellung die Kant uns da liefert. Indes so selbstverständlich ist dies in unserem unmittelbaren Zusam-menhang keineswegs, denn erstens existieren für Kant mindestens zwei verschiedene Arten der Kausalität, eine aus Gesetzen der Natur und eine durch Freiheit (siehe z. B: KrV A444/B472, A532/B560, A803/B831) und zweitens untersteht die Gesetzlichkeit der Natur der subjektiven höherstehenden Gesetzmäßigkeit des Verstandes:
“Da nun von der Synthesis der Apprehension alle mögliche Wahrnehmung, sie selbst aber, diese empirische Synthesis, von der transzendentalen, mithin den Kategorien abhängt, so müssen alle mögliche Wahrnehmungen, mithin auch alles, was zum empirischen Bewußtsein immer gelangen kann, d. i. alle Erscheinungen der Natur, ihrer Verbindung nach, unter den Kategorien stehen, von welcher die Natur (bloß als Natur überhaupt betrachtet), als dem ursprünglichen Grunde ihrer notwendigen Gesetzmäßigkeit [...] abhängt.“ (KrV B164-5 – im Original auch kursiv – siehe zudem KrV A127-8, B159, Prol. §36)
Kant ist sich sicher, dass wir keinen Bezug zur absoluten Realität ha-ben können, weil wir die Welt lediglich indirekt mittels unserer subjek-tiven Gegebenheiten verschiedenster Art erleben können. Dabei stellt sich allerdings die Frage, mit welchem logischen Recht Kant überhaupt diesbezügliche Spekulation unternehmen kann, da er (wie nach seiner eigenen Theorie, wir alle) in dieser speziellen Frage erheblich vorbe-laste t ist – vorbelastet u. a. durch die subjektive Verstandeskategorie der Kausalität, die wir nicht abschütteln können, sondern mittels der wir jegliche Vorstellung notwendigerweise betrachten müssen:
“Wir können uns keinen Gegenstand denken, ohne durch Kategorien [...].“ (KrV B165 – auch im Original in kursiv)
“Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (KrV A51/B75)
W. Röd nimmt zur Kausalität deutlich Stellung:
“Wenn man Reize annimmt, die von Dingen an sich ausgehen, betrachtet man diese als Ursachen, was nach Kant ausgeschlossen ist, da die Kausalität, wie alle Kategorien, nicht auf Dinge an sich angewandt werden kann.“ (W. Röd, 2000, Seite 214)
Völlig klar! – wirklich? Nun, Kant kann unmöglich eine sol-che Haltung konsequent durchziehen, wie folgendes Zitat (nebst → S. 95-8) zeigt:
“Das Verhältnis von D. a. s. und Erscheinung wird bei I. Kant mitunter nicht nur als ein logisches, sondern auch als ein kausales Verhältnis bez.; denn das D.a.s. ist die reale Ursache der Empfindung, es >>affiziert<< die [.] Sinnlichkeit (KrV, A 358; Proleg . § 32, § 36); das D.a.s. ist also nicht nur Begriff, sondern >>wirklicher Gegenstand<< ( Proleg . § 13 Anm. II).“ (Wörterbuch
der philosophischen Begriffe, Meiner, 2005, S. 153)
Dermaßen krasse Widersprüche beweisen, dass Kant in der Tat ständig zwischen Realem, Materiellem und Ideellem (→ S. 98, oben) bzw. subjektiver Allmacht und Ohnmacht des Verstandes (→ S. 85, 167) in entsprechendem Zickzackkurs (→ S. 55) hin u. her schwankt – auch wenn er lokal mit gewissen Details täuschend auftrumpft, z. B:
“Die Zeit ist also lediglich eine subjektive Bedingung unserer (menschlichen) Anschauung, (welche jederzeit sinnlich ist, d. i. so fern wir von Gegenständen affiziert werden,) und an sich, außer dem Sub-jekte, nichts.“ (KrV A35) (Hier spricht Kant u. a.wieder von “Gegen ständen“ ohne dass ersichtlich ist, was er damit konkret meint, was wir schon auf Seite 31 bemängelt haben.)
Das Wort “affizieren“ hat die Bedeutung: reizen, angreifen (Quelle: Die aktuelle Deutsche Rechtschreibung, Naumann & Göbel, ISBN 3-625-10442-3) Gemäß einer anderen Quelle bedeutet affizieren gar: “krankhaft verändern“. (Die neue deutsche Recht-
schreibung, Tandem Verlag, ISBN 3-931923-28-2)
Eine ausführlichere Betrachtung findet sich z. B. bei Hans Vaihinger, Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft (2. Auflage 1922, Scientia Verlag, 1970, Seite 175 gemeinsam mit den Begriffen: “rühren“ und “Reiz“).
Streng verlassen kann man sich auf jene Definitionen nicht. Sprache, und damit das allgemeine Sprachverständnis, unterste-hen grundsätzlich dem Wandel der Zeit. Wir bräuchten also einen Duden aus der Zeit Kants und möglichst einen preußischen, denn selbst beim heutigen Stand unterscheidet sich der Sprachge-brauch einzelner Wörter und Redewendungen abhängig von der geographischen Lage, oder des sozialen bzw. beruflichen Niveaus auch innerhalb eines offiziell einheitlichen Sprachraumes zu-weilen ganz erheblich. Zudem haben bestimmte Wörter verschie-dene Bedeutungen, abhängig vom jeweiligen Zusammenhang, was sich z. B. besonders in der Fachliteratur gegenüber allge-meiner Literatur zeigt. Erschwerend kommt diesbezüglich hinzu, dass Kant gelegentlich bestimmte Wörter (z. B. Wahrheit, Objektivität bzw. objektive Realität) in sehr eigenwilliger Manier handhabt – unglücklicherweise handelt es sich dabei durchweg um Begriffe von ausschlaggebender Bedeutung.
“Das Mannigfaltige der Vorstellungen kann in einer Anschauung gegeben werden, die bloß sinnlich d. i. nichts als Empfänglichkeit ist, und die Form dieser Anschauung kann a priori in unserem Vorstel-lungsvermögen liegen, ohne doch etwas andres, als die Art zu sein, wie das Subjekt affiziert wird.“ (KrV B129 – auch im Original kursiv)
Hier gibt Kant offenbar freiwillig einen nicht unwesentlichen Teil seines an anderen Stellen eifrig beanspruchten Terrains auf. Dieses letzte Zitat scheint zumindest anzudeuten, dass hinter den apriorischen subjektiven Bedingungen eventuell doch höhere Dinge der absoluten Realität stehen, während Kant an anderen Stellen (z. B. KrV A126-8, B161-4) durchweg für das krasse Gegenteil plädiert, nämlich, dass die subjektiven apriorischen Bedingungen der Möglichkeit aller menschlicher Erfahrung in diesem Blickfeld die höchsten Kriterien liefern, was absolut objektiven Zugriff ausschließt. Kant unterstellt dem Verstand absolute Herrschaft (→ S. 86) das macht ihm Erfahrung möglich.
Unmöglich wird dadurch aber Zugriff zu absoluter Objektivität. Kant strebt mit seiner Erkenntnistheorie weniger nach ultimativer als vielmehr nach praktischer Wahrheit (→ u. a. S. 56) ein beschei-dener Mensch der Königsberger, zumindest in diesem Punkt. (Freilich, einen gewissen Bezug – wie vage auch immer – zum Absoluten braucht Kant letztlich doch, den hat er ja auch mit den Dingen a. s. s. → S. 95ff .)
Im folgenden Zitat spricht Kant von “nichtsinnlichen Ursachen“, ohne dass er sie allerdings eindeutig entweder innerlich einem Subjekt oder einer äußeren unabhängigen Realität zuordnet.
“Das sinnliche Anschauungsvermögen ist eigentlich nur eine Rezep-tivität, auf gewisse Weise mit Vorstellungen affiziert zu werden, deren Verhältnis zu einander eine reine Anschauung des Raumes und der Zeit ist [...] und welche, so fern sie in diesem Verhältnisse (dem Raum und der Zeit) nach Gesetzen der Einheit der Erfahrung verknüpft und bestimmbar sind, Gegenstände heißen. Die nichtsinnliche Ursache dieser Vorstellungen ist uns gänzlich unbekannt, und diese können wir daher nicht als Objekt anschauen [...].“ (KrVA494/B522)
(Die “Gegenstände” die Kant hier nennt sind offensichtlich nicht die Gegenstände die uns affizieren von denen Kant in KrV BXVI und B34 spricht, siehe dazu Anmerkungen Seite 31 und 41 – es sind hingegen die Endprodukte die uns innerlich konkret vor Augen stehen – die wir bewusst erfahren.)
Ein kurzer Dialog dazu:
Es wäre logisch, die Ursache als Spiegelbild eines jeweiligen Ergebnisses zu sehen. Kant hat aber für die Ursache eine Kategorie – warum nicht gleich eine für das Ergebnis? Nun, die hat er ja, das ist eben die Kategorie der Ursache – die ist für das Ergebnis! Ist das wirklich so? Hat er nicht vielmehr die Kategorie der Ursache, weil sie eben keine tatsächliche Ursache ist, sondern gewissermaßen als Ersatz-Ursache, die Ursache stützt, die keine ist. Warum sollte sie das tun? Damit das Ergebnis endlich eine Ursache hat! Ach so, natürlich!
S. Gardner liefert uns rund um jene Thematik (des Grundes, der Kausalität, des “Affiziert-Seins “) einige sehr interessante, obgleich letztlich nicht ganz unproblematische Gedankengänge:
“[...] Kant may seem to be basing the existence of things in themselves on a causal inference – from the existence of appearances as effects, to that of things in themselves as their causes (see A494/B522, A496/B524, A695-6/B723-4 and Proleg 314-15). This cannot be right either, however, since the assumption that appearances are effects of anything at all presupposes exactly what needs to be established. Furthermore, Kant has argued that deployment of the causal principle outside the sphere of experience is illegitimate. [S. 284] ” Knapp vier Seiten weiter heißt es:
“Sensation – that in us which provides for the being of appearances; what sensible and conceptual form applies to – must be conceived as having some ground, however indeterminately conceived . For to conceive sensation without reference to any ground – to suppose that the question of ground cannot arise for the matter of empirical objects – is to elevate it to self-sufficient being, and thus to accord it reality in itself. Kant's entire transcendental story would then make no sense.[S. 287] ”
Damit hat S. Gardner durchaus recht, zumindest was den empirischen Bereich betrifft. Das wirft jedoch sofort die Frage auf: Bezieht er sich, besonders mit dem Begriff des Grundes, nicht – ganz wie auch Kant an vergleichbarer Stelle – über den Bereich der Erfahrung hinaus und das, obwohl er selbst noch kurz zuvor darauf aufmerksam macht, dass der Bezug des Kausalprinzips außerhalb der Erfahrung “illegitimate“ sei? Birgt der Begriff des Grundes nicht bereits eine solche Kausalität in sich selbst? Anders formuliert, ist die Verwendung des Begriffs des Grundes nicht grundsätzlich abwegig, wenn man ihn nicht als Boden eines kausalen Verhältnisses ansieht?
“To deny that sensation is an effect of things transcendentally outside us therefore leaves, by elimination, no alternative to saying that its ground is transcendentally inside us, i. e. that it is brought into existence by the subject. But to say that sensation is an effect of our transcendental subjectivity is to conceive our subjectivity as spontaneous throughout, which is indistinguishable from conceiving human subjects as non-finite, God-like creators of themselves and all their objects, again with the upshot that empirical objects become things in themselves. The Copernican revolution – accounting for objects as appearances rather than things in themselves – thus requires the data out of which our objects are constituted to be grounded on something transcendentally 'other'. On this account the supposition that sensation is the effect of things in themselves is necessary for Kant's fundamental analysis of cognition, [...]. [S. 287-8] ” (Sebastian Gardner, Kant and
the Critique of Pure Reason, Routledge, 1999, die Seiten 284, 287-8)
Englisch ist eine flotte Sprache. Zumindest das Englisch der Engländer hat klanglich seinen Reiz, wie auch das amerikanische Englisch (im krassen Gegensatz z. B. zum Affrika-Englisch). Um Englisch gut (d. h. wohlklingend) sprechen zu können muss man modern denken können und das können die Eng-länder absolut trotz ihrer Liebe zur Tradition – die US-Amerikaner ohnehin, das kann man in Ländern der Dritten Welt durchweg weit weniger gut, und deshalb wird dort auch fast ausnahmslos ein direkt peinlich-unschönes Englisch gesprochen.
“Englisch ist eine arme Sprache, [...]“ (A. Surminski, Am dunklen Ende des Regenbogens, S. 115) Nun, das kann man so oder so sehen. Englisch ist in man-cher Hinsicht wesentlich bescheidener als Französisch oder Deutsch, dadurch ist es jedoch nicht unbedingt einfacher. Vor allem aber ist Englisch verhältnismäßig unpräzise. Es lässt viele Aspekte völlig offen die im Deutschen oder im Franzö-sischen geregelt sind – das täuscht Einfachheit vor. Im Englischen kann man sich beispielsweise rein aus dem geschriebenen Text nicht auf die Aussprache dieses Textes verlassen, man muss zu jedem Wort auch zusätzlich die jeweilige Akustik lernen. Es ist aber falsch Englisch als primitive Sprache zu werten, nur weil sich dessen Reichtum weniger als in vergleichbaren Sprachen in feste Regeln kleidet. Englisch ist eine praktische Sprache, voller Slang, voller mehrdeutiger Ausdrücke, voller Wortkombinationen deren Sinn vielfach nur im unmittelbaren praktischen Zusammenhang verstanden werden kann. Ein wenig Englisch zu lernen ist leicht – es wirklich gut zu beherrschen ist hingegen sehr schwer, weil jene Sprache rein aus der Theorie nicht wirklich zu erfassen ist, was letztlich einen enormen praktischen Aufwand erfordert. Englisch ist weltweit die führende Sprache, vor allem im wissenschaftlich-technischen Bereich und das ist nicht gerade logisch. Denn in der Wissenschaft, hauptsäch-lich freilich in der Philosophie, kommt es auf hieb- und stichfeste präzise Formulierungen an, die allgemein, d. h. theoretisch, verstanden werden können und weniger den direkten praktischen individuellen Blick benötigen. Englisch ist dazu aus besagten Gründen nicht sonderlich geeignet.
In S. Gardners zitiertem Text kommt mir einiges spanisch vor, obgleich es englisch ist. (Allerdings kommt mir Kants System ohnehin spanisch vor.) Was mir grundsätzlich nicht gefällt ist das Tempo. D. h. Mr. Gardner (als vermutlich in diesem Sinne durchaus typisches Beispiel des englischen Sprachraumes) überfliegt hier in forschem Stil relativ locker eine ganze Reihe vager Aspekte mit einem Streich, die er zu ganz bestimmten sehr weitreichenden Aussagen verknüpft – alles mit einer unverkennbaren Lässigkeit, wenn nicht Ober-flächlichkeit, die wir uns hier ganz einfach nicht erlauben können. (S. Gardner beabsichtigt in seinem zitierten Buch vorneweg allerdings weniger Kant zu kritisieren, als vielmehr ihn zu erklären, bzw. vorzustellen. Schon allein deshalb kann er praktisch nur soweit kritisieren, als er mit seiner Kritik seine Erklärungen zu Kant nicht selbst infrage stellt – ein sehr schwieriger, beinahe unmöglicher Balanceakt.)
Überdies macht S. Gardner zu Kant – zumindest meinem persönlichen Eindruck gemäß (und ich habe die Siegener Universitäts-bibliothek knapp zwei Jahre entsprechend ganz ordentlich durchgesehen, etwa 200 Bücher speziell zu Kant dürften mir mittlerweile bekannt sein – immer noch ein Nichts zu der Masse die zu Immanuel auf dem Markt ist, zugegeben!) relativ eindeutige Bemerkungen, während deutsche Autoren, die sich im Wesentlichen sicher auf die deutschen Originaltexte Kants beziehen durchweg zu vorsichtigeren Äußerungen neigen.
Vielleicht sind wir Deutsche grundsätzlich vorsichtiger als beispielsweise die Engländer, womöglich spielt da aber auch ein gewisser Beschönigungseffekt eine Rolle: jeder Übersetzer, das weiß ich aus eigener Erfahrung, neigt dazu seinem zu übersetzenden Text eine möglichst attraktive Form zu geben. Vornehmlich im Zweifelsfalle – und welche Übersetzung kennt keine solche? – wird ein Übersetzer stets den attraktivsten ihm zur Verfügung stehenden Ausdruck wählen, und damit eventuell das jeweilige Original an Schönheit und Klarheit prinzipiell übertreffen, womit sodann allerdings eine kaum zu vermeidende, wenn auch zunächst nicht unbedingt sonderlich auffällige, Sinnverfälschung stattfindet.
S. Gardner benutzt z. B. in seinem kurz zuvor zitierten Werk häufig den Ausdruck “affected“ für Kants “affizieren“ (wobei er sich vermutlich auf Norman Kemp Smiths Übersetzung der Kritik Kants beruft).
Wie wir zuvor erwähnt haben bedeutet affizieren: reizen, angreifen, und eventuell gar: krankhaft verändern. “Affected“ von “affect“ bedeutet hingegen “to have an influence on“ (Quelle: Cambridge International Dictionary of English, Cambridge University Press 1995) – heißt auf Deutsch so viel wie “auf etwas Einfluss haben“.
Kants Kritik d. r. Vernunft betreffend, stellt eine Interpretation des Wortes “affizieren“ im Sinne von “Einfluss ausüben“ durchweg einen extrem kühnen Vorstoß dar, denn Kant macht ja eben, weil er dieses relativ ungebräuchliche (und nicht zuletzt schon deshalb verhältnismäßig unbestimmte) Wort gebraucht deutlich, dass er in diesem Punkt absolut nicht an eine direkte Einflussnahme denkt. Gerade jene vermeintliche “Einfluss-nahme“ steht bei Kant (deutscher Originaltext) zur Diskussion, während die jeweilige englische Übersetzung (N. Kemp Smith) durch unzweckmäßige Wortwahl an extrem sensibler Stelle, eine solche Diskussion, bewusst oder unbewusst, bereits als beschlossene Sache vorwegnimmt.
Zugegebenermaßen muss man hier allerdings anmerken, dass im philosophischen Bereich heutzutage affizieren durchweg als “erregen“, “bewirken“ oder “antun“ verstanden wird (siehe beispielsweise: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Felix Meiner Verlag, 2005, Seite 17).
Möglicherweise geht dies allerdings im Wesentlichen auf die typische Art wie Kant diesen Ausdruck verwendet zurück. Vermutlich wird in diesem Zusammenhang allgemein Kant mehr in den Mund gelegt, als er tatsächlich sagte, bzw. sagen wollte.
Wenn Kant “erregen“ meint warum spricht er es dann nicht offen aus? “Weil er den Ausdruck ’affizieren’ als ebenbürtig betrachtet“, könnte man hier einwenden. In diesem Falle würde er jedoch, zumindest gelegentlich – schon aus stilistischen Gründen – auf einen alternativen Ausdruck zurückgreifen, als stattdessen durchgängig von A bis Z stur sich stets eines ganz bestimmten Wortes zu bedienen (für das grundsätzlich mehrere Alternativen zur Verfügung stünden) und jenes Wort kommt in der KrV immer wieder vor.
Es ist auch unwahrscheinlich, dass Kant, als echter Philo-soph, sich bewusst wissenschaftlicher ausdrückt als nötig, etwa im Stil eines an Minderwertigkeitskomplexen leidenden Möch-tegern-Profis.
Kant gibt sich in der KrV nicht als Poet, zugegeben. In Anbetracht der Komplexität seines erkenntnistheoretischen Systems hat er allerdings praktisch keine andere Wahl. Kant vertritt seinen Transzendentalen Idealismus meisterhaft – in absoluter Weltklasse-Manier – das muss man auch als Kritiker anerkennen. Das heißt allerdings nicht, dass ihm dabei keine Fehler unterlaufen dürfen, ganz im Gegenteil, denn jenes System läuft ohne eklatante Fehler überhaupt erst gar nicht an – ein eher negatives Lob demnach.
(“Weltklasse-Manier“ bedeutet in diesem Sinne nicht absolute Perfektion, als vielmehr ein konsequenter Gebrauch fehlerhafter Aspekte. Das Tückische dabei ist, dass ein hochgradig systematischer Gebrauch an und für sich fehlerhafter Aspekte dem Ganzen den Schein von Wahrheit und Perfektion geben kann – ich denke das trifft bei Kant exakt zu. Jeder Idiot kann ein Führer oder ein Idol sein, vorausgesetzt er glaubt an seine Fehler und kann begeistern – voraus-gesetzt seine Idiotie hat System oder zumindest Kontinuität, die seine Beschränktheit gegenüber der willigen, generell leicht verführbaren Masse verdeckt. Relativ sachliche Menschen, hochintelligente Akademiker, Philoso-phen sind hingegen oft eher schwache Führerpersönlichkeiten, denn deren Wahrheit als Ideal ernüchtert eine zu führende Gruppe, oder ein ganzes Volk, eher als dass sie jene beflügelt. Daraus ergibt sich ein gewisses Paradox: Jede kulturelle Entwicklung bricht früher oder später zusammen, weil entsprechende Fehler die zunächst als nötiger Anreiz für eine solche Entwicklung dienen sich letztlich nur im relativ unterentwickelten Stadium halten lassen. Eine fehlerlose Entwicklung würde kaum ähnlich zusammenbrechen – ihr nicht ganz bescheidener Nachteil wäre allerdings, dass sie erst gar nicht starten kann, weil ihr dazu ganz einfach der nötige Anreiz fehlt, siehe dazu auch S. 319, 394 [Original].)
August Brunner, → S. 15, hält Kant (wie viele, viele andere) für ein (Giga-) Genie – da wären wir allerdings weit vorsichtiger. Kant zeigt mit seinem umfang-reichen System außerordentlichen Fleiß, aber gerade dieser Umstand spricht gegen Genialität. Ein Genie neigt zur Kürze, Immanuel eher zur Weitschweifigkeit. Ein Genie neigt zudem zur Faulheit – nicht unbedingt aus purer Faulheit. An sich begnadete Talente, die wider ihr Natur-Talent fleißig sind, verzetteln sich früher oder später unwillkürlich in stereotypische Kleinigkeiten und erziehen sich selbst somit zur Engstirnigkeit. Gänzlich ohne Fleiß und Wissen verkümmert hingegen jegliches Talent (→ Bezug u. a. auch zu den Seiten 294-6 [Original]).
Als relativ kritischer Leser drängt sich einem leicht der Verdacht auf, dass Kant sich gelegentlich bewusst in langatmige schwer verständliche Formulierungen rettet, um die Unmöglichkeit seines Unternehmens insgesamt zu verschleiern. Eine Theorie hat in aller Regel umso eher Bestand, je einfacher und einleuchtender sie ist. Alle gültigen Regeln der Mathematik sind beispielsweise prinzipiell sehr eindeutig und damit einleuchtend, man versteht sie oder man versteht sie eben nicht, ohne Mittelweg. Kants Erkenntnistheorie bewegt sich sinngemäß hingegen vorzugsweise in der “logisch unzulässigen Mitte“ – sie wird selbst von Kantianern (keine Indianer, nein, nein!) kaum jemals hundertprozentig übernommen, von den Gegnern Kants hingegen kaum jemals hundertprozentig abgelehnt – ein ziemlich verdächtiger Fakt.
Die allgemeine Schwerverständlichkeit der Erkenntnistheorie Kants ist kein untrügliches -, sicherlich jedoch kein völlig zu vernachlässigendes Indiz für die eventuelle Unrichtigkeit jener Theorie an sich.
Generell darf man vielleicht sagen, dass Menschen, die irgendeine persönliche Schwäche, Unsicherheit, Makel oder offene Fehler übertünchen möchten, sich gerne zu äußerer Förmlichkeit – übertriebener Sauberkeit, usw. – halten und sich in der Rolle des Fachmanns gerne weit wissenschaftlicher geben, als dies ein wissenschaftlicher Aspekt an sich tatsächlich fordert.
Nun, ich denke, dass Kant speziell das Verb “affizieren“ aus Verlegenheit wählt. Diese Verlegenheit besteht möglicherweise darin, dass Kant die “kausale Kraft“ alternativer Ausdrücke (erregen, bewirken, antun) scheut – aus gutem Grund – andernfalls gibt er deutlicher als eigentlich nötig seinen Kurs der Widersprüchlichkeit Preis. Die apriorische Verstandeskategorie der Kausalität als subjektive menschliche Gegebenheit ist ihm bezüglich seiner Erkenntnistheorie ein sehr schmerzhafter Dorn im Auge, da sie den dringend benötigten bzw. vorneweg sicher zumindest heimlich erhofften Weg zur absoluten Objektivität bzw. zur absoluten Realität, oder sagen wir zur ultimativen Wahrheit, zu verbauen scheint. Vor allem verbietet sich “affizieren“ in der Bedeutung von “bewirken“, “erregen“ oder “antun“ mit unmittel-barem Blick zu den absoluten Dingen an sich selbst, weil damit die von Kant grundsätzlich unterstellte “subjektive“ Kausalität in unzulässiger Weise zur “absoluten“ Kausalität erhoben wird (wie W. Röd mit eigenen Worten bereits auf Seite 41 für uns vermeldet hat).
Man sollte mit pauschalen Urteilen möglichst sparsam umge-hen – sie sind immer irgendwo ungerechtfertigt (auf sie völlig zu verzichten wäre allerdings oft nicht minder ungerecht-fertigt!). Horst Lange, vermutlich ein Deutscher, drückt sich jedenfalls entgegen unserer obigen pauschalen Behauptung (bezüglich verhältnismäßig zurückhaltender deutscher Stel-lungnahmen im aktuellen Zusammenhang, S. 46, oben) nicht unbedingt bescheiden aus:
“[...] die Vorstellungen, die wir von einem Erfahrungsgegenstand haben, sollen uns mittels Affektion durch ein Ding an sich gegeben werden (B 33). Affektion ist nun ohne Zweifel ein kausaler Vorgang. Der Begriff der Kausalität aber soll, wie Kant zeigt, nur auf Erscheinungen, nicht jedoch auf Dinge an sich anwendbar sein (B 146f.). Also kann ein Ding an sich ein Erfahrungssubjekt nicht affizieren. Fazit des hier angedeuteten Jacobi-Einwands [.] : Kants Theorie muß sich, will sie solche Paradoxien vermeiden, ohne den Begriff des Dings an sich rekonstruieren lassen.“
(Horst Lange, Kants modus ponens, Verlag Königshausen, 1988, Seite 15/16)
Dem fügt Horst Lange, Seite 61, gleiches Werk, hinzu:
“Kant nimmt an, daß alles empirische Wissen über einen Gegenstand dem Subjekt durch Empfindung vermittelt worden ist. Zu dieser These konnte er wohl nur dadurch gelangen, daß er eine Affektionstheorie der Wahrnehmung überschätzte, die eben suggeriert, daß alle Informationen, die ein Subjekt über den Erfahrungsgegen-stand erhält, durch kausale Einwirkung des Gegenstandes dem Subjekt übermittelt wird.“
Ob Kant so ohneweiters auf den Begriff des Dings an sich (selbst) verzichten könnte ist grundsätzlich ziemlich zweifelhaft – Sebastian Gardner ist (wie wir, → u. a. S. 49, 56, 208) der Meinung, dass er für Kant “necessary“ sei (→ S. 44). (In diesem speziellen Punkt scheinen hingegen die fachlichen Meinungen allgemein deutlich auseinander zu gehen, wie wir auf den Seiten 147-52 noch sehen werden.) Wie dem auch sei, Horst Lange macht jedenfalls ohne viel Federlesen kurzen Prozess mit der sogenannten Affektion – was allerdings wäre die Alternative?
Ich vermute ohnehin, dass Kant eher aus Verlegenheit, denn mit Überzeugung, diesen allgemein kaum gebräuchlichen Begriff des “affizierens“ wählt (→ S. 47-8). Es wäre daher besonders aus dieser Perspektive Kant gegenüber nicht fair, an jener Stelle päpstlicher als der Papst zu sein. Zudem sollte man bei allem verständlichen Eifer für eigene Interpretations-vorschläge die Ausgangslage Kants nicht völlig aus den Augen verlieren. Ohne jegliche Referenz zu “Dingen an sich selbst“, beispielsweise, hätte Kant kaum eine Chance sein insgesamt höchst aufwendiges Programm überhaupt erst anzufahren. Kant überschätzt meiner Meinung nach nicht die Affektion (wie im letzten Zitat erwogen wurde) – ganz im Gegenteil, er unterschätzt sie. Er überdeutet allerdings ganz erheblich den Begriff der Bedingung – wie wir bald sehen werden.
Kant weist wiederholt darauf hin, wie (soeben Horst Lange und zuvor) Sebastian Gardner und Wolfgang Röd mit verhaltenem Recht behaupten, dass unser Verstand sich lediglich auf empirische Aspekte beziehen kann (z. B. KrV A238/B297-8, A246/B303) ohne allerdings zu bemerken, dass exakt jener Grundsatz bereits eine Verletzung seiner selbst darstellt. Die Definition jenes Grundsatzes beinhaltet bereits eine Überschreitung ihrer eigenen Aussage, denn sie bezieht sich eindeutig auf nicht-empirische Aspekte, wenn auch lediglich im negativen Terrain. Ebenso fragwürdig ist Kants Art und Weise wie er die Begriffe “Grund, affizieren, herrühren“ gebraucht. Auch hier wagt er sich sehr mutig an bzw. über seine selbst gezogene Grenze hinaus, wenn auch, wie erwähnt, vorzugsweise im negativen Gebiet.
Ist Kant mit jenem Grundsatz im Koffer, überhaupt zu irgendwelchen apriorischen Herleitungen berechtigt? Und der Begriff “a priori“ ist für Kant von ausschlaggebender Bedeu-tung (siehe dazu u. a. Seite 24, 331, ferner S. 17) mit dem er direkt (menschliche) Wahrheit und Objektivität verknüpft, ohne die sein Transzendentaler Idealismus völlig zusammenbrechen würde. Kant könnte sich in dieser Frage auf die menschliche Vernunft beziehen, z. B:
“Die Vernunft wird durch einen Hang ihrer Natur getrieben, über den Erfahrungsgebrauch hinaus zu gehen [...]“ (KrV A797/B825)
Dem steht allerdings gegenüber:
“Der größte und vielleicht einzige Nutzen aller Philosophie der reinen Vernunft ist also wohl nur negativ; da sie nämlich nicht, als Organon, zur Erweiterung, sondern, als Disziplin, zur Grenzbestimmung dient, und, anstatt Wahrheit zu entdecken, nur das stille Verdienst hat, Irrtümer zu verhüten.“ (KrV A795/B823)
Die zitierte Formulierung Kants, “einzige Nutzen aller Philosophie der reinen Vernunft“, ist hier etwas irreführend, denn aus dem weiteren Zusammenhang ist ersichtlich, dass nicht die Vernunft als philoso-phische Disziplin, sondern als menschliche Eigenschaft gemeint ist.)
Davon abgesehen könnte man sich natürlich auch fragen, inwiefern Kant Recht hat, dass der Verstand, z. B. hinsichtlich der Kausalität sich nicht auf Dinge jenseits der Erfahrung beziehen kann. Anders formuliert, warum sollte Kausalität nur “vorwärts“ und nicht auch “rückwärts“ bzw. “jenseits“ ihrer menschlichen Existenz gelten? Das würde natürlich bedeuten, dass die Kausalität unabhängig ihrer menschlichen Existenz objektive Realität hätte im absoluten Revier. Immerhin kann man im empirischen Leben durchaus Dinge erfahren die verhältnismäßig weit, oder sehr weit, von dem tatsächlichen Auftreten der eigenen Existenz zurückliegen. Solche Erfah-rungen aus zweiter Hand mögen an sich als empirisch gelten, dennoch werden die Mittel dazu, mit Kant, durch subjektive Bedingungen a priori gegeben. Zudem muss eine gewisse Kompatibilität zwischen einem fühlenden und denkenden Individuum einerseits und dessen unmittelbarer tatsächlichen Realität andererseits notwendigerweise bestehen, andernfalls ist weder irgendein praktischer noch theoretischer Bezug, noch der leiseste Hinweis in irgendeiner Form, des einen zum anderen möglich. Diese notwendige Kompatibilität setzt eine gemeinsa-me Basis voraus.
Kant fasst den wesentlichen Komplex unserer aktuellen Diskussion folgendermaßen zusammen:
“Schon von den ältesten Zeiten der Philosophie her, haben sich Forscher der reinen Vernunft, außer den Sinnenwesen oder Erscheinungen, (phaenomena) die die Sinnenwelt ausmachen, noch besondere Verstandeswesen, (noumena) welche eine Verstandeswelt ausmachen sollten, gedacht, und da sie (welches einem noch unausgebildeten Zeitalter wohl zu verzeihen war) Erscheinungen und Schein vor einerlei hielten, den Verstandeswesen allein Wirklichkeit zugestanden [womit Kant u. a. sicherlich auf Platos Ideenwelt anspielt, von der er prinzipiell sehr weit entfernt ist]. In der Tat, wenn wir die Gegenstände der Sinne, wie billig, als bloße Erscheinungen ansehen, so gestehen wir hierdurch doch zugleich, daß ihnen ein Ding an sich selbst zum Grunde liege [ja!] , ob wir dasselbe gleich nicht, wie es an sich beschaffen sei, sondern nur seine Erscheinung, d. i. die Art, wie unsre Sinnen von diesem unbekannten Etwas affiziert werden, kennen. [Das ist kategorischer Unfug! Gefühl und Verstand schließen sich einander eher aus als dass sie sich direkt ergänzen. Die Art wie etwas zustande kommt ist völlig irrelevant zur Frage wie dieses etwas empfunden wird. Um Autofahren geniesen zu können braucht man nicht zu verstehen wie das jeweilige Auto technisch funktioniert oder wie überhaupt dieses “geniesen können“ zustande kommt (→ S. 168, 294-6).] Der Verstand also, eben dadurch, daß er Erscheinungen annimmt, gesteht auch das Dasein von Dingen an sich selbst zu, und sofern können wir sagen, daß die Vorstellung solcher Wesen, die den Erscheinungen zum Grunde liegen, mithin bloßer Verstandeswesen nicht allein zulässig, sondern auch unvermeidlich sei.
Unsere kritische Deduktion schließt dergleichen Dinge (Noumena) auch keineswegs aus, sondern schränkt vielmehr die Grundsätze der Ästhetik [.] dahin ein, daß sie sich ja nicht auf alle Dinge erstrecken sollen, wodurch alles in bloße Erscheinung verwandelt werden würde, sondern daß sie nur von Gegenständen einer möglichen Erfahrung gelten sollen. Also werden hierdurch Verstandeswesen zugelassen, nur mit Einschärfung dieser Regel, die gar keine Ausnahme leidet: daß wir von diesen reinen Verstandeswesen ganz und gar nichts Bestimmtes wissen, noch wissen können, weil unsere reine Verstandesbegriffe sowohl als reine Anschauungen auf nichts als Gegenstände möglicher Erfahrung, mithin auf bloße Sinnenwesen gehen, und, sobald man von diesen abgeht, jenen Begriffen nicht die mindeste Bedeutung mehr übrig bleibt.“ (Prol. § 32 “mögliche,n/-r Erfahrung“ unsererseits hervorgehoben)
“Gegenstände möglicher Erfahrung“, das hört sich soweit ganz harmlos an, ist es aber nicht. Denn Kant verknüpft damit inhaltliche Aspekte die grundsätz-lich über das Maß bloßer Möglichkeit weit hinausreicht (→ insbes. S. 80-6, 109-0, 165-6).
(Da Plato soeben kurz erwähnt wurde: Man könnte durchaus Platos Ideen, als absolute Grundlage für unsere Erfahrung, mit Kants Dingen an sich selbst vergleichen, allerdings in umgekehrter Relation: Während Erfahrung bei Plato umso realer und objektiver wird, je mehr sie zum Grund der Ideen strebt, ist Erfahrung aus der Sicht Kants umso objektiver, je subjektiver sie ist – je mehr sie sich vom Grund der Dinge an sich selbst entfernt, zugunsten des subjektiven Wirkungsbereichs der Verstandeskategorien und reinen Anschauungsformen – ein sehr deutlicher Unterschied mit gegensätzlicher Tendenz!)
Unser kurz zuvor erwähntes Zitat (Prol. § 32) klingt einleuchtend. Nun ist (bzw. sind) Kants Prolegomena im Kern lediglich eine Kurzfassung des Haupt-werkes: der Kritik d. r. V. in der sich so manches komplexer gestaltet als es sich in der genannten Kurzfassung darstellt. So ist in KrV A255 und B310 u. a. die Rede von einem negativen bzw. positiven Gebrauch jenes Begriffs des Noumenons. Zu alledem stellt Kant diesbezüglich den Begriff “X“, den unbe-stimmten Gegenstand unserer Vorstellungen, vor (KrV A104). Einige Seiten weiter (KrV) heißt es, und da ist Kant offensichtlich ganz in seinem Element:
“Alle Vorstellungen haben, als Vorstellungen, ihren Gegenstand, und können selbst wiederum Gegenstände anderer Vorstellungen sein. Er-scheinungen sind die einzigen Gegenstände, die uns unmittelbar gegeben werden können, und das, was sich darin unmittelbar auf den Gegen-stand bezieht, heißt Anschauung. Nun sind aber diese Erscheinungen nicht Dinge an sich selbst, sondern selbst nur Vorstellungen, die wiederum ihren Gegenstand haben, der also von uns nicht mehr angeschaut werden kann, und daher der nichtempirische, d. i. transzendentale Gegenstand = X genannt werden mag.“ (KrV A109 – Original in kursiv)
Uff! Zu soviel Vorstellung fehlt mir die Vorstellung – aber vielleicht verstehen Sie’s ja! S. Gardner hat schon Recht wenn er sagt: “Virtually every sentence of the Critique presents difficulties.“ (Gardner, 1999, S. xi)
“Erscheinungen sind die einzigen Gegenstände, die uns unmittelbar gegeben werden können [...]“ (KrV A109 – Original kursiv)
Das Wort “unmittelbar“ könnte man als “direkt gegeben“ verstehen. Demnach wären Erscheinungen direkt gegeben, also ohne jegliche subjektive Einmischung. Das ist bei Kant natürlich ein Unding, denn ohne subjektive Hilfsmittel in Form von sinnlicher Anschauung und verstandesmäßiger Kategorien kann unserem Bewusstsein überhaupt keine Vorstellung eines Gegenstandes gegeben werden, was Kant nicht müde wird immer und immer wieder seinen Lesern einzubläuen, z. B:
“Wir können uns keinen Gegenstand denken, ohne durch Kategorien; wir können keinen gedachten Gegenstand erkennen, ohne durch Anschauungen, die jenen Begriffen entsprechen.“ (KRV B165, Orig. kursiv)
“Alle Erscheinungen enthalten, der Form nach, eine Anschauung im Raum und Zeit, welche ihnen insgesamt a priori zum Grunde liegt.“
(KrV B202 – Original kursiv)
Wie aber soll man jene “unmittelbar gegebene Erscheinungen“ (KrV A109) verstehen, wenn ihnen generell a priori subjektive Anschauungen, sozusagen als notwendige subjektive Intervention, zu Grunde liegen (KrV 202)? – Der Begriff der “Anschauung“ ist ohnehin voller Tücken:
“Anschauung: einer der wichtigsten und zugleich vieldeutigsten Termini der Philosophie. Anschauung stellt ihren Gegenstand als unvermitteltes, gegenwär-tiges Ganzes dar [wie das? Ist hier das Ganze als eigenständige “Summe des Einzelnen“ gemeint oder eher als einzelnes Teil einer Summe? Wie auch immer, weder die eine noch die andere Möglichkeit wird in der KrV noch im zitierten Werk hinreichend begründet – und gerade jene Begründung wäre eminent wichtig!] (im Gegensatz zum Begriff) und bildet damit eine wichtige Quelle der Erkenntnis. Anschauung wird sowohl für die Fähigkeit, Anschau-ungen zu haben, gebraucht (die Anschauung) als auch für ein einzelnes Resultat dieses Vermögens (eine Anschauung). Wichtig ist die Abgrenzung gegen ver-wandte Begriffe wie Intuition und Wahrnehmung. Einen deutlichen Einschnitt in der Begriffsgeschichte von ‚Anschauung’ markiert nun Kants Erkenntnistheorie. Vor Kant wurde Anschauung weitgehend gleichbedeutend mit Intuition (im Sinne von geistiger Schau, rationalem Begreifen) gebraucht. Kant betonte die Abkehr von dieser Tradition die Bindung der Anschauung an die Sinnlichkeit (nach dem Vorbild des Sehens etwa). Anschauung setzt einen Gegenstand voraus, der mit den Sinnen angeschaut wird. Dieser kann sich außerhalb des Bewußtseins (des ‚Gemüts’) befinden (dann spricht er die äußere Anschauung an) oder er ist ein Bewußtseinsinhalt (dann gehört er zum Bereich der inneren Anschauung). Der Anschauung verwandt ist die Einbildungskraft, die Abbilder und bloße Phantasien hervorbringt. Aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Gegen-stand wird die Anschauung als rezeptiv (aufnehmend) bezeichnet. Weiterhin ist sie singulär, d. h. sie stellt den angeschauten Gegenstand als Ganzes einzeln für sich vor, so daß er v. a. niemals in eine Menge von Aussagen über ihn aufgelöst werden kann. Die Einheit des angeschauten Objektes wird nicht von der Sinnlichkeit allein gestiftet (auch Apperzeption); hier kommt der Verstand zum Zuge. Kant maß der Anschauung große Bedeutung bei der Begründung der Mathematik zu. Allerdings spielt hier nicht die empirische Anschauung (‚die Anschauung, die sich auf ihren Gegenstand durch Empfindung bezieht’) eine Rolle, sondern die reine Anschauung [...] Während rein begriffliche Erkenntnis unser Wissen nicht vergrößert, da sie stets analytisch und damit erläutern ist, kann dies jedoch die auf Anschauung gegründete Erkenntnis. Sie liefert synthetische Urteile [...] Nichttriviale Erkenntnis kommt nach Kant nur durch das Zusammenspiel von Anschauung und Begriffen zustande: ‚Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Begriffe ohne Anschauungen sind leer [KrV A51/ B75] .’ Damit nimmt Kant eine zwischen Empirismus und Rationalismus vermittelnde Position ein [→ S. 17, 37, 98, 207] . – Die wichtigsten Bedeutungen von Anschauung sind: 1. Anschauung als sinnliche Wahrnehmung, 2. als pro-duktive Vorstellung, 3. als kategoriales Erfassen von logisch-mathematischen Sachverhalten [...], 4. als Wesens- oder Ideenschau (Anamnesis), 5. intellek-tuelle Anschauung und 6. Anschauung als Zeichenanschauung [...]“ (Schüler-Duden, Die Philosophie, S. 30, – Querverweise wurden ausgelassen.)
Die zahlreichen Widersprüche, die der soeben zitierte (an sich hochqualifi-zierte) Beitrag zur Anschauung (schuldlos) andeutet, können wir unmöglich in unserem Rahmen alle im Einzelnen anfahren – nicht einmal annähernd! Zumindest aber wollen wir darauf hinweisen: Kant unterlässt es, das angeblich Einzelne der A. zu begründen – dazu → S. 100, ferner S. 56-7, 136, 162. 195ff.
Hier nun eine kurze Zwischenbilanz zurückliegender Kant-Zitate :
Die objektive Gültigkeit unserer subjektiven Bedingungen beruht darauf, dass sie die Gründe der synthetischen Einheit a priori der Verknüpfung der Erscheinungen, sowie der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt, darstellen (KrV A125-6).
Unserer Erfahrung ist Erkenntnis untermengt, die ihren Ursprung a priori haben muss, und die vielleicht nur dazu dient, den Vorstellungen der Sinne Zusammenhang zu verschaffen (KrV A1-2).
Die Einheit der Apperzeption ist der transzendentale Grund der not-wendigen Gesetzmäßigkeit aller Erscheinungen in einer Erfahrung (KrV A127).
Naturnotwendigkeit erfordert die Bestimmbarkeit jeder Begebenheit der Sinnenwelt nach beständigen Gesetzen, und somit generell eine Beziehung auf die Ursache der Erscheinung, wobei das zu Grunde liegende Ding an sich selbst und dessen Kausalität unbekannt bleibt (Prol. Dritter Teil §53).
Nebst der Kausalität der Natur existiert eventuell eine weitere der Freiheit (KrV A444-5/B472-3).
Es muss ein transzendentaler, bloß dem reinen Verstand denkbarer Grund für die Erscheinungen der Welt existieren (KrV A696/B724).
Das transzendentale Objekt, welches den äußeren Erscheinungen, sowie das, was der inneren Anschauung zum Grunde liegt, ist weder Materie, noch ein denkendes Wesen an sich selbst, sondern ein uns unbekannter Grund der Erscheinung (KrV A379-0).
Unsere Verstandesregeln sind a priori wahr und stellen den Quell aller Wahrheit dar, weil sie den Grund der Möglichkeit der Erfahrung in sich enthalten (KrV A237).
Alle möglichen Wahrnehmungen stehen unter der notwendigen Gesetzmäßigkeit der Kategorien (KrV B164-5).
Das Mannigfaltige der Vorstellung kann in einer rein sinnlichen Anschauung gegeben werden; deren Form kann a priori in unserem Vorstellungsvermögen liegen, jene Form stellt sodann lediglich eine Art dar, wie das Subjekt affiziert wird (KrV B129).
Sind wir nach alledem nun allerdings dem eigentlichen Grunde für unsere Erfahrung auch nur einen Schritt näher gekommen?
Kant scheint ständig zwischen subjektiven inneren und objektiven äußeren Gründen der Erfahrung hin und her zu pendeln.
Dieser Zickzackkurs (den wir hier lediglich ganz grob andeuten können) beruht allerdings nicht direkt auf Willkür. Er ist notwendigerweise vorgegeben, denn Kants Transzendentaler Idealismus erscheint grundsätzlich alles andere als zwingend logisch, was wir zuvor bereits bemängelt haben.
Nun, Kant hat nicht “den“ Grund, er hat verschiedene, im Wesentlichen Sinnlichkeit und Verstand (KrV B29, zitiert → S. 62).
“Verstand“ versteht sich dabei (in den Kategorien): rein, subjektiv, apriorisch, innerlich, gesetzlich.
“Sinnlichkeit“ spaltet sich hingegen auf in rein, subjektiv, apriorisch (Formen d. Zeit u. d. Raumes) und empirisch bzw. äußerlich (u. a. KrV A 50-1/B74-5). Über die Affektion zielt die Empfindung schließlich auf die äußeren Dinge an sich selbst. Alles was die Affektion liefert ist “Stoff“ – schlicht völlig unbestimmt, undefinierbar und roh (KrV B1).
Dinge an sich selbst sind bei Kant der Grund für jenen “rohen Stoff“.
Der Grund für die Form und Gestalt zu der jener rohe Stoff letztlich in unserer Erfahrung gebildet wird, geht hingegen auf unsere apriori-schen subjektiven formalen Bedingungen der Möglichkeit der Erfah-rung zurück: Verstandes-Kategorien, nebst reinen Formen d. Anschau-ung (Raum u. Zeit) und nicht auf den zugrunde liegenden rohen Stoff.
Roher Stoff und Dinge an sich selbst, sosehr sie auch auf das absolut Objektive abzielen und als Ur-Gründe gelten mögen, haben bei Kant keinen Einfluss auf förmliche Gestalt und Bestimmung unserer Erfah-rung. Einfluss (und menschliche Objektivität) geht diesbezüglich voll auf das Konto subjektiver apriorischer formaler Bedingungen d. M. d. E.
Kant will uns nicht den Ur-Grund der absoluten Realität auf Ebene der Dinge an sich selbst erklären. Jenen Ur-Grund hält er generell für unerreichbar – folglich gibt er sich mit ihm nicht weiter ab.
Umso mehr konzentriert er sich auf subjektive apriorische Gründe, die er meint gänzlich unabhängig der absoluten behandeln zu können:
“[...] was die Dinge an sich sein mögen, weiß ich nicht, und brauche es auch nicht zu wissen [...]“ (KrV A276-7/B332-3)
Gerade mit der Aussage dieses letzten Zitats beweist Kant, dass er den Ur-Grund unserer Erfahrung, die Dinge an sich selbst, nicht wirklich ernst nimmt – er führt jenen Begriff offenbar nur um sich damit ein Standbein zur absoluten Realität bzw. zum Realismus zu sichern – egal wie vage – egal wie unbestimmt und fern (vergleiche → S. 16-7, 36-7, 207).
Wäre es allerdings zulässig sich, im Stile Kants, über äußere Gründe dermaßen erhaben zu geben? Verlangt erfolgreiches äußerliches Handeln nicht grundsätzlich, dass man sich der jeweiligen Äußerlich-keit anpasst? Wie um alles in der Welt sollte es möglich sein, sich in einem Medium (hier die absolute Realität) erfolgreich zu bewegen, oder überhaupt in ihm zu leben, zu existieren, wenn sich dieses Medium bestenfalls als völlig unbestimmter roher Stoff präsentiert? (→ u. a. S. 189)
Die aktuelle Thematik ist mit diesem kurzen Intermezzo nicht abgeschlossen. Zunächst aber geht’s nochmals einige Schritte zurück, mit veränderter Perspektive, versteht sich (eventuelle Rückschritte wurden ja bereits auf S. 12 angekündigt):
Bevor wir in unserer Diskussion fortschreiten möchte ich an dieser Stelle auf eine Spezialität Kants zurückkommen, die sich z. B. aus der (meinerseits zunächst kommentarlosen) Zusam-menstellung ad hoc der folgenden Zitaten mit größtenteils bereits bekanntem Inhalt ergibt. Dabei achte man auf das Verhältnis zwischen bestimmten apriorischen und relativ unbe-stimmten empirischen Aspekten:
“Kategorien sind Begriffe, welche den Erscheinungen, mithin der Natur [...] vorschreiben [...]“ (KrV B163 – Original kursiv)
“Ob nun aber gleich diese Verstandesregeln nicht allein a priori wahr sind, sondern sogar der Quell aller Wahrheit, d. i. der Übereinstimmung unserer Erkenntnis mit Objekten, dadurch, daß sie den Grund der Mög-lichkeit der Erfahrung, als des Inbegriffes aller Erkenntnis, darin uns Objekte gegeben werden mögen, in sich enthalten [...]“ (KrV B296)
“Wir können uns keinen Gegenstand denken, ohne durch Katego-rien; wir können keinen gedachten Gegenstand erkennen, ohne durch Anschauungen, die jenen Begriffen entsprechen. Nun sind alle unsere Anschauungen sinnlich, und diese Erkenntnis, so fern der Gegenstand derselben gegeben ist, ist empirisch. Empirische Erkenntnis aber ist Erfahrung. Folglich ist uns keine Erkenntnis a priori möglich, als lediglich von Gegenständen möglicher Erfahrung.“ (KrV B165-6 – Original kursiv)
“Diejenige Anschauung, welche sich auf den Gegenstand durch Empfindung bezieht, heißt empirisch. Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung, heißt Erscheinung.“ (KrV A20)
Wie jedoch ist es möglich, dass der Gegenstand einer empi-rischen Anschauung – Erscheinung – unbestimmt ist, wenn alle Möglichkeiten der Erfahrung auf den Kategorien beruhen und – so sollte man denken – auch von eben diesen Kategorien notwendigerweise bestimmt sind (KrV B163-5, B296, A125-8, Prol. §17, §23, §36, §38 – siehe dazu auch das Prauss-Zitat, S. 120)?
Der extreme Widerspruch, der sich aus der Konstellation apriorischer Bedingungen einerseits und empirischer Anschau-ung andererseits bildet, geht verhältnismäßig deutlich aus folgendem Auszug hervor:
“[...] Kategorien [...] daß sie vor sich selbst nichts als logische Funktionen sind [passiv!] , als solche aber nicht den mindesten Begriff von einem Objekt an sich selbst ausmachen, sondern es bedürfen, daß sinnliche Anschauung zum Grunde liege, und alsdenn nur dazu dienen, empirische Urteile, die sonst in Ansehung aller Funktionen zu urteilen unbestimmt und gleichgültig sind, in Ansehung derselben zu bestimmen, ihnen dadurch Allgemeingültigkeit zu verschaffen [letztlich sodann aktiv!] , und vermittelst ihrer Erfahrungsurteile überhaupt möglich zu machen.“ (Prol. § 39)
Dadurch dass Kategorien der (subjektiv-formale) Grund jeglicher Erfahrung sind (Gegensatz: objektive äußere “offizielle“Ur-Grund → S. 56, 59, 80, 83), bestimmen sie notwendigerweise auch alle scheinbar unbestimmten Eindrücke der empirischen Anschauungen. Im folgenden Zitat behauptet Kant hingegen eher das krasse Gegenteil:
“Man kann alle Erkenntnis, wodurch ich dasjenige, was zur empirischen Erkenntnis gehört, a priori erkennen und bestimmen kann, eine Antizipation nennen [...] Da aber an den Erscheinungen etwas ist, was niemals a priori erkannt wird, und welches daher auch den eigentlichen Unterschied des Empirischen von dem Erkenntnis a priori ausmacht, nämlich die Empfindung (als Materie der Wahrnehmung), so folgt, daß diese es eigentlich sei, was gar nicht antizipiert werden kann.“
(KrV A167/B208-9 – siehe auch unser vorliegendes
Buch , die Seiten 74-7, 120)
Der bloße Begriff “Wasser“ ist mengenmäßig zunächst völlig unbestimmt. Ein Liter Wasser wäre hingegen quantitativ eindeutig bestimmt. Mit Kant wäre ein räumlicher Liter Wasser quasi durch die subjektiv vorgegebene reine Anschauungsform des Raumes eindeutig definiert. Alle übrigen zunächst unbestimmten Aspekte jenes Wässerchens wären ebenfalls durch die Verstandes-kategorien und reinen Anschauungsform der Zeit erfasst, so dass der somit unmittelbar zum Bewusstsein gelangende, innerlich angeschaute Gegenstand schließlich in jeder angeschauten Beziehung vollends bestimmt wäre. Dasjenige das “niemals a priori erkannt wird“ (KrV A167) wird entweder überhaupt nicht erkannt oder es wird a priori mittels der Kategorien und Anschauungsformen gewertet. Entgegen Kant liegt damit alles, das Apriorische wie das Aposteriorische im Bereich der Kategorien und Anschauungsformen. Kants Differenzierung zwischen a priori und a posteriori ist daher eine Farce.
Der Widerspruch im obigen Zsh. (Abkürzung die ich später noch häufiger für das Wort “Zusammenhang“ gebrauchen werde) wird nicht gerade geringer, wenn man bedenkt, dass alle unsere Erscheinungen, gemäß Kant, auf objektive Dinge an sich selbst (“objektiv“ hier mit absolutem Gehalt) gegründet sind:
“Daß unseren äußeren Wahrnehmungen etwas Wirkliches außer uns, nicht bloß korrespondiere, sondern auch korrespondieren müsse, kann [...] bewiesen werden.“ (Prol. §49)
“Demnach gestehe ich allerdings, daß es außer uns Körper gebe, d. i. Dinge, die, obzwar nach dem, was sie an sich selbst sein mögen, uns gänzlich unbekannt, wir durch die Vorstellung kennen, welche ihr Einfluß auf unsre Sinnlichkeit uns verschafft, und denen wir die Benennung eines Körpers geben, welches Wort also bloß die Erscheinung jenes uns unbekannten, aber nichts desto weniger wirklichen Gegenstandes bedeutet.“ (Prol. Erster Teil, Anmerkung II)
“[...] der äußere Sinn ist schon an sich Beziehung der Anschauung auf etwas Wirkliches außer mir, [...]“ (KrV BXL – im Original kursiv)
“Ich kann also äußere Dinge eigentlich nicht wahrnehmen, sondern nur aus meiner inneren Wahrnehmung auf ihr Dasein schließen, indem ich diese als die Wirkung ansehe, wozu etwas Äußeres die nächste Ursache ist.“ (KrV A 368 – im Original kursiv)
“[...] eine Beziehung auf Ursache in der Erscheinung, wobei das Ding an sich selbst, was zum Grunde liegt, und dessen Kausalität unbekannt bleibt.“ (Prol. Dritter Teil, § 53)
(Vorstellungen die sich auf Dinge einer unabhängigen Realität beziehen, hätten doch sicher ganz besonders das Recht als wahr, real und objektiv zu gelten. Aber Vorsicht hier: Die objektive Realität unserer Erscheinungen gründet sich, was dem aufmerksamen Leser nicht entgangen sein dürfte, gemäß Kant, auf die subjektiven Kategorien und nicht auf die Dinge an sich selbst – einer der merkwürdigsten und widersprüchlichsten Punkte seines uns vorliegenden Systems überhaupt, auf den man kaum deutlich genug in diesem Zsh. hinweisen kann (→ “menschliche“ Objektivität S. 28, (50), 56, 95)!
Sind nicht “objektive“Dinge an sich selbst ebenso Gründe für die Möglichkeit jeglicher Erfahrung, wie die apriorischen subjektiven Verstandeskategorien und Anschauungsformen? Selbstverständlich! Allerdings hätte dieser Gedankengang für Kant eine sehr unangenehme Folge: Er müsste anerkennen, dass unsere Erscheinungen eben nicht allein durch unsere apriorischen subjektiven Bedingungen jeglicher Erfahrung inhaltlich geprägt sind, sondern auch durch die objektiven apriorischen Bedingungen jeglicher Erfahrung – durch die Dinge an sich selbst. Damit würde er seiner eigenen Erkenntnistheorie jedoch selbst den K.-o.-Schlag versetzen oder zumindest ihr mit realistischem Ballast eine gefährliche Schieflage zumuten [→ S. 53, 56, 65, 95-8, 119].
Kant konzentriert sich aus gutem Grunde (gut zumindest für sein System, das er natürlich verteidigen möchte) lediglich auf ganz bestimmte “subjektive“ Bedingungen der Erfahrung, von denen er, so gesehen, jegliche Empfindung ausschließlich aber doch absolut abhängig macht. Das ist natürlich ein ganz kapitaler Fehler, zumindest was die “ausschließliche“ Abhängigkeit betrifft, denn neben den Dingen an sich selbst und neben unzähligen relativ “techni-schen“ Aspekten, die mit der Sinnesinterpretation zwangsläufig verbunden sind, gibt es noch zahlreiche weitere Bedingungen der Möglichkeit menschlicher Erfahrung, z. B. dass wir atmen, essen, trinken, leben, dass die Welt divers, vielschichtig, gegensätzlich ist und überhaupt existiert, usw. Nicht zuletzt ist die Beschaffenheit der subjektiven Verstandeskategorien und Anschauungsfor-men selbst bedingt durch eine Vielzahl einzelner Kriterien.
Allerdings ist der unmittelbar zurückliegenden Aspekt insge-samt mit einem erheblichen Gedankenfehler belastet:
Bedingungen sind sehr oft quasi als Sieb aufzufassen – sie sieben aus einer Vielzahl grundsätzlich gegebener Kriterien ganz bestimmte heraus. Die solchermaßen ausgewählten Kriterien richten sich notwendigerweise nach einer als Sieb fungierender Bedingung. Es ist jedoch prinzipiell falsch jene Bedingung (in diesem Falle ein Sieb) als Erzeuger jener Kriterien anzusehen. Jedes einzelne Kettenglied, um ein anderes Beispiel zu nennen, bedingt insgesamt die jeweilige Kette und damit eine zu übertragende Kraft quantitativ, jedoch nicht qualitativ – der quantitative Wert der übertragbare Kraft richtet sich nach dem schwächsten Glied – nicht jedoch Charakter und Richtung jener Kraft. Ganze Reihen, gegebenenfalls gar unendlich lange Reihen verschiedenster Bedingungen, haben, vorzüglich im technischen Bereich, häufig keinen qualitativen Einfluss auf das direkt Bedingte, ganz sicher dann nicht, wenn sie eine bestimmte, mehr oder weniger beliebig oft wiederholbare Funktion haben – darauf kommen wir zurück (→ u. a. S. 86ff).
Mit dem Begriff der Sinnlichkeit verbinden sich bei Kant mehrere Aspekte (u. a. Empfindung, Anschauung, Bedingung, Form, Raum, Zeit, Rezeptivität, Schema) die wir nun weder alle einzeln untersuchen können noch müssen. Es wäre allerdings wünschenswert möglichst genau zu recherchieren ob bzw. wie viel Einfluss von subjektiver Seite auf unsere Erscheinungen ausgeht, was sodann eventuell, wie wir im Hauptteil demonstrieren werden, für Kant ganz erhebliche fundamen-tale Probleme beinhaltet, die er selbst leider entweder völlig übersieht, oder aber gänzlich übersehen haben will.
Im Folgenden sei Manfred Baum zitieren:
“Vielmehr beruht nur die Objektivität gegebener Vorstellungen auf der Tätigkeit des Subjekts, also nicht das Objekt selbst [S. 176] . [...] Und ist der Verstand derjenige, der die Objektivität der Objekte macht, so kann er dies nur als Autor der Naturordnung im ganzen, also als Gesetzgeber der Gesetzmäßigkeit aller Erscheinungen in Raum und Zeit tun. [...] Das erkennende Subjekt, nachdem sich das erkannte Objekt bei Kant richtet, ist dasjenige, was die Objektivität des Objekts zustandebringt, indem es ihm einen Platz in der ihrer Form nach von ihm selbst gemachten Natur anweist [S. 177] .“ (Probleme der „Kritik
der reinen Vernunft“, Kant-Tagung Marburg 1981, herausgegeben von B. Tuschling, Walter de Gruyter, 1984, S. 176-7)
Es ist immer wieder höchst erstaunlich wie bedenkenlos, ja direkt majestätisch-erhaben, die verschiedensten Autoren über einen ganz wesentlichen Aspekt hinwegsegeln, als sei er nicht vorhanden: der Schluss von der potentiellen Fülle zu irgendwelchen individuellen Details (→ u. a. S. 134ff, 189ff).
Mit jenem “Platz anweisen“ wird willkürlich Platz gemacht für ein Objekt das keinen Platz hat (→ u. a. S. 165-6, 198, 207).
Wenn jenes Objekt selbst aber keinen Platz hat, so fragt es sich, nach welchen Kriterien die Platzanweisung erfolgen soll?
Nach subjektiven Bedingungen, würde M. Baum mit Kant dazu sagen! – das wäre hier jedoch keine Antwort, denn aus der potentiellen Fülle aller möglichen Ziele allein ergibt sich noch kein konkretes Ziel! Um überhaupt ansetzen zu können braucht die ordnende Gewalt gewisse Kriterien vom zu-ordnenden Objekt – andernfalls ist jegliches Ordnen unmöglich.
Das zu-ordnende Objekt muss sich ausweisen können, andernfalls kann Ordnung nicht einmal wissen, dass überhaupt ein zur Ordnung befähigtes Objekt vorliegt.
“Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, daß selbst unsere Erfahrungserkenntnis ein Zusam-mengesetztes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen, und dem, was unser eigenes Erkenntnisvermögen (durch sinnliche Eindrücke bloß veranlaßt,) aus sich selbst hergibt [...]“ (KrV B1-2, Original kursiv)
Dem letzten Zitat zufolge sind unsere bewusst wahrgenom-menen Sinnesinterpretationen möglicherweise ein Gemisch aus absoluter Realität und subjektiver Gegebenheiten. Der Grund all unserer Erfahrung insgesamt läge demnach teils in den Dingen an sich selbst, und teils in der uns eigenen apriorischen Struktur – Kant betont im weiteren Verlauf der KrV allerdings ganz entschieden das Strukturelle (→ S. 56) nichtsdestoweniger schwingen die Dinge an sich selbst stets hintergründig mit, andernfalls würde Kant exakt in den Idealismus verfallen, den er überwinden möchte – das muss man auch bei den sogleich gesetzten Kant-Zitaten unbedingt berücksichtigen:
“[...] daß es zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich, Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, durch den zweiten aber gedacht werden.“ (KrV B29)
“Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen (die Rezeptivität der Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen (Spontaneität der Begriffe); durch die erstere wird uns ein Gegenstand gegeben, durch die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung (als bloße Vorstellung des Gemüts) gedacht.“ (KrV A50/B74)
In Verbindung mit der Mannigfaltigkeit der Anschauung, der Apprehension der Vorstellungen, redet Kant später gar von einer dreifachen Synthesis:
“[...] drei subjektive Erkenntnisquellen, welche selbst den Verstand und, durch diesen, alle Erfahrung, als ein empirisches Produkt des Verstandes möglich machen.“ (KrV A97-8 – Original kursiv)
Hier, wie überhaupt generell in jenem zitierten Werk, versteht Kant mit “möglich machen“ (→ S. 80ff) offenbar eine aktive inhaltliche “Erzeugung“, statt eine bloße “Weiterleitung“ bereits im Grunde vorhandener Informationsinhalte. Für eine Unterscheidung zwischen Bedingungen die etwas “erzeugen“ und denen, die lediglich etwas “weiterleiten“ ist Kant entweder völlig blind oder er hält sie wohl für nicht möglich. Jedenfalls behandelt Kant Bedingungen generell, namentlich die subjek-tiven a priori gegebenen B. der Möglichkeit menschlicher Erfahrung, willkürlich pauschal. Er unternimmt keinen Versuch entsprechend zu differenzieren – ein möglicherweise katas-trophaler Unterlassungsfehler.
Manfred Baum sei nochmals zitiert (aus zuvor erwähntem Werk):
“Was aber bringt nun der Verstand an den Erscheinungen der Sinne hervor, wenn er in intellektueller Synthesis die Einheit eines Mannig-faltigen der Vorstellungen überhaupt stiftet, also angesichts gegebener Vorstellungen der Sinne die Vorstellung des Objekts hervorbringt? Offenbar nicht das Objekt selbst, denn dieses ist durch die Sinne gegeben, die aber nicht das Objekt als Objekt, sondern als gegebenes Mannigfaltiges in zufälliger und variabler Einheit vorstellen.“
(Probleme der „Kritik der reinen Vernunft“, Kant-Tagung Marburg 1981, Seite 175)
Kant behauptet, dass allem Empirischen – im Gegensatz zu apriorischen Aspekten – Notwendigkeit fehlt und folglich alle Dinge der Sinnenwelt zufällig sind (siehe z. B: KrV A560-5/B588-93, B219, A112-4). Merkwürdigerweise sind unsere Alltagserlebnisse, die sich mehr oder weniger alle auf unsere Empfindungen in der einen oder anderen Form beziehen, jedoch in aller Regel keineswegs zufälliger Natur. Unsere Empfindun-gen sind grundsätzlich sehr Ziel-orientiert was sich mit dem Begriff der Zufälligkeit nicht sonderlich verträgt. Wäre das empfundene Äußere tatsächlich zufällig, wäre es chaotisch.
Nun könnte Kant an dieser Stelle natürlich kontern, z. B. gemäß KrV B163-5, und behaupten, dass wir die Ordnung, mit-tels unserer Verstandeskategorien und apriorischen Formen der Anschauung, in all unserer Erfahrung selbst herstellen.
Damit kämen wir allerdings auf eine uns mittlerweile bereits bekannte Fragestellung zurück: Was, bitteschön, soll in unserer Sinnenwelt zufällig (bzw. empirisch) sein, wenn Letztere, spätestens ab der Bewusstseinsstufe durch subjektive apriorische strikt gesetzmäßige Maßnahmen geordnet ist (siehe u. a. KrV B163-5, A125-8)?
Unsere Sinnenwelt setzt sich jedoch gemäß Kant nicht aus rein apriorischen Aspekten zusammen. Neben den reinen apri-orischen subjektiven Verstandeskategorien und reinen subjek-tiven Formen der Anschauung (Raum und Zeit) gehören, so Kant, auch weniger reine, empirische Anschauungsformen.
“Anschauungen [...] sind entweder rein, oder empirisch. Empirisch, wenn Empfindung [...] darin enthalten ist: rein aber, wenn der Vorstellung keine Empfindung beigemischt ist.“ (KrV A50/B74)
Mit “Empfindung“ versteht Kant somit die Wirkung der Außenwelt auf unsere Sinne. Das lassen wir uns noch bestätigen:
“Die Wirkung eines Gegenstandes auf die Vorstellungsfähigkeit, so fern wir von demselben affiziert werden, ist Empfindung. Diejenige Anschauung, welche sich auf den Gegenstand durch Empfindung bezieht, heißt empirisch. Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung, heißt Erscheinung.“ (KrV B34/A20)
Was aber soll – wir sind hier pingelig, aber nicht ohne Grund und wiederholen erneut (siehe Seite 57, 64) – an diesen “Erschei-nungen“ unbestimmt sein, wenn Kant an anderer Stelle erklärt:
“Kategorien sind Begriffe, welche den Erscheinungen, mithin der Natur, als dem Inbegriffe aller Erscheinungen [...] Gesetze a priori vor-schreiben [und demnach bestimmen!] , [...]“ (KrV B163 – Original kursiv)
Es lässt sich allenfalls mutmaßen, dass Kant die Art, wie wir von den äußeren Gegenständen der absoluten Realität affiziert werden, als ungeordnet und zufällig betrachtet, und wirklich:
“Nun kommen zwar in der Erfahrung die Wahrnehmungen nur zufälliger Weise zu einander, so, daß keine Notwendigkeit ihrer Verknüpfung aus den Wahrnehmungen selbst erhellet, noch erhellen kann [...] “ (KrV B219 – Original kursiv)
Unbestimmt wäre der äußere rohe Stoff – jener Stoff als solcher ist jedoch unerkennbar, er wird erst über die subjektive Bestimmung erkenntlich, dann eben aber ist er bestimmt.
“Die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein [...].“ (KrV A125, Original kursiv)
Demzufolge wäre wohl alles Empirische und Zufällige unserer Erfahrung auf äußere Aspekte der Affektion zurückzu-führen. Denn “innerlich“ stehen apriorische und damit notwen-dige subjektive Möglichkeiten der Erfahrung zur Verfügung die nichts dem Zufall überlassen und ohne die in dieser Richtung, so Kant, nichts geht. Äußerlich stehen jedoch zunächst nicht minder apriorische Aspekte bereit: die Dinge an sich selbst. Sodann müsste letztlich doch irgendwo auf subjektiver Seite irgendetwas nicht “ordnungsgemäß“ bzw. nicht a priori gesetzlich funktionieren – vielleicht an der körperlich relativ äußeren Subjektivität unserer Sinnesorgane ? Kant ist hingegen definitiv der Meinung, dass unsere Sinne nicht irren! (KrV B350)
Umso erstaunlicher ist es, dass er sogenannte sekundäre Qualitäten der Gegenstände unserer Erfahrung auf subjektive Gegebenheiten, hier der Augen (!) zurückführt:
“[...] da nämlich etwa Farben, Geschmack etc. mit Recht nicht als Beschaffenheit der Dinge, sondern bloß als Veränderungen unseres Subjekts, die so gar bei verschiedenen Menschen verschieden sein können, betrachtet werden. Denn in diesem Falle gilt das, was ursprünglich selbst nur Erscheinung ist, z. B. eine Rose, im empirischen Verstande für ein Ding an sich selbst, welches doch jedem Auge in Ansehung der Farbe anders erscheinen kann.“ (KrV B45)
Wie erklärt sich Kant allerdings, dass unterschiedlich gefärb-te Objekte unterschiedliches thermisches Verhalten zeigen – ein schwarzer Gegenstand z. B. wesentlich intensiver Energie abstrahlt wie ein, im Übrigen, völlig identischer weißer Körper, und das offenbar völlig unabhängig jeglicher menschlicher Subjektivität?
Davon abgesehen, Sekundäre Qualitäten wären sodann letztlich gewisserma-ßen “irrige Urteile“, weil sie inhaltlich aus d. Sicht Kants nicht von Seiten der absoluten Realität und den absolut realen Dingen an sich selbst herrühren, sondern umgekehrt, weil anhand ihrer Existenz jenen Dingen an sich selbst Quali-täten, z. B. Farbe, zuteil wird, die jene Dinge (d. a. Realität) angeblich überhaupt nicht haben. Und wer liefert uns diesen fragwürdigen Schwindel? – letzten Endes doch die Sinnesorgane, aber die urteilen ja nicht, die irren ja nicht nach KrV B350.
Kant redet zuweilen von notwendig empirischen Kriterien, (z. B: KrV A720/B748) das ist nicht sehr geschickt, weil er andererseits allem Empirischen, generell und rigoros, eben genau jene Notwendig-keit abspricht (z. B: KrV B219, A45/B62).
“Der Wohlgeschmack eines Weines gehört nicht zu den objektiven Bestimmungen des Weines, mithin eines Objektes so gar als Erschei-nung betrachtet, sondern zu der besonderen Beschaffenheit des Sinnes an dem Subjekt, was ihn genießt. Die Farben sind nicht Beschaffen-heiten der Körper, deren Anschauung sie anhängen, sondern auch nur Modifikationen des Sinnes des Gesichts, welches vom Lichte auf gewisse Weise affiziert wird. Dagegen gehört der Raum, als Bedingung äußerer Objekte, notwendiger Weise zur Erscheinung oder Anschauung dersel-ben. Geschmack und Farben sind gar nicht notwendige Bedingungen, unter welchen die Gegenstände allein vor uns Objekte der Sinne werden können. Sie sind nur als zufällig beigefügte Wirkungen der besonderen Organisation mit der Erscheinung verbunden. Daher sind sie auch keine Vorstellungen a priori, sondern auf Empfindung, der Wohlgeschmack aber so gar auf Gefühl (der Lust und Unlust) als einer Wirkung der Empfindung gegründet.“ (KrV A28-9 – Original kursiv)
Sicherlich unterliegen individuelle Geschmacksempfindun-gen individuellen Schwankungen der verschiedensten Art, das wollen wir selbstverständlich nicht bestreiten. Zwischen “indi-viduellen Schwankungen“ und einer grundsätzlich unterstellten “Subjektivität aller Farben und Geschmäcke“ ist jedoch ein kategorischer Unterschied. Kant geht mit seiner diesbezüglichen Unterstellung viel zu weit – es ist schlicht falsch zu behaupten, Farben und Geschmack seien rein subjektive Kriterien. Nebst dem erwähnten diversen Thermischen Verhalten unterschiedlich gefärbter Gegenstände lassen sich weitere physikalische reale Fakten mit absoluter Präzision bestimmen (z. B. eine bestimmte physik. Wellenlänge) unabhängig jeglicher subjektiver Differenz und also unabhängig jeglicher Subjektivität überhaupt.
Kant gibt dies indirekt zu, zumindest unterscheidet er an ande-ren Stellen zwischen wesentlichen und zufälligen Aspekten, z. B. KrV A45, was, gemäß KrV A28-9, den Geschmack und Farben betreffend offenbar jedoch nicht gilt, denn dort erklärt er Letztere allesamt als subjektiv. Es fällt überdies auf, dass Kant in KrV A28-9 “subjektiv“ zu einem ganz anderen Zweck als in KrV A45 gebraucht – in A28-9 individuell, in A45 hingegen mit allgemeinem und somit nicht individuellem Bezug. Das folgende Zitat nimmt sich u. a. dieser Thematik an, ohne allerdings den soeben genannten Bedeutungsunterschied von “subjektiv“ im aktuellen Zsh. zu berücksichtigen:
“Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, daß die räumlichen und zeitlichen Gegenstände, die die empirische Affektion verursachen, keineswegs die Beschaffenheit unserer Wahrnehmungsgegenstände zu haben brauchen. Nur Ausdehnung und Gestalt, vielleicht noch Bewegung und Undurchdringlichkeit (d. i. die sog. primären Qualitäten) müssen zu diesen Gegenständen als ihre Eigenschaften gehören. Die andere Qualitäten (Farben, Geschmack, Wärme usw.) werden dem Subjekt beigelegt und als Empfindungen begriffen [...].“ (M. P. M. Caimi, Kants Lehre von der Empfindung in der Kritik der reinen Vernunft, Bouvier
1982, Seite 81-2)
Der soeben zitierte Text sollte allerdings nicht dazu verleiten, primäre Qualitäten als zu den Dingen an sich selbst gehörend im absoluten Tenor. Kant macht zumindest in seiner/seinen Prolego-mena, Erster Teil Anmerkung II, deutlich, dass letztlich beide, primäre wie sekundäre Qualitäten auf subjektive Gegebenheiten zurückzuführen sind (und auch mit zu bloßen Erscheinungen zählen) – primäre auf unsere (intellektuellen, nicht notwendigerweise materiellen) Verstandeskategorien, sekundäre hingegen auf unsere (physikalisch-materiell bedingten) sensuellen Organe.
Im nachfolgenden Zitat ist u. a. die Rede von der “Affizie-rung durch Gegenstände, die bloß mit primären Qualitäten ausgestattet sind“ mit der wir (und sicher auch Kant, wie nachfolgend erwähnter A. Riehl) grundsätzlich nicht einverstan-den sind. Es dürfte hingegen beim aktuellen Stand unserer Diskussion interessant sein, eine eher allgemein-philosophische Meinung zu hören. M. P. M. Caimi berührt jedenfalls im soeben unterbrochenen Text, im weiteren Verlauf, noch einige Punkte von erheblichem erkenntnistheoretischem Gewicht, so beispiels-weise, indirekt zumindest, den Aspekt der “Kompatibilität“, mit dem wir uns später noch beschäftigen werden.
“Kant unterscheidet in der Erscheinung 'das, was der Anschauung derselben wesentlich anhängt, und für jeden menschlichen Sinn über-haupt gilt, von demjenigen, was derselben nur zufälligerweise zu-kommt, indem es nicht auf die Beziehung der Sinnlichkeit überhaupt, sondern nur auf eine besondere Stellung oder Organisation dieses oder jenes Sinnes gültig ist.' [Fußnote: “KrV A 45 = B 62.” ] Dann läßt Kant die allgemeingültigen, von der Beschaffenheit des jeweiligen Sinnesorgans unabhängigen (primären) Qualitäten Erscheinungen in der Wahrnehmung verursachen: [...] Alois RIEHL hat diese Ansicht der Affizierung durch Gegenstände, die bloß mit primären Qualitäten ausgestattet sind (bzw. durch bewegende Kräfte) für eine unzurei-chende Erklärung der Entstehung von Empfindungen gehalten [Fußnote: “RIEHL, A.: Der philosophische Kritizismus. II. Band, 2. Aufl., 1925, S. 79 ff.“ ] ; die Ungleichartigkeit der Empfindungsquali-täten und der vermeintlich sie verursachenden Kräfte erscheint ihm als eine unüberwindliche Schwierigkeit dieser Auffassung: ’Die Quali-täten [...] müßten dann Schöpfungen der Seele aus Nichts sein [...]. Wie sollten auch diese bunten und warmen Erscheinungen aus einem qualitätslosen Substrate und der bloßen Form seines Wirkens, der Bewegung, hervorquellen können, ohne eine schöpferische Seele? [...] Nun läßt sich freilich der Ursprung der Qualitäten von der Seele aus sowenig begreifen wie von dem Körper aus, so wie dieser die Natur-wissenschaft auffaßt.’ [Fußnote: “RIEHL, a.a.O., S. 80.“ ] Um dieser Schwierigkeit zu begegnen, schlägt RIEHL eine Lehre von der ’spezifischen Disposition des Sinnes’ vor. Sie besteht in der Annahme, daß die Sinne sich im Anklang an die jeweiligen, den Sachen selbst an-haftenden Qualitäten entwickelt haben, etwa als organische Antworten auf spezifische Reize:’ Die Erfahrung, namentlich die entwicklungsge-schichtliche, zwingt uns zur Annahme, daß die Dinge selbst Beschaf-fenheit haben, denen die Qualitäten der Empfindung entsprechen.’ [Fußnote: “RIEHL, a.a.O., S. 85 f. M.E. übersieht Riehl die Tatsache, daß der Reiz nur einen Teil der Ursache der Empfindung ausmacht. Das Modell: Reiz als Ursache, Empfindung als Wirkung, schließt natürlich jede Ungleichartigkeit zwischen Ursache und Wirkung aus. Aber dieses Modell ist eine unzulässige Vereinfachung des Tatbestan-des. Der Reiz wirkt nämlich nicht auf ein ihm ähnliches Etwas; er wird vielmehr von einer Vorstellungsfähigkeit [!] aufgenommen. Diese wirkt nun auch mit [das bestreiten wir mit unserem Werk allerdings ganz entschieden!], so daß das Endergebnis eine Vorstellung sein muß. Daß die Seele von sich aus gewisse Bestimmungen für das Ergebnis der Affektion beiträgt, scheint somit unumgänglich. Eine durchgängige Gleichartigkeit der Wirkung mit dem Reiz würde dagegen die unver-ständliche Heterogeneität der Wirkung (scil. der Empfindung) mit ihrer Mit-ursache (nämlich der Vorstellungsfähigkeit) als Folge haben.“ ] Allerdings erweist sich auch diese Annahme als für die gewünschte Er-klärung der Entstehung der Empfindung unzureichend, wie Riehl selbst anerkennt. Er gibt zu: ’wie diese Entwicklung zustande kommt, wie sich also die Umwandlung der Beschaffenheiten der äußeren Dinge in die Empfindungsqualitäten vollzieht, kann niemals unmittelbar erfah-ren werden; denn unsere Erfahrung beginnt mit dem Resultate dieser Umwandlung, mit der Empfindung.’“ [Fußnote: “RIEHL, a.a.O., S. 85.“ ]
(M. P. M. Caimi, S. 82-4 seines erwähnten Buches → S. 66 ganz unten.)
Den soeben zitierten Text lassen wir nun insgesamt einstwei-len so stehen. Es bleibt uns auch kaum etwas anderes übrig, denn der Unterschied zu unserem Standpunkt ist schlicht zu krass – hier klaffen offensichtlich Welten auseinander.
Allerdings sei gesagt, dass es nicht darauf ankommt, wie sich die “Beschaffenheiten der äußeren Dinge in die Empfindungs-qualitäten vollzieht“. Es spielt auch keine Rolle, dass unsere Erfahrung erst mit dem Resultat jener Umwandlung beginnt. Denn Realitätsempfindung ist grundsätzlich unabhängig von jeglicher subjektiven Struktur. Wer die Welt empfindet, empfindet sie qualitativ prinzipiell korrekt – ob als Mensch, Tier, Pflanze, Marsmensch, Maschine, Computerprogramm oder etwa als imaginäre Figur in einem Roman oder in einem Comic-Abenteuer, wie wir später feststellen werden.
Kant macht (da hat soeben zitierter M. P. M. Caimi durchaus Recht) nicht selten Bemerkungen, denen zufolge ein mehr oder weniger direkter, kontinuierlicher Einfluss der Kategorien auf unsere Sinnesinterpretationen zu erwarten ist, siehe z. B. KrV B161-5, A125-8, A237/B296 und:
“Kategorien sind Begriffe, welche den Erscheinungen, mithin der Natur, als dem Inbegriffe aller Erscheinungen [...] Gesetze a priori vorschreiben [...].“ (KrV B163 – im Original kursiv)
Streng genommen deutet dies gar auf einen hundertprozen-tigen Einfluss der Kategorien hin – der Deutsche Idealismus wendet in diesem Zsh. mit Recht ein: Wenn der Grund aller Erkenntnis bei subjektiven Gegebenheiten liegen sollte, bliebe für die Dinge der Außenwelt nichts mehr zu affizieren übrig. Ein hundertprozentiger Einfluss subjektiver Gegebenheiten kann also kaum dienlich für Kant sein – das wäre ein Rückfall in den klassischen Idealismus (den Kant nicht stärken, sondern überwinden möchte, wie auf S. 62 bereits erwähnt wurde) auch wenn verschiedene Textstellen der KrV eine solche Interpretation nahe legen.
In der gegenwärtigen Art schreiten wir nicht sonderlich zügig voran. Vor allem der Schritt ins eher öffentliche Lager bringt uns ziemlich aus dem Takt. Fassen wir zunächst zusammen:
Nach Kant sind uns zunächst lediglich zwei Aspekte gege-ben: Dinge an sich selbst und die subjektive Struktur. Von jenen Dingen wissen wir angeblich nichts, von jener Struktur hingegen doch immerhin einiges. Die subjektiven Bedingungen der Möglichkeit jeglicher Erfahrung lassen sich, so Kant, prinzipiell a priori erfassen – als da wären, zum einen die Ver-standeskategorien, zum anderen die reinen Anschauungsformen.
Dabei geht es in der Hauptsache um Information, genauer, um das “Sich-Bewusstwerden“ jener Information, und im Beson-deren um den Wahrheitsgehalt einer bewusstgewordenen Information. Ist die Welt, mit absolutem Blick, so wie sie uns erscheint oder ist sie in Wirklichkeit vielleicht ganz anders? Es beläuft sich im Kern darauf, mögliche Fehlerquellen in diesem Kreislauf zwischen Ausgangspunkt und Endstation zu entlarven. Aus der Sicht Kants handelt es sich dabei jedoch nicht um direkte Fehler an sich, eher um ein Missverständnis, resultierend im Wesentlichen aus der zufälligen, unbestimmten Natur alles Empirischen, aus dem a priori unterstellten Einfluss aller involvierten Subjektivität und der menschlichen Vernunft die sozusagen höher strebt wie sie steht.
Sinnesinformation beginnt bei den absolut realen Dingen an sich selbst, erreicht unsere Sinnesorgane, die gemäß Kant, grundsätzlich nicht irren, verbindet sich mit den apriorischen reinen Formen der Anschauung von Raum und Zeit (ist ab dieser Stufe demnach räumlich/zeitlich) verbindet sich sodann mit den apriorischen Kategorien des Verstandes, der “für sich allein (ohne Einfluß einer anderen Ursache), [...]“ (KrV A294) somit ebenfalls nicht irrt – wird sodann der höchsten subjektiven Instanz, der Vernunft vorgelegt, die, obwohl sie höher strebt wie sie steht, sich angeblich keineswegs irren kann:
“Die von aller Erfahrung abgesonderte Vernunft kann alles nur a priori und als notwendig oder gar nicht erkennen; daher ist ihr Urteil niemals Meinung, sondern entweder Enthaltung von allem Urteile, oder apodiktische Gewißheit.“ (KrV A775/B803)
Wo also liegt die Quelle des Fehlers (bzw. des Missverständ-nisses, falls es sich, wie erwähnt, um keinen direkten Fehler handelt)?
Man könnte diese Frage auch anders stellen, z. B: Was ist unbestimmt in unseren Erscheinungen, was ist das: “empirische Anschauung“, oder was exakt bedeutet “empirisch“ überhaupt? Kant vermeidet hier offenbar bewusst in die Tiefe zu gehen, z. B:
“Beide [Anschauungsformen] sind entweder rein, oder empirisch. Empirisch, wenn Empfindung [...] darin enthalten ist;“ (KrV A50/B74)
Diesen eminent wichtigen Punkt hakt Kant mit einem Satz ab, das ist äußerst dürftig, gemessen an dessen Tragweite.
Zu einem gewissen Irrtum wird Kant hingegen recht konkret:
“In einer Vorstellung der Sinne ist (weil sie gar kein Urteil enthält) auch kein Irrtum. Keine Kraft der Natur kann aber von selbst von ihren eigenen Gesetzen abweichen. Daher würden weder der Verstand für sich allein (ohne Einfluß einer andern Ursache), noch die Sinne für sich, irren; der erstere darum nicht, weil, wenn er bloß nach seinen Gesetzen handelt, die Wirkung (das Urteil) mit diesen Gesetzen notwendig übereinstimmen muß. In der Übereinstimmung mit den Gesetzen des Verstandes besteht aber das Formale aller Wahrheit. In den Sinnen ist gar kein Urteil, weder ein wahres, noch falsches. Weil wir nun außer diesen beiden Erkenntnisquellen keine andere haben, so folgt: daß der Irrtum nur durch den unbemerkten Einfluß der Sinnlichkeit auf den Verstand bewirkt werde, wodurch es geschieht, daß die subjektiven Gründe des Urteils mit den objektiven zusammenfließen, und diese von ihrer Bestimmung abweichend machen [...]“ Als Fußnote setzt Kant dem noch hinzu: “Die Sinnlichkeit, dem Verstande untergelegt, als das Objekt, worauf dieser seine Funktion anwendet, ist der Quell realer Erkenntnisse. Eben dieselbe aber, so fern sie auf die Verstandeshandlung selbst einfließt, und ihn zum Urteilen bestimmt, ist der Grund des Irrtums.“
(KrV A294/B351, Hervorhebungen unsererseits.)
Bis einschließlich der Sinnesorgane scheint soweit alles okay zu sein. Wie aber passt nun das Folgende dazu?
“[...] so die Farben nicht als Eigenschaften, die dem Objekt an sich selbst, sondern nur dem Sinn des Sehens als Modifikation anhängen [...]; denn die Existenz des Dinges, was erscheint, wird dadurch nicht wie beim wirklichen Idealism aufgehoben, sondern nur gezeigt, daß wir es, wie es an sich selbst sei, durch Sinne gar nicht erkennen können.“
(Prol. Erster Teil, Anmerkung II)
Wie ist es möglich, dass wir die Dinge die uns erscheinen nicht so sehen können wie sie tatsächlich sind, wenn bis zu und einschließlich der Empfindungsorgane alles in Ordnung ist?
Die Sinnesorgane an sich können nicht irren und doch wer-den uns durch sie markante “Modifikationen“ z. B. Farben als subjektive Eigenschaften präsentiert, die angeblich nichts mit den jeweiligen äußeren Objekten zu schaffen haben. Jene Modifikation(en) die uns durch sensuelle Organe, nach Kant, sozusagen gratis als subjektives Geschenk zur rein äußeren Affektion hinzugefügt wird, beinhaltet wohl zumindest teilweise den Fehler den wir hier jagen.
Zudem geht auf subjektiver Seite anscheinend zwischen aufnehmenden Empfindungsorganen und weiterverarbeitenden Kategorien irgendetwas schief, wie aus dem folgenden uns bereits bekannten kurzen Auszug ersichtlich ist:
“[...] so folgt: daß der Irrtum nur durch den unbemerkten Einfluß der Sinnlichkeit auf den Verstand bewirkt werde, [...]“ (KrV
A294/B350)
Vielleicht passen die äußeren Eindrücke nicht so recht auf die Verstandeskategorien. Demgemäß hat Kant hingegen seinen sogenannten Schematismus, quasi als Mittler, zwischen der Sinnlichkeit und dem Verstande eingebaut:
“Nun ist klar, daß es ein Drittes geben müsse, was einerseits mit der Kategorie, andererseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß, und die Anwendung der ersteren auf die letzte möglich macht. Diese vermittelnde Vorstellung [...] ist das transzendentale Schema.“ (KrV B177/A138)
“[…], obgleich die Schemate der Sinnlichkeit die Kategorien allererst realisieren, sie doch selbige gleichwohl auch restringieren, d. i. auf Bedingungen einschränken, die außer dem Verstande liegen (nämlich in der Sinnlichkeit). Daher ist das Schema eigentlich nur das Phänomenon, oder der sinnliche Begriff eines Gegenstandes, in Übereinstimmung mit der Kategorie.“ (KrV B186/A146)
Wie auch immer, aus den diesbezüglich zitierten Textstellen, besonders KrV A294/B351, geht eindeutig hervor, dass jener “Irrtum”, gemäß Kant, aus subjektiver Seite resultiert.
Dem widerspricht hingegen:
“Nun kommen zwar in der Erfahrung die Wahrnehmungen nur zufälliger Weise zu einander, so, daß keine Notwendigkeit ihrer Verknüpfung aus den Wahrnehmungen selbst erhellet, noch erhellen kann, weil Apprehension nur eine Zusammenstellung des Mannigfalti-gen der empirischen Anschauung, aber keine Vorstellung von der Notwendigkeit der verbundenen Existenz der Erscheinungen, die sie zusammenstellt, im Raum und Zeit, in derselben angetroffen wird.“
(KrV B219 – Original kursiv)
“Die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein, [...]“ (KrV A125
– Original kursiv)
Die Affektion stellt folglich eine ungeordnete, zufällige Angelegenheit dar und beinhaltet damit an sich bereits eine Art Fehler (zumindest gemessen an dem notwendigen Charakter des kategorialen Verstandesbereichs).
Das legt nahe, dass der “Irrtum“ dem wir hier nachstellen, aus inneren und (!) äußeren Kriterien resultiert. Dabei haben wir konkret eigentlich keine einzige direkte Fehlerquelle vorliegen.
Die Dinge an sich selbst sind okay, die Sinnesorgane eben-falls – die “Schemate“, die Kategorien sowie die Vernunft an sich, liegen alle im Bereich des a priori Notwendigen. Und doch schiebt Kant den Schwarzen Peter mal hier hin, mal dahin – wie ist das möglich?
Möglich wird dies praktisch nur dadurch, dass hier verschiedene Dimensionen aufeinander krachen. Die äußeren Dinge an sich liegen in einer völlig anderen Dimension als die inneren jeweiligen Erscheinungen. Das Äußere ist im absoluten Sinne real, das innere hingegen ist ideal – oder sagen wir: geistig – ein kategorischer Unterschied!
Jede Dimension für sich ist okay, beim Wechsel von einer in die andere ist allerdings nicht mehr alles in Ordnung – ohne dass sich konkret sagen ließe, wo genau der Haken liegt, weil eben die erwähnten Dimensionssprünge an sich eine extrem unklare Sache darstellen, die Kant nie auch nur halbwegs zufriedenstellend erklärt – wie sollte er auch?
Denn bei dem dichten Verband rein apriorischer Kriterien die Kant aufbaut, fällt es nicht leicht irgendwelche Lücke für zufällige empirische Impulse aufzuspüren. Wie genau kommt das Empirische in die Kette rein apriorischer Aspekte hinein?
Kant würde sagen, dass die ursprüngliche Affektion an sich ungeordnet und daher zufällig ist. Gemäß Kant müsste unsere soeben gestellte Frage eher lauten: Wie kommen notwendige Kriterien in die ursprünglich rein zufälligen Impulse der Affektion hinein?
Ganz egal jedoch welche der beiden Frageformen wir wählen, Tatsache ist, dass wir, so Kant, empirische wie apriorische Kriterien im Endprodukt vorliegen haben. Das wäre an sich nicht unbedingt ein verdächtiger Aspekt, würde Kant das hier vorstellige Empirische nicht einerseits vollständig von subjektiven apriorischen Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt abhängig machen, andererseits es jedoch exakt jenem Empirischen erlauben, seinen ursprünglichen unab-hängigen empirischen Charakter ungeachtet der unterstellten subjektiven Abhängigkeit vollständig beizubehalten.
Ein unbehandelter Patient ist nach einer Behandlung eben kein unbehandelter Patient mehr – diesen sehr einfachen Aspekt scheint Kant jedoch nicht zu akzeptieren. Für ihn stellt eine Erscheinung augenscheinlich generell quasi eine Summe dar – eine Summe oder eine Parallelschaltung aus apriorischen und aposteriorischen Aspekten. Die Frage wäre jedoch:
Hätten wir es hier mit einer Summe bzw. mit einer Parallel-schaltung oder mit einem Produkt bzw. einer Reihenschaltung zu tun?
Da Kant in diesem Zusammenhang alles von den subjektiven apriorischen Gründen der Möglichkeiten der Erfahrung über-haupt abhängig macht, hätten wir es wohl eher mit einer Reihenschaltung bzw. mit einem Produkt zu tun.
Dieser täuschend-kleine Unterschied ist bedeutsam: Die einzelnen Summanden einer Summe sind relativ frei voneinan-der, die einzelnen Faktoren eines Produktes sind hingegen aneinander gebunden (zumal, wenn es sich wie in diesem Falle um prinzipiell ungleiche Faktoren handelt).
Eier und Wurst ergeben Eier und Wurst, Eier mal Wurst ergibt indes etwas ganz Neues – ergibt Eierwurst (was immer das sein mag). In einem Produkt ist alles von allem abhängig.
Dass Kant alle Erscheinungen ausschließlich von einigen statt von allen Faktoren eines Produktes abhängig macht wäre grundsätzlich unzulässig.
Fasst man hingegen Erscheinungen als eine Summe auf, so besteht weder ein Anlass noch überhaupt eine Berechtigung ir-gendwelche bestimmten Summanden als Bedingung anderen so-mit bedingten Summanden kategorisch bestimmend vorzusetzen.
Eine bedeutsame Zitatenkette (KrV A127-8 – Original kursiv):
Zunächst: “[...] der Verstand ist selbst der Quell der Gesetze der
Natur [...]“
Jedoch: “Zwar können empirische Gesetze, als solche, ihren Ur-
sprung keineswegs vom reinen Verstande herleiten, [...]“
Und doch: “Aber alle empirischen Gesetze sind nur besondere Be-
stimmungen der reinen Gesetze des Verstandes, unter wel-
chen und nach deren Norm jene allererst möglich sind [...]“
Zunächst erklärt Kant hier kategorisch alles von A abhängig, was er im nächsten Schritt jedoch für B zurücknimmt nur um im dritten Schritt erneut zu erklären, dass alles ohne Ausnahme, also auch B, von A abhängt. (Vergleiche zu S. 156-7.)
“Ist in einem Produkt mindestens ein Faktor Null, so ist das ganze Produkt Null. [Eine Summe verhält sich da ganz anders!] “
(Lothar Kusch, 1969, Seite 61)
Kant macht alle Erscheinungen u. a. nach KrV A127-8, im Sinne eines Produktes, absolut von apriorischen subjektiven Gegebenheiten abhängig, womit er zwangsläufig den empiri-schen Charakter alles involvierten Empirischen eliminiert – und doch lässt Kant weiterhin das Empirische (quasi als freien Sum-manden) völlig unlogisch, völlig unbehandelt weiterlaufen!
“empirisch, mithin zufällig“, sagt uns u. a. KrV B5.
“Das Bedingte im Dasein überhaupt heißt zufällig, und das Unbedingte notwendig.“ (KrV A419/B447)
“empirisch [...] niemals notwendig [...]“ (KrV A721/B749)
Was genau aber ist bezüglich der Erfahrung bedingt? Kant könnte sagen, “Erfahrung ist insgesamt bedingt“ (u. a. KrV A111).
Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen: Anschau-ungen und Begriffen – empirisch, wenn mit Empfindung – rein, wenn frei von Empfindung. (nach KrV A50/B74)
Nun, was aber ist unrein, zufällig, empirisch an der Empfindung? Damit kann letztlich nur der rohe ungeordnete Stoff gemeint sein, den uns die Außenwelt über die Sinnesempfindung liefert. Dieser “Stoff“ als solcher ist jedoch nicht Inhalt unserer Erfahrung, d. h. er ist gänzlich unerkennbar, schon allein, weil er weder Zeitliches noch Räumliches zu bieten hat.
“Zu aller Erfahrung und deren Möglichkeit gehört Verstand, und das erste, was er dazu tut, ist nicht: daß er die Vorstellung der Gegenstände deutlich macht, sondern daß er die Vorstellung eines Gegenstandes überhaupt möglich macht.“ (KrV A199/B244)
Weder Begriffe ohne Anschauung noch Anschauung ohne Begriffe können Erkenntnis abgeben. (nach KrV A50/B74)
“Kategorien [...] sind nur Regeln für einen Verstand, dessen ganzes Vermögen im Denken besteht, d. i. in der Handlung, die Synthesis des Mannigfaltigen, welches ihm anderweitig in der Anschauung gegeben worden, zur Einheit der Apperzeption zu bringen, der also für sich gar nichts erkennt, sondern nur den Stoff zum Erkenntnis, die Anschauung, die ihm durchs Objekt gegeben werden muß, verbindet und ordnet.“
(KrV B145 – Original kursiv, “ordnet“ unsererseits hervorgehoben)
Wird durch jene Synthesis aus jenem “Stoff“empirischer Inhalt? Das kann kaum sein, denn das (Wesen des) Empirische(n) beruht auf Empfindung (KrV A20/B34) und nicht auf der synthetischen Handlung des Verstandes. Jener Stoff wird empirisch dadurch, dass er über die Sinne affiziert wird. Und was macht der Verstand? Nun, er ordnet! Was? Die empirischen Elemente! Wenn er diese aber ordnet, wären sie geordnet und darum nicht mehr empirisch zufällig! Eine ordnende Handlung zwingt (äußerlich) zu einer positiven Veränderung des zu ordnenden Stoffs, andernfalls macht jene Ordnung keinen Sinn.
Wo aber sagt Kant, dass der Verstand das Empirische ordnet? Nun, falls er dies (u. a. mit KrV B145) nicht direkt sagt, so doch indirekt, insbesondere dadurch, dass der Verstand der Natur die Ordnung diktiert (u. a. KrV A125-8, Prol. § 38). Dass Kant dabei Zickzack läuft, wie wir z. B. auf S. 55 und 75 angedeutet haben, ist im Kern die Folge der aktuellen Problematik (zudem → S. 83). Sobald der Verstand ordnend eingreift herrscht verstandesgemäße Ordnung – diese Ordnung wird Kant jedoch irgendwann höchst unbequem, spätestens dann, wenn es gilt das Empirische zu retten, ohne dass sein System in Gefahr gerät, seinen ihm typischen transzendentalen Charakter zu verlieren.
So muss Kant zähneknirschend die “[...] daß nä ich die Kategorien [...] die Gründe der Möglichkeit aller Erfahrung überhaupt enthalten.“
Mannigfaltige und Zufälligkeit seien hier noch kurz erwähnt:
Ist der Zufall bei Kant absolut zu verstehen, oder enthält jener Zufall ein gewisses Maß der Ordnung? Nun, Kant führt Zufälligkeit im Grunde als Gegenbegriff zu apriorischer Notwendigkeit (u. a. KrV B447), das scheint zunächst eine Art nicht-notwendiger Ordnung ein-zuschließen (was immer das wäre) und hätte demnach keinen abso-luten Bezug. Letztlich kommt Immanuel um jenes Absolute nicht umhin, da er andernfalls dem äußerlichen rohen Stoff und damit den Dingen an sich selbst ebenso eine gewisse Ordnung zukommen lassen müsste. Kants Transzendentaler Idealismus fordert hingegen definitiv die völlige prinzipielle Unbestimmtheit des Äußeren, der Dinge an sich selbst (u. a: KrV A42-3; B62; Prol. Erster Teil, Anmerkung II ).
“Raum und Zeit enthalten nun ein Mannigfaltiges der reinen Anschauung a priori [...]“ (KrV A77/B102)
“Die Synthesis eines Mannigfaltigen aber (es sei empirisch oder a priori gegeben), bringt zuerst eine Erkenntnis hervor, die zwar anfäng-lich noch roh und verworren sein kann und also der Analysis bedarf; allein die Synthesis ist doch dasjenige, was eigentlich die Elemente zu Erkenntnissen sammlet, und zu einem gewissen Inhalte vereinigt;“
(KrV A77-8/B103)
Kant inszeniert hier bedenkenlos eine Schöpfung – wo oder wer ist aber der eigentliche Schöpfer? Inhaltliche Schöpfung verlangt Voraus-Schau auf das Ganze, somit über das Einzelne hinaus. Kants Synthesis ist in diesem Sinne ein Einzelelement, wie das Mannigfaltige, wie das Empirische ... Kant ist daher nicht berechtigt ausschließlich mittels eines (oder mehrerer) Einzelelemente(s) die Summe jeweiliger Einzelelemente schöpferisch zu “einem gewissen Inhalt“ zu vereinen.
Die Aspekte Empirisch, Zufall, Mannigfaltige interessieren uns aber nur am Rande, wichtiger ist uns der folgende Begriff der Bedingung:
Hauptteil
Zunächst stellen wir nun einige allgemeine sachrelevante Theorie vor, die u. a. als Beweismaterial für die unsererseits unterstellte Doppelzüngigkeit und Widersprüchlichkeit im System Kants der darauffolgenden Diskussion dienen mag.
3 Bedingungen allgemein
“Bedingung (lat. conditio, engl./frz. condition) hat im philosophischen wie im alltäglichen Kontext keineswegs nur eine wohlbestimmte Bedeutung.“ (HISTORISCHES WÖRTERBUCH
DER PHILOSOPHIE, Band 1: A-C, 1971, Schwabe & Co, S. 762)
Es wird deshalb nötig sein, sich diesbezüglich nicht lediglich auf eine Quelle zu beschränken.
Bedingung, dasjenige, wovon ein anderes (das Bedingte) abhängt, was ein Ding, einen Zustand, ein Geschehen möglich macht, im Gegensatz zur Ursache, die etwas (die Wirkung, das Bewirkte) notwendig, unabänderlich hervorbringt, und zum Grund, der die logische B. der Folge ist. (nach Philoso-
phisches Wörterbuch, 1991, Alfred Kröner Verlag, 22. Aufl. S. 65-6)
In der Logik ist eine Aussage B von einer Aussage A abhängig, wenn es eine Ableitung von B aus A gibt bzw. wenn der Schluß von A auf B logisch gültig ist, d. h. wenn B aus A folgt. Andernfalls ist B unabhängig von A. (vereinfacht wieder-
gegeben, nach WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHI -
SCHEN BEGRIFFE, Felix Meiner Verlag, 2005, S. 3)
“Die logischen Verhältnisse, die der transzendentalphiloso-phischen Analyse zugrunde liegen, sind bis heute nicht vollständig geklärt.“ (Schüler-Duden, Die Philosophie, Bibliographisches Institut, Mannheim 1985, S. 63)
Das ist allerdings sehr schade, denn:
“Bedingung, bedingt. [In der reinen Erkenntnislehre handelt es sich stets nur um logische Bedingungen; erkennen heißt: ein Mannigfaltiges unter Bedingungen der Erkenntnis stellen und begreifen].“ (Ratke, H. Systematisches Handlexikon zur Kritik der reinen Vernunft, Felix Meiner Verlag, unveränderter Nachdruck 1965 der ersten Aufl. 1929, S. 27) Zu beachten ist bei diesem Zitat, dass die eckige Klammer nicht, wie man erwarten könnte, eine Einschiebung unsererseits ist, sondern im Original so auch erscheint. Möglicherweise wurde der zitierte Text in jener eckigen Klammer aus besonderen Gründen nachträglich von Verlagsseite (Felix Meiner) eingebaut.
“Logische Bedingungen sind solche, die sich unabhängig von der aktuellen Welt auf alle (rein logisch denkbaren) möglichen Welten und Lebewesen beziehen, während die natürlichen Bedingungen lediglich die aktuelle Welt mit ihren spezifischen physikalisch-biologischen Gesetzen einschließen. Dementspre-chend schließen die logischen Bedingungen die natürlichen mit ein, während eine Umkehrung dieser Aussage nicht möglich ist; d. h. es besteht eine ’epistemische Asymmetrie’ (Chalmers) zwischen logischen und natürlichen Bedingungen.“ (Quelle:
Internet, Prof. Dr. med. habil. Dr. phil. habil. Georg Northoff, Uni. Magdeburg)
(Zu “logische Bedingungen“ siehe auch KrV A249/B305-6,
A562/B590, Prol. § 39, teils zitiert → S. 29, 81)
“Bedingung (lat. ‚conditio’):
Im weitesten Sinne das, wovon etwas anders (das Bedingte) abhängt. Den Begriff ‚B.’ verwendet man in der Philosophie in verschiedenen Kontexten. Vielen Verwendungsweisen des Begriffs ist gemeinsam, daß sie mit der Form ‚weil B, daher A’ zusammenhängen; B bezeichnet hier die B. von A. Als hinreichende B . (lat. conditio per quam ) bezeichnet man den Vordersatz einer einfachen IMPLIKATION. Auch von den Prämissen oder ANTEZEDENTIEN einer logischen IMPLIKATION oder FOLGERUNG wird gesagt, daß sie als Bedingungen gelten. Der Nachsatz einer einfachen Subjunktion (materialen Implikation) wird als notwendige B . (lat. conditio sine qua non) bezeichnet. Notwendig und hinreichend ist eine Bedingung, wenn sowohl A → B als auch B →A (also A ↔ B) Geltung hat.
Auch in den Naturwissenschaften wird die Frage nach den Bedingungen gestellt; als Bedingungen werden meist Eigen-schaften von Situationen bezeichnet, wenn diese Eigenschaften vorliegen, haben bestimmte Ereignisse bestimmte Wirkungen; solche Bedingungen heißen Randbedingungen . Die Ereignisse, die unter den Randbedingungen bestimmte Wirkungen haben, nennt man Anfangsbedingungen.
Eine besondere Art der Analyse von Bedingungen findet man bei Kant und in der an Kant anschließenden Philosophie. Kant fragt nach den ‚Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis’ [...] B. meint hier eine Voraussetzung bzw. ein Vermögen, das erst die ERFAHRUNG ermöglicht; solche Bedingungen sind die ANSCHAUUNGSFORMEN, die Verstandesbegriffe [Kategorien] [...] und die Vernunftideen [...]“ (Alexander Ulfig, Lexikon der
Philosophischen Begriffe, Fourier Verlag, S. 52-3)
“Bedingung Dasjenige, was ein anderes möglich macht und wovon ein anderes (das Bedingte) abhängig ist. Man unterscheidet zwischen logischen und realen Bedingungen. Im logischen Sinne stellen z. B. die Prämissen eines Arguments die Bedingungen der gefolgerten Konklusion dar. Mit realen Bedingung sind entweder die Ursachen eines Ereignisses gemeint, oder die Randbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Ereignis eintreten kann. [...]
Unter einer >>Bedingung der Möglichkeit<< versteht Kant eine Bedingung, ohne die keine Erfahrung von Gegenständen möglich wäre. Kant, der zwischen dem Inhalt und der Form einer Gegenstandserfahrung unterscheidet, erklärt ein transzendentes Ding an sich zur Ursache des Inhalts der Erfahrung. Ein jenseits des Subjekts liegendes Ding an sich übt einen kausalen Einfluss auf den Wahrnehmenden aus, [eine sehr kontroverse Äußerung] was zur Folge hat, dass er bestimmte qualitative Erfahrung hat. Damit aus diesem Inhalt die Erfahrung eines Gegenstandes wird, muss der Inhalt eine bestimmte Form erhalten. Kant unterscheidet zwi-schen Formen der Anschauung und Formen des Verstandes. [...]
[Und jetzt bitte sehr gut aufgepasst!] Als wesentliches Unter-scheidungskriterium zwischen notwendigen Bedingungen und Bedingungen der Möglichkeit gilt die Tatsache, dass Bedin-gungen der Möglichkeit zu ihren Gegenständen in keinem Verursachungsverhältnis stehen, [!] während ein solches Ver-hältnis bei den notwendigen Bedingungen nicht ausgeschlossen ist.“ (Handwörterbuch Philosophie, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, S. 268-9, interne Querverweise haben wir ausgelassen)
Eine andere Quelle behauptet hingegen:
“Notwendige und hinreichend Bedingungen drücken keinen inhaltlichen Zusammenhang aus, d. h. sie sagen nichts über die Natur und Ursache des Zusammenhangs zwischen Bedingung und Bedingtem aus: Ob das Bedingte logische Folge ist, ob die Bedingung das Bedingte kausal verursacht oder ob irgendein anderer (oder gar kein) inhaltli-cher Zusammenhang zwischen Bedingung und Bedingtem besteht, bleibt offen. [Im Original werden sodann einige Beispiele angeführt, die wir uns hier schenken, aber es wird schließlich nochmals bekräf-tigt:] Vor allem letzteres Beispiel zeigt deutlich, dass hinreichende und notwendige Bedingung keinen inhaltlichen Zusammenhang aus-drücken [.] “ (Quelle: Internet, Wikipedia, der freien Enzyklopädie, Autor unbekannt)
Nun gut, ungeachtet einiger spezieller Unstimmigkeiten ist immerhin klar, dass es sich im aktuellen Kontext um “logische“ Bedingungen handelt, Kant selbst bestätigt uns dies:
“Die Kategorien [...] sind ihrerseits wiederum nichts als Ge-dankenformen, die bloß das logische Vermögen [!] enthal-ten, das mannigfaltige in der Anschauung Gegebene in ein Be-wußtsein a priori zu vereinigen [...]“ (KrV A249 /B305– Original kursiv)
“Das Wesentliche aber in diesem System der Kategorien, [...] besteht darin: daß vermittelst desselben [.] die wahre Bedeutung der reinen Verstandesbegriffe und die Bedingung ihres Gebrauchs genau bestimmt werden konnte. Denn da zeigte sich, daß sie vor sich selbst nichts als logische Funktionen sind [!] , als solche aber nicht den mindesten Begriff von einem Objekte an sich selbst ausmachen, sondern es bedürfen, daß sinnliche Anschauung zum Grunde liege [...]“ (Prol. § 39)
(Hier zeichnet sich bereits eine gewisse Gefangenschaft im Bereich des Allgemeinen ab, → S. 85, – und ausgerechnet sinnliche Anschauung, sollte jenes Eisen aus dem Feuer reißen (→ u. a. S. 199, 201, 207-9)?
Das weckt Zweifel (u. a. zu S. 69, untere Hälfte): werden die Erfahrungsinhalte wirklich durch die Kategorien gegeben?
Nun, Kategorien und der Verstand überhaupt, hätten ja auch lediglich eine “ordnende“ und keine “inhaltliche“ Funktion:
“[...] und so ist der Verstand der Ursprung der allgemeinen Ordnung der Natur, indem er alle Erscheinungen unter seine eigene Gesetze faßt, und dadurch allererst Erfahrung (ihrer Form nach) a priori zu Stande bringt, [...]“ (Prol. § 38)
“Die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein [...]“ (KrV A125
– Original kursiv)
Ganz so (inhaltlich-) harmlos, wie oben (unsererseits) sugge-riert, sind die Kategorien letztlich wohl doch nicht:
“Ob nun aber gleich diese Verstandesregeln nicht allein a priori wahr sind, sondern sogar der Quell aller Wahrheit, d. i. der Übereinstimmung unserer Erkenntnis mit Objekten, dadurch, daß sie den Grund der Möglichkeit der Erfahrung, als des Inbegriffes aller Erkenntnis, darin uns Objekte gegeben werden mögen, in sich enthalten, [...]“ (KrV B295/A237)
Ähnlich argumentiert Kant auch zu apriorischen Anschau-ungsformen, wobei einmal mehr deutlich wird, dass Kant hierzu (entgegen entspr. Zitate) aus bloßer Möglichkeit einen kausalen inhaltlichen Zusammenhang ableitet:
“Denn daß Gegenstände der sinnlichen Anschauung denen im Gemüt a priori liegenden formalen Bedingungen der Sinnlichkeit gemäß sein müssen, ist daraus klar, weil sie sonst nicht Gegenstände für uns sein würden; [...]“ (KrV A 90/B122-3)
“Die Möglichkeit der Erfahrung überhaupt ist also zugleich das allgemeine Gesetz der Natur, und die Grundsätze der erstern sind selbst die Gesetze der letztern. Denn wir kennen Natur nicht anders, als den Inbegriff der Erscheinungen, d. i. der Vorstellungen in uns, und können daher das Gesetz ihrer Verknüpfung nirgend anders, als von den Grundsätzen der Verknüpfung derselben in uns, d. i. den Bedingungen der notwendigen Vereinigung in einem Bewußtsein, welche die Möglichkeit der Erfahrung ausmacht, hernehmen. [...] die oberste Gesetzgebung der Natur [ist] in uns selbst, d. i. in unserm Verstande [...]“ (Prol. § 36)
Diese “Ermöglichung” und dieses “Ordnen der Natur“ hat bei Kant eine ganz außerordentliche Konsequenz, die er selbst allerdings offenbar völlig ignoriert: Der Verstand bestimmt die Gesetzmäßigkeit der Natur (KrV A125-7/B163-5, Prol. § 38, § 36 ). Diese scheinbar harmlose Feststellung bedeutet jedoch, dass der Verstand auch alle Inhalte der Erfahrung bestimmt. Denn all solche Inhalte sind, gemäß Kant, siehe oben, direkt von der Gesetzgebung der Natur, die ultimativ dem Verstand unterstehen, abhängig. Und exakt in diesem Sinne behandelt Kant die Kategorien quasi als Ursachen, auch wenn er sich, bewusst oder unbewusst, alle Mühe gibt diese Hypothese unse-rerseits zu entkräften. (Denn, wie aus Zitaten, → S. 56, 59, 80, 95-8, hervorgeht, handelt Kant die Dinge an sich selbst, über die empirische Anschauung, als diesbezügl. offizielle “Ursache“.)
Zudem verstößt Kant hier gegen eine seiner grundsätzlichsten Behauptung: Kategorien betreffen lediglich das Allgemeine, also nicht das Individuelle, (KrV A25/B40, A68-9/B93-4, A113, A320/B377). U. a. nach Prol. § 36 aber zerstört er deren allgemeinen gesetz-lichen Charakter mit einem Schlag, bzw. wird das Gesetzlich-Notwendige und Allgemeingültige zum Individuellen, und damit zum Empirischen, willkürlich und völlig unlogisch degradiert.
Hier sind ganze Berge von Widersprüchen involviert, vor allem: An sich inhaltlose, rein formale, logische Kriterien werden, wie soeben kurz erörtert, durch die Hintertür schlei-chend zu Inhalten (oder Inhaltsgebern) missbraucht.
Damit der Inhalt der uns affizierenden Dingen an sich selbst erfahrbar wird, muss jener Inhalt eine bestimmte Form erhalten, nach den apriorischen reinen Formen der Anschauung nebst den formalen Bedingungen der Verstandeskategorien. Dergestalt wird jedoch bei Kant unweigerlich die Form zum eigentlichen Inhalt konvertiert. Denn die Welt die wir sodann erfahren agiert gemäß ihrer Form, akkurat jener Form, die ihr von subjektiver Seite angeblich aufgezwungen wird. Dinge verhalten sich allgemein aber gemäß ihres Inhaltes, nicht nach ihrer formalen Erscheinung. Wenn sich Dinge hingegen entsprechend ihrer Form verhalten, so kann dies letztlich nur bedeuten, dass jene Form, entgegen Kant, den tatsächlichen Inhalt darstellt.
Das macht deutlich, dass Kant die reinen Verstandesbegriffe nicht lediglich als logische, wenn auch notwendige, Bedingungen der Erfahrung gebraucht (also entgegen Prol. § 39, KrV B305/A249).
Denn, wie zuvor erörtert, geht es in der Logik nicht um inhaltliche, als lediglich um formale Zusammenhänge. Kant macht indes inhaltliche Kriterien der Erfahrung von formalen abhängig – vor allem inhaltlich! – und das ist ein ganz kapitaler Fehler. Somit wird es verständlich, dass Kant von der Vernunft als Quell der Ideen (Prol. § 42), von subjektiven Quellen der Möglichkeit der Erfahrung (KrV A97), usw. redet und gar den Verstand als eigentlichen Urheber der Erfahrung erklärt (KrV B127/A94) – alles Aussagen mit eindeutig inhaltlicher Bedeu-tung – so jedenfalls unsere diesbezügliche Hypothese – den Kant allerdings nie offen zugibt – nicht zugeben kann (!) da er andernfalls seinen Dualismus zwischen einerseits verursachen-den Dingen an sich selbst, des inhaltlich ungeordneten, rohen Stoffs der Erfahrung, und andererseits der, jenem ungeordneten rohen Stoff die nötige Form gebenden, subjektiven Bedin-gungen der Möglichkeit der Erfahrung zerstört.
“Der Verstand steuert also einen wesentlich größeren Teil zur Erkenntnis bei als die Sinnlichkeit [...]“ (Philosophisches
Wörterbuch A-K, Leitung: Manfred Buhr, S. 361)
Und Erkenntnis handelt von Inhalten und nicht lediglich von formalen äußeren logischen Aspekten. Das wiederum setzt, wie gesagt, die unterstellte rein logische Basis der subjektiven Bedingungen zur Ermöglichung der Erfahrung Kants generell in Frage. Erfahrung ist empirischer Natur und demnach wären entsprechend empirische Gesichtspunkte zu berücksichtigen, u. a. Wechselwirkungen und der Satz zur Erhaltung der Energie.
“Wechselwirkung findet auch im Erkenntnisprozeß zwischen dem Objekt und Subjekt der Erkenntnis statt.“ (Philosophisches Wörterbuch, Band 2, Leitung Manfred Buhr, S. 1285) (vergl. unser Buch S. 115)
Kants Art und Weise wie er Bedingungen im erkenntnistheo-retischen Kontext einsetzt ist prinzipiell korrupt und unzulässig.
Ziemlich parallel dazu behandelt er Gesetzliche Mittel, allem voran freilich die apriorischen subjektiven Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, namentlich die Verstandeskatego-rien und reinen Anschauungsformen, in unzulässiger, sich deutlich widersprechender Weise – teils (d. h. offen) mit allgemeinem -, teils (d. h. verdeckt) mit individuellem Bezug:
Zum einen sollen die Kategorien lediglich allgemeinen Charakter haben (u. a. KrV B4, B93) zum anderen stellt Kant jedoch die Erfahrung absolut exakt unter jene Kategorien (u. a. KrV A125-7, B163-5, Prol. § 36, § 38) womit Letztere in Kantscher Manier unweigerlich inhaltlich ins Individuelle übergreifen und sodann das Einzelne nicht lediglich äußerlich formen sondern auch dessen Charakter, Inhalt und Funktion diktieren (→ S. 86ff).
Wenn das Individuelle jedoch völlig durch allgemeine apriorische subjektive Bedingungen bestimmt wird, so hat (bzw. hätte) dies zwangsläufig die Folge, dass jenes bedingte Individuelle nicht über das Allgemeine reicht und deshalb gänzlich im allgemeinen Bereich hängen bleibt.
Kant (wie freilich auch Berkeley) hat generell erhebliche Schwierigkeiten das Individuelle der Erfahrung zu begründen. Unter dem aktuellen Gesichtspunkt ist das kaum verwunderlich.
Denn die Allmacht der Allgemeinheit der Kategorien ist (u. a. gemäß KrV A125-7, B163-5, Prol. § 36, § 38) zunächst so radikal, dass sie zur völligen Ohnmacht wird und das Individuelle der Erfahrung im Grunde verbietet. Das aber hält selbst Kants System nicht aus – notgedrungen muss entsprechend einiges wieder zurückgepfiffen werden (→ S. 75). Mit jenem Rückzug öffnet Kant scheinbar wieder die Tür zum Individuellen – der Preis allerdings: die Beziehung Allgemeines – Einzelnes gleitet sodann endgültig ins märchenhaft Mysteriöse ab.
Dazu werden wir noch zusätzlich Stellung beziehen. Doch vorab wäre es vorteilhaft sich von zuvor erwähnten klassischen Kriterien der Bedingung etwas zu lösen. Statt Begleitbedingungen, Randbedingungen, logischer -, hinreichender -, notwendiger Bedingungen usw. wird nach-folgend schlicht zwischen Rahmen- und Kernbedingungen differenziert:
4 Verschiedene Arten von Bedingungen
Bedingungen spielen in Kants Erkenntnistheorie eine heraus-ragende, alles entscheidende Rolle. Was genau aber bedeutet hier “alles entscheidende“. Jedes Glied einer Kette spielt eben-falls eine “alles entscheidende“ Rolle. Fast jede Schraube am space shuttle, die Luft in den Reifen eines Rennwagens oder das Wetter beim Camping – das alles sind ausschlaggebende Fakten und Bedingungen, ohne die in den zugehörigen Fällen praktisch nichts geht. Rechtfertigt die Art solcher Bedingungen jedoch irgendwelchen inhaltlichen Bezug zum Bedingten?
Nun, bei Kant geht nichts ohne subjektive Bedingungen:
“[…] da Erfahrung Erkenntnis durch verknüpfte Wahrnehmungen ist, so sind die Kategorien Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, und gelten also a priori auch von allen Gegenständen der Erfahrung.“ (KrV B161 – Original kursiv)
“[...] weil, ohne solche, [den Grundsätzen des Verstandes] den Erscheinungen niemals Erkenntnis eines ihnen korrespondierenden Gegenstandes zukommen könnte.“ (KrV A159/B198)
Daraus folgert Kant:
“Kategorien sind Begriffe, welche den Erscheinungen, mithin der Natur, als dem Inbegriffe aller Erscheinungen [...], Gesetze a priori vorschreiben [...].“ (KrV B163 – Original kursiv)
Das ist höchst fragwürdig! Denn an diesem Punkt geht Kant schlagartig dazu über aus einer simplen Bedingung der Möglichkeit ein absolutes und demnach auch inhaltliches Abhängigkeitsverhältnis herzustellen !
Und das hat für Kant unweigerlich die Folge, dass seine Kategorien sich entgegen KrV B4, B93/A68, B377/A320 auf das Einzelne und nicht lediglich auf das Allgemeine beziehen! (Details dazu u. a. → S. 75,
82-5, 101ff, 157-8)
Dass ich einen Ausruf – schmeichelnd oder beleidigend – eines Passanten oder Nachbarn verstehe bedingt, dass ich im Zimmer ein offenes Fenster habe. Nach Kant, müsste ich sodann, nebst dem Ausruf, das Fenster sozusagen zwangsläufig mithören (!) – nicht lediglich quantitativ (d. h. störend), sondern vor allem qualitativ, inhaltlich. Mit Immanuel wäre jener Ausruf ohnehin streng genommen ungültig, da ich ihn ja lediglich “bedingt“ höre (Fenster, Ohren, ...) und also unmöglich wissen kann, was er wirklich besagt!
Gerade relativ hoch entwickelte technische Aspekte bestehen fast ausschließ-lich aus zahllosen großen wie kleinen Bedingungen. Würde im Sinne Kants der Charakter eines solchermaßen bedingten technischen Aspektes grundsätzlich durch jede einzelne Bedingung inhaltlich geprägt, könnte er kaum einen ganz bestimmten, eigenen Charakter aufweisen. Überhaupt übersieht Kant, dass sich die Wirkungen einzelner Bedingungen in einem bedingten Gesamtkomplex überlagern und gegebenenfalls gegenseitig aufheben. Ein weißer Lichtstrahl der durch den Einfluss einer blauen Linse (Blaufilter) blau erscheint, verliert diese Eigenschaft – erscheint grün – wenn man ihm zusätzlich eine gelbe Linse (Gelbfilter) vorsetzt. Eine vollständige additive Farbenmischung ergibt nicht “alle Farben“, sondern ganz im Gegenteil: ergibt farbloses Weiß. Ein Komplex der schwere wie leichte Bedingungen aufweist, ist letztlich nicht schwer “und“ leicht, sondern – keines von beiden – er ist schwebend. Ganz ähnliche Effekte sind beispielsweise in der Akustik bekannt.
Der folgende Punkt ist in unserer Diskussion von höchster Bedeutung, den wir kaum deutlich genug herausstellen können:
Kant macht insbesondere gemäß der erwähnten Zitate (KrV B197/A158, B161-3) im erkenntnistheoretischen Stand alles von einem spezifischen Gedankengang abhängig, in der Art:
Nur wenn bestimmte subjektive apriorische Bedingungen erfüllt sind ist Erfahrung möglich – kurz:
Nur wenn A dann B.
Daran ist soweit nichts auszusetzen – das ändert sich jedoch sehr schnell mit dem nächsten Schritt:
Erfahrung ist grundsätzlich in jeder Beziehung, vor allem also auch inhaltlich, von den jeweiligen subjektiven apriorischen Bedingungen völlig bestimmt – weil ohne A kein B.
Spätestens an dieser Stelle ergibt sich die Frage, inwiefern Kant nicht relativ einfache, aber entscheidende logische Prinzipien schlicht über den Haufen wirft:
Nur wenn A dann B, bedeutet unbestreitbar: ohne A kein B. Es besagt hingegen keineswegs, dass wenn B existiert, Elemente von A zwangsläufig in B vorhanden wären.
Sogenannte “wenn – dann“ Sätze, die Engländer würden sagen “if – then“ statements as cases of “material implication“, gelten mit gutem Grund in der Logik als relativ schwache Relationen die keine kausale Verbindung zwischen Bedingung und Bedingtem beschreiben, sondern sich lediglich auf eine Rang-, bzw. Reihenfolge beschränken, ohne Elemente der Bedingung mit Elementen des Bedingten im mathematischen oder chemischen Sinne zu verknüpfen.
Kant behandelt einen bedingten Aspekt B grundsätzlich als Teilmenge eines entsprechend bedingenden Aspektes A (oder umgekehrt) augenscheinlich allein begründet durch die Bedingung:
Nur wenn A dann B.
Tatsächlich geht jedoch aus einer logischen Konstellation der erwähnten Form: nur wenn A dann B (material implication) weder hervor, dass Elemente von B gleichzeitig Elemente von A sind, noch, dass Elemente von B gleicher Natur oder überhaupt gleich zu denen von A sein müssten.
Fasst man hingegen, wie Kant, B als Teilmenge von A (oder umgekehrt) auf, so stellt sich die Frage wie kann B von A Elemente materiell übernehmen, ohne dass A dadurch verändert wird – ohne dass A inhaltliche Elemente einbüßt. Denn ein Geben ist, praktisch wie rein theoretisch, generell mit einem prinzipiellen Substanz-Verlust verbunden von Seiten des Gebers.
Dass alle unsere Erscheinungen der Erfahrung und alle potentiell menschlich nur irgend möglichen Vorstellungen inhaltliche Elemente aus unseren subjek-tiven apriorischen Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung erhalten, stellt Kant quasi als einen selbstverständlichen, an sich relativ unproblematischen Grundpfeiler seines ganzen Systems dar. Wir sind hingegen dabei zu beweisen, dass exakt jene scheinbar selbstverständliche Unterstellung keineswegs problemlos, sondern letztlich gar unmöglich ist. Dass Kant überhaupt Bedingungen in Form subjektiver Gesetze verdeckt als Quellen von Erfahrungs-inhalten wertet, ist ohnehin ein kapitaler Fehler. Denn Gesetze haben im Grunde pauschalen Charakter und beziehen sich bestenfalls mittels bestimmter äußerer Fakten auf Einzelfälle – nicht aber aufgrund des Gesetzes an sich (→ u. a. S. 30-1, 94, 158). Zudem haben Gesetze in diesem Licht keine erzeugende, als lediglich eine ordnende Wirkung, sie können vor allem das zu Ordnende nicht erzeugen indem sie es ordnen, bzw. sie können das Bedingte nicht dadurch erzeugen indem sie es bedingen. Man kann nur eine bereits bestehende Sache ordnen. Kant versucht hingegen etwas zu ordnen das noch gar nicht existiert, sondern quasi erst durch den Akt der Ordnung geschaffen wird (→ u. a. S. 25, 109, 165-6) – das ist in unseren Augen kaum zu überbietender, unlogischer Unfug.
Man könnte alle Arten von Abhängigkeiten kategorisch zunächst grob in äußere “Rahmenbedingungen“ (die lediglich eine potentiell bestehende Sache “durchschalten“ oder relativ äußere notwendige Umstände schaffen, ohne jedoch im Mindesten “innerlich“ auf die bedingte Sache an sich einzuwirken) und innere verhältnismäßig einmalige “Kernbe-dingungen“ (die teilweise oder ganz etwas tatsächlich erzeugen) unterteilen.
5 Rahmenbedingungen
Zunächst einige Beispiele für Rahmenbedingungen:
Das Füllen eines Wassercontainers mag aus bestimmten Gründen nur über spezielle Rohre möglich sein. Diese erfüllte oder nicht erfüllte äußere Bedingung hat jedoch keinen qualitativen Einfluss auf das zu erwartende Produkt, in diesem Falle: Ein Container voll Wasser.
Eine Demonstration wird in der Regel erst dadurch ermög-licht, dass die zuständigen Behörden eine solche genehmigen. Eine solche Genehmigung kommt jedoch auch in diesem Beispiel keineswegs einer generellen Beeinflussung gleich. Wie diese Demo letztlich verläuft, hängt im Wesentlichen von den Teilnehmern und den begleitenden Umständen ab, jedoch definitiv nicht von den Behörden die lediglich grünes oder rotes Licht zu einer solchen Aktion insgesamt gegeben haben mögen.
Eine bestimmte Kraftübertragung von einem Gegenstand auf einen anderen mag nur möglich werden durch den Einsatz einer geeigneten Kette. Ketten oder deren einzelne Glieder haben jedoch grundsätzlich keinen qualitativen Einfluss auf die involvierten Kräfte, auch wenn sie im konkreten Fall eine Kraftübertragung erst möglich machen sollten und die maximal übertragbare Kraft sich aus der Festigkeit der Kette ergibt.
Die Funktion einer elektrischen Maschine hängt vollständig davon ab, ob sie eingeschaltet ist oder nicht. Ein vorgelagerter Schalter, etwa ein Hauptschalter, hätte hier eine unerlässliche Aufgabe zu erfüllen: alles oder nichts! Doch es wäre grotesk anzunehmen, jener Schalter würde das beeinflussen, was die Maschine im Detail macht, vor allem auch, weil die funktionalen Inhalte jener Maschine weit über die relativ simple Ein/Aus-Funktion des Hauptschalters reichen. Jener Schalter (oder im Extremfall ein aufwendiges System verschiedenster Schalter) ermöglicht lediglich, dass jene Maschine überhaupt im Ganzen funktionieren kann, ohne jedoch im Mindesten in dessen Funktionsweise an sich einzugreifen. Jener Schalter bestimmt lediglich ob jene Maschine läuft oder eben nicht läuft. Dass eine Maschine läuft oder nicht läuft ist jedoch im Grunde völlig irrelevant zu der Frage “wie“ sie läuft (wenn sie läuft).
Ereignisse dieser Art mit äußeren sogenannten Rahmen-bedingungen sind durchweg beliebig wiederholbar, bzw. stellen relativ dauerhafte, äußere Konditionen her unter denen bezügliche Handlungen ablaufen. Sie haben lediglich einen scheinbaren Einfluss auf das Bedingte, das heißt, sie wirken lediglich insofern sie eine bereits potentiell vollständig vorliegende Sache zur existentiellen Realität verhelfen, ohne den Charakter dieser bedingten Sache an sich selbst auch nur im Mindesten zu beeinflussen.
6 Kernbedingungen
Kernbedingungen haben hingegen nachfolgenden qualita-tiven inneren schöpferischen Einfluss und sind ausnahmslos an relativ einmaligen Ereignissen, bzw. an ganz bestimmte Aspekte gebunden, wie beispielsweise bestimmte atomare Bindungen. Ein Wassermolekül etwa bedingt drei Atome, zwei des Wasserstoffs und eins des Sauerstoffs. Eine solche Bindung erlaubt es den involvierten einzelnen Atomen nicht für weitere vergleichbare Bindungen zur Verfügung zu stehen.
Süße oder saure Getränke und Speisen benötigen bestimmte Stoffe wie Zucker, Salz, Säuren oder Laugen, die sich auflösen oder aufspalten und sich dadurch selbst verändern, bzw. von dem Bedingten regelrecht aufgesaugt und damit relativ dauer-haft beschlagnahmt werden, und also jene Bedingungen für andere Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen können.
Letztlich ist gar jede Art des Messens oder generell jede Beobachtung an Bedingungen geknüpft, die mit wissenschaft-lich penibler Überlegung (Heisenberg) zwangsweise eine Wechselwirkung zwischen Objekt und Subjekt zur Folge hat, wodurch Messen und Beobachten an und für sich relativ einmalige subjektive Vorgänge darstellen. Es gibt demnach, streng genommen weder ein objektiv einwandfreies Messen noch ein rein passives (und doch bewusstes) Beobachten.
Bewusstes Beobachten, besonders im atomaren Bereich, ist notwendigerweise mit Einfluss auf das beobachtete Objekt verbunden. Daraus ließe sich die Folgerung ableiten (die später, in Kapitel 11, noch eine Rolle spielen wird):
Ist eine Beeinflussung des Beobachters auf das beobachtete Objekt aus dem einen oder anderen Grunde prinzipiell nicht möglich, so kann das beobachtete Objekt nicht gefühlt -, nicht bewusst erlebt werden. Die Tatsache, dass wir durch die Welt beeinflusst werden, beweist, dass wir real existieren.
Erfüllte Kernbedingungen haben jedenfalls im Gegensatz zu bloßen Rahmenbedingungen generell unmittelbare, inhaltliche Konsequenzen: Sie wirken direkt auf die abhängige Sache, was zudem, wegen unvermeidlicher Wechselwirkungen zwischen Kernbedingung und abhängiger Sache, rückwirkend Konse-quenzen auf die jeweilig erfüllten Kernbedingungen selbst hat.
Chemische Bindungen mögen im Ganzen von sehr vielen verschiedenen äußeren Faktoren abhängen. Tatsächlich gestaltender innerer Einfluss geht jedoch in der Chemie nur von ganz bestimmten relevanten einzelnen Faktoren aus, die sodann an die abhängige Sache, relativ zu ihrer Wirkung, mehr oder weniger bleibend gebunden sind.
Der überwiegende Teil der Chemie und der Mathematik bewegt sich wohl ausschließlich im Bereich von Kernbedingungen, während physikalische Aspekte, Temperatur, Luftdruck usw. diesbezüglich gegebenenfalls äußere Rahmenbedingungen wären.
Das innere Gefüge eines Wassermoleküls, hingegen, hängt sehr wesentlich von den elementaren Teilen des Sauerstoffs und des Wasserstoffs ab, was, in unserer speziellen Betrachtung, eine Kernbe-dingung darstellt, und den ursprünglichen relativ freien Status dieser beiden Atome in einer solchen Bindung dauerhaft verändert.
Natürliche Gesetze, Regelungen, willkürliche menschliche Ordnungs-maßnahmen, usw. sind wiederum, generell doch eher Vorgaben in Form von Rahmenbedingungen.
7 Wechselwirkungen, Gesetze, Ding an sich
Vorneweg ließe sich somit sagen, dass Abhängigkeiten lediglich dann auf eine bestimmte abhängige Sache einen bestimmten inneren, charakterlich führenden Einfluss haben, wenn sie sich aktiv am inneren Geschehen beteiligen.
Dadurch wären jedoch Wechselwirkungen grundsätzlich unvermeid-bar. Das bedeutet, dass in diesem Fall eine Wirkung von Seiten der Bedingungen auf eine entsprechend abhängige, gegebene Sache aus-geht und umgekehrt, was notwendigerweise zu mehr oder weniger starken Veränderungen auf beiden Seiten führen muss. Diese Verände-rungen auf beiden Seiten kommen praktisch einer gewissen Selbstauf-gabe der beteiligten einzelnen Komponenten gleich. Eine Kraft kann beispielsweise nur auf eine weitere Kraft einwirken, indem sie ihre ursprüngliche Identität im Verhältnis zur korrespondierenden Wirkung aufgibt. Je öfter und je intensiver sie wirkt umso mehr verliert sie ihre ursprüngliche Identität – was generell ein besonderes Merkmal aller Kernbedingungen zu sein scheint!
Auf Kant übertragen bedeutet dies, dass die Kategorien als notwen-dige Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt entweder rein äußerlich auf ein Ganzes wirken (Rahmenbedingungen), ver-gleichbar mit der üblichen Funktion eines Kettengliedes, eines Hauptschalters oder eines Wasserrohrs, wobei in diesem Falle kein inhaltlicher Einfluss der Kategorien auf die zugehörigen Sinnesinter-pretationen zu erwarten wäre – oder aber:
Geht man hingegen, davon aus, dass die Kategorien (und Anschauungsformen) direkten Einfluss auf unsere Sinnesinter-pretationen haben (weil wir z. B. gemäß KrV B163 die Natur bestimmen) so würde der Einfluss der Kategorien diese Kategorien letztlich selbst beeinflussen und verändern, so wie eine Kraft, die eine Wirkung auf eine zweite Kraft ausübt, gezwungenermaßen durch ihre eigene Wirkung bzw. durch die in diesem Falle unvermeidlichen Wechselwirkungen, zumindest teilweise, selbst verbraucht und verändert wird, was in relativ kurzer Zeit bei wiederholter Anwendung zu immer größeren Veränderungen und schließlich zum völligen Verbrauch der Kategorien selbst führen müsste. Das heißt, die Kategorien würden im Fall, da sie inhaltlich mitwirken, bestenfalls nur relativ einmalig wirklich funktionieren, vergleichbar mit einer mehr oder weniger heftigen chemischen Reaktion oder mit der Wirkung verschiedener aufeinander treffender Kräfte, die ebenfalls relativ einmalige Ereignisse darstellen.
Kant geht indes, aus unserer Sicht, vom praktisch wie theoretisch Unmöglichen aus, nämlich, dass die Kategorien beeinflussen bzw. inhaltliche Wirkung auf unsere bedingten bewusst wahrgenommenen Sinnesempfindungen übertragen, ohne dadurch selbst rückwirkend beeinflusst zu werden. Anders formuliert: Kant vergisst augenfällig, dass ein Geben unweigerlich mit einem Verlust von Seiten des Gebenden zugunsten des entsprechend Begünstigten verbunden ist.
Eine wirkende und damit sich selbst verbrauchende Kraft kann selbstverständlich ihre ursprüngliche Stärke wieder gewinnen, andernfalls wäre natürliches Leben kaum möglich – wir benötigen dazu vor allem Nahrungsmittel und Sauerstoff. In der Technik verbrauchen Motoren zu diesem Zweck üblicherweise Chemie (Benzin, Öl, Gas) oder Physik: (Sonne, Wind, Gezeiten, Gewichtskraft des Wassers, usw. → elektr. Strom). Dieses kontinuierliche Geben und Nehmen hat indes die Folge, dass die wirkende Kraft stets mehr oder weniger schwankt und keinen absolut fixen Wert annimmt, weder im Bereich des Gebens noch des Nehmens. Gesetze sind hingegen generell fixer Natur – ein schwankendes Gesetz wäre vergleichbar mit einem eckigen Kreis – ein Unding!
Kant versäumt es, uns zu erklären, was die fixe Natur der aktiv wir-kenden subjektiven Gesetze garantiert. Sollte er hingegen davon ausge-hen, dass jene Gesetze lediglich passiv, bzw. negativ wirken (quasi als Rahmenbedingungen) so wäre er nicht berechtigt zu behaupten, dass unsere individuelle körperliche Struktur, speziell unsere subjektiven apriorischen Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung irgendwel-chen inhaltlichen Einfluss auf unsere Erscheinungen ausüben würde(n).
“Der reine Verstand ist also in den Kategorien das Gesetz der synthetischen Einheit aller Erscheinungen, und macht dadurch Erfahrung ihrer Form nach allererst und ursprünglich möglich.“
(KrV A128 – Original kursiv)
Mit jenem soeben zitierten “möglich machen“ deutet Kant bereits in Kurzform die Strategie seines Hauptfehlers an:
Die Kategorien sind jeglicher Erfahrung zwingend vorgelagert, darum richtet sich unweigerlich alle nachfolgende Erfahrung nach jenen Kate-gorien – ein offenbar einleuchtender Sachverhalt, hinter dem sich nichts-destoweniger ein schwerwiegender prinzipieller Fehler verbirgt. Denn etwas zu ermöglichen (wie auch der Aspekt “weil ohne ...“ → S. 110) bein-haltet keineswegs automatisch etwas zu beeinflussen. Ein Hauptschalter ermöglicht die Funktion einer Maschine, ohne jedoch im Geringsten in die Funktion dieser Maschine einzugreifen (weitere Beispiele: S. 101-2).
Genau genommen macht Kant nicht einen Hauptfehler, wie soeben behauptet, sondern mindestens zwei: zum einen sieht er ein (erkenntnis-theoretisches) Abhängigkeitsverhältnis fälschlich im absoluten Licht, mit nachfolgend zwangsläufiger inhaltlicher Prägung: Zum anderen handhabt er Gesetze gerne mit nicht minder absoluter Bedeutung – ohne Spielraum und folglich mit (scheinbar) zwangweiser inhaltlicher Gültigkeit bis in jedes Detail des Individuellen bei gleichzeitig pauschalem allgemeinem Bezug. Dass er dabei ganz grundlegende Prinzipien radikal übersieht geht bereits aus dem kommenden Zitat hervor:
“Ein Gesetz bezieht sich stets auf eine ganze Klasse von Objekten, [S. 882]“ [Damit ist einerseits zwar allgemeiner inhaltlicher Bezug gesichert, indivi-dueller jedoch ausgeschlossen (Kant aber will beides)! Daraus ergibt sich zwangs-weise ein gewisser Spielraum (den Kant ignoriert) der dem Gesetzlichen generell (über “statistische“ Aspekte hinaus) zukommt! (→ u. a. S. 30-1, 88, 158, 193ff)]
Das dialektische Verhältnis von Notwendigkeit und Zufall zeigt sich besonders eindrucksvoll im Wirken statistischer Gesetzmäßigkeiten . Ein statistisches Gesetz beschreibt das notwendige Verhalten einer Gesamtheit von Objekten unter bestimmten Bedingungen; wie sich in dieser Gesamtheit ein einzelnes Objekt verhält, ist im Rahmen dieser Bedingungen und der durch die Notwendigkeit des Gesetzes abgesteckten Grenzen zufällig. So zerfällt z. B. ein radioaktives chemisches Element nach dem Gesetz [...] Wann ein bestimmtes Atom dieses Elements zerfällt, ist im Rahmen dieses Gesetzes zufällig [S. 883] .“
(Philosophisches Wörterbuch, Leitung: Manfred Buhr, S. 882-3)
Jener Auszug macht vor allem die generelle beschränkte Reichweite von Gesetzen und Bedingungen deutlich, sowie den ausschließlich nega-tiv wirkenden inhaltlichen Einflussbereich einer (Rahmen-)Bedingung.
Dass Kant indes den soeben grob-angedeuteten Sachverhalt im Grundgefüge völlig auf den Kopf stellt und sodann jenen Kopfstand zum Gerüst für seine gesamte Erkenntnistheorie erhebt, geht schon aus den folgenden Worten hervor:
“Wir haben also sagen wollen: daß alle unsre Anschauung nichts als die Vorstellung von Erscheinung sei: daß die Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre Verhältnisse so an sich selbst beschaffen sind, als sie uns erscheinen, und daß, wenn wir unser Subjekt oder auch nur die subjektive Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Verhältnisse der Objekte im Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden würden, und als Erscheinungen nicht an sich selbst, sondern nur in uns existieren können. Was es für eine Bewandtnis mit den Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser Rezeptivität unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt.“ (KrV A42/B59)
Unsere Erscheinungen haben Dinge an sich selbst als eigentlichen Grund und doch scheinen sie nach vorgegebener subjektiver Form. Jene Form ist somit völlig unabhängig von jener Basis. Kant hatte wohl grundsätzlich keine Probleme mit dem Schuster, ihm passte offenbar jeder Schuh – überhaupt jede Montur! Kant hätte demnach auch keine Bedenken, etwa einen Bären wie eine Maus zu kleiden, einen Vogel wie einen Fisch. Ja, bei Kant ist die Frage der Kleidung – der Form – selbst der Funktion jener Form(!) – augenfällig absolut irrelevant zur jeweiligen Figur – er macht die Form zur Figur – entmachtet Letztere generell bis zum äußersten Rande der Bedeutungslosigkeit – und doch bleibt sie letztlich und endlich die eigentliche Basis zu aller Erfahrung – wie das?
Diese Widersprüche sind der Fachwelt an sich nichts Neues, sie versteht es aber evident nicht sie zu entschlüsseln, nicht einmal im Ansatz (vorneweg sei vor einigen extrem heiklen Begriffen, z. B: “Objektivität“, “kausal“ in den sogleich folgenden Beiträgen gewarnt – besonders mit: “verformen“, “mitgeformt“, sind wir nicht einverstanden. Der Begriff: Ding an sich ist ohnehin höchst heikel und damit auch alle relevanten Beiträge generell.) Dass wir sogleich fünf verschiedene Quellen auf einen bestimmten Punkt beziehen, soll u. a. die Ratlosigkeit zeigen, mit der allgemein die höchst fragwürdige prinzipielle Trennung Kants zwischen absoluter Basis (Dinge a. s. s.), absoluter Objektivität einerseits und subjektiver Form, “menschlicher“ Objektivität andererseits hingenommen wird:
“Ding an sich: Fachterminus der Erkenntnistheorie Kants: das vom Einfluß des erkennenden Subekts unberührte Ding. Die Konstitution der Sinnesorgane und die Strukturen des Verstandes „verformen“ das Ding an sich für Menschen zur [.] Erscheinung. Da diese Rahmenbedingungen des Erkenntnisprozesses in keiner Weise hintergangen werden können, bleibt das Ding an sich für Menschen prinzipiell unerkennbar [...]“ [So ein Unfug! Ist die Suppe die wir mit dem Löffel essen etwa keine Suppe?] (Schüler-Duden, Die Philosophie, S. 104)
“Ding an sich: in Kants ‚Kritik der reinen Vernunft’ Bezeichnung für die unabhängig vom erkennenden SUBJEKT bestehende, hinter der erkennbaren ERSCHEINUNG liegende Wirklichkeit; das D. a. s. kann nicht erkannt werden, weil alles, was erkannt werden kann, vom erkennenden Subjekt mitgeformt ist; wir erkennen die Welt nur so, wie sie uns im Medium von ANSCHAUUNGS-FORMEN, KATEGORIEN und Vernunftbegriffen (IDEEN) ‚erscheint’. Kant unterscheidet daher den erkennbaren, durch unsere Anschauungsweise bestimmten Erscheinungen und dem D. a. s. (als ‚Grund der Erscheinungen’), welches außerhalb und unabhängig von unserer Anschauungsweise besteht. Die Erscheinungen bestehen dagegen ‚für uns’. Das D. a. s. ist aber als das, was erscheint, notwendige Voraussetzung der Erscheinung. Das D. a. s. ist also für uns (‚denkbar, aber in keiner Weise erkennbar’). Es ist für Kant ein Begriff, der zur Abgrenzung unserer durch Sinne vermittelten Gegenstandserkenntnis von der geistigen, auf der intellektuellen Anschauung basierenden Erkenntnis der Dinge dient. Deshalb nennt Kant das D. a. s. auch NOUMENON (Ver-standesgegenstand, Gedankending) im Gegensatz zum PHAENOMENON (Sin-nesgegenstand, Sinnending, Erscheinung).“ (Alexander Ulfig, 1997, S. 88-9)
“Ding an sich [...] Kant unterscheidet zwischen Erscheinung als demjeni-gen, was einem Subjekt in sinnlicher Anschauung, also durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen gegeben ist und den davon unabhängigen Dingen an sich. Zum Begriff eines Dinges an sich gelangt er auf zwei Wegen. Zum einen fordert der Begriff der Erscheinung den Begriff eines Dinges an sich als logisches Korrelat. Nimmt man an, dass die Gegenstände der sinnlichen Anschauung Erscheinungscharakter besitzen, so muss man gleichfalls unterstel-len, dass es etwas gibt, wovon die Erscheinungen Erscheinungen sind, worauf sie verweisen, was durch sie angezeigt wird. Auf der anderen Seite muss Kant die Existenz eines Dinges an sich unterstellen, damit Erfahrung mit dem Anspruch auftreten kann, Objektivität zu besitzen. Ausgehend von der Annahme, dass die Formen von Anschauung und Denken erfahrungskonstitutiv sind, d. h. die Erfahrung gemäß bestimmten Formen strukturieren, muss er einerseits behaupten, dass die Gegenstände der Erfahrung nicht mit den Dingen an sich identisch sind, weil nicht einzusehen wäre, wie Anschauung und Denken auf etwas unabhängig von ihnen Bestehendes eine strukturierende Tätigkeit aus-üben können. [Indes, das müsste zwangsläufig dazu führen, dass unsere Erschei-nungen ihrer absoluten Ur-Basis, den jeweiligen Dingen an sich selbst, davon-laufen würden, zugunsten der “subjektiven Basis“ – zugunsten der subjektiven apriorischen Formen (Anschauungen und Kategorien). Das ist, als ob man ein Haus in Stockholm bauen will mit einem Fundament in Bullerbü [Bullerbyn], München oder Berlin – unabhängig von Beschaffenheit, Funktion, Art, Ort ... jenes Fundaments – unabhängig von Letzterem generell – just zur Genüge, dass es irgendwo, irgendwie real existiert. Als Architekt (oder auch Autohersteller, ... → S. 142-3) hätte Kant mit diesem Mega-Optimismus nicht unbedingt opti-male Voraussetzungen.] Raum und Zeit als Formen der Anschauung, bzw. Vorstellung die Kategorien als Formen des Denkens können sich nur auf das beziehen, was einem Subjekt in Anschauung und Denken gegeben ist, nicht auf ein jenseits von Anschauung und Denken liegendes Ding an sich. Zum anderen weist Kant dem Ding an sich die Aufgabe zu, kausal für das Zustandekommen der subjektiven Vorstellungen verantwortlich zu sein und damit der Spontaneität, d. h. Selbsttätigkeit des Subjekts Grenzen zu setzen. Idealistische Philosophien stehen vor dem Problem, erklären zu müssen, weshalb es nicht in der Macht des Subjekts liegt, die Welt so aufzufassen, wie es in seinem Ermessen liegt. Durch die Annahme eines kausal für das Zustandekommen der Vorstellungen des Subjekts verantwortlichen Dinges an sich will Kant diese Frage beantworten. Er steht dann allerdings vor dem Problem, einem Gegenstand, der prinzipiell unerkennbar sein soll, zumindest kausale Wirksamkeit und Existenz zusprechen zu müssen [zudem: → S. 41, oben]. Genau an diesem Punkt setzt die Kritik seiner Zeitgenossen und Nachfolger an, die das Problem auf dem Wege idealistischer Systementwürfe lösen wollen.“ (Handwörterbuch Philosophie, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, S. 301, – interne Querverweise wurden ausgelassen.)
“Ding an sich, seit Kants Kritik der reinen Vernunft (1781) der Begriff für die von der menschlichen Erkenntnis unabhängige Wirklichkeit. Das D. a. s. ist für uns unerkennbar, weil es im Gegensatz zu der Erscheinung die Bedingungen unserer Erkenntnis – anschauliche Gegebenheit in Raum und Zeit sowie Kategorialität – transzendiert. Bei Kant lassen sich zwei Bedeutungen des Begriffes >>D. a. s.<< unterscheiden. (1) Als >>Noumenon im negativen Verstande<< (KrV, B 307) ist das D. a. s. ein >Grenzbegriff<< (B 310) des transzendentalen Idealismus. Da wir uns durch Abstraktion von unserer Art der Anschauung intelligible Dinge als möglich denken können, die unsere Erkenntnisbedingungen transzendieren, dürfen wir nicht ausschließen, daß es solche Dinge tatsächlich gibt, auch wenn sie für uns nicht erkennbar sind. Deshalb müssen wir den Geltungsumfang unserer Erkenntnisbedingungen auf die für uns erkennbaren Dinge einschränken, >>ohne doch etwas Positives außer dem Umfange derselben setzen zu können<< (B 311). – (2) Seiner zweiten Bedeutung nach wird das D. a. s. als ontologisch unabhängiger Seinsgrund bzw. als >>Ursache der Erscheinung<< (B 344, 522) aufgefaßt, die sich zwar unserem erkennenden Zugriff entzieht, deren Existenz jedoch feststeht (Akad.-Ausg. 4, S. 289). In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer Zwei-Welten-Lehre Kants, weil er neben dem Bereich der phänomenalen Vorstellungen eine vom Subjekt unabhängige und es affizierende intelligible Wirklichkeit annimmt.
Insbesondere die zweite Auffassung des D. a. s. ist von Kants Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfolgern (Jacobi, Aenisidemus-Schulze, dt. Idealismus), aber auch vom [.] Neukantianismus kritisiert worden. Kants Behauptung, die D.e a. s. seien unerkennbar, ist nämlich mit seiner Annahme, daß sie existieren, einen intelligiblen Charakter haben und sogar kausal wirksam sind, nur schwer vereinbar. Diese Unverträglichkeit läßt sich auch dadurch nicht ausräumen, daß man auf die systematische Bedeutung der Position für die Auflösung der Vernunft-Antinomien hinweist oder sie als Ausdruck von Kants ontologischem Realismus versteht. – In den neueren Kantinterpretationen von Prauss und Allison wird deshalb versucht, D. a. s. und Erscheinung nicht mehr als verschie-dene Gegenstände, sondern als verschiedene Aspekte eines Gegenstandes aufzu-fassen.“ (METZLER PHILOSOPHIE LEXIKON, Begriffe und Definitionen, S. 114-5)
“Ding an sich – [...] Der Gebrauch des Ding-an-sich-Begriffs ist bei KANT nicht eindeutig. Einmal wird das Ding an sich im Sinne eines außerhalb des Bewußtseins existierenden unerkennbaren, zum anderen als notwendiger Gedanke eines nur vorgestellten Seins (Ding an sich als Gedankending) gefaßt (B 594, Prol § 57). Letzteren Gedanken erweiternd, setzt KANT das Ding an sich auch mit dem noumenon PLATONS gleich (B 294f, Prol § 32–35). Im anderen Zusammenhang wird das Ding an sich negativ als leerer Gedanke (eine Auffassung, die vor allem im Neukantianismus Schule gemacht hat), dann aber wieder positiv als Gegenbegriff zur Erscheinung (eine Auffassung, die als Problem in der klassischen deutschen Philosophie eine Rolle spielte) bestimmt (B 565). Schließlich wird das Ding an sich von KANT als Grenzbegriff vorgestellt, der die Erkenntnis auf die Erfahrung festlegen und Grenzüber-schreitungen ihrerseits ins Übersinnliche verhindern soll (B 310, Prol § 57–60). An anderen Stellen des KANTschen Werkes klingt eine Auffassung durch, die das Ding an sich als <<ewige Aufgabe>> hinstellt, deren Lösung der menschlichen Vernunft im fortschreitenden Prozeß der Erkenntnis obliegt, deren Verwirklichung jedoch außerhalb des Vermögens der Vernunft liegt. Daneben verwendet KANT den Begriff in der Einzahl (Ding an sich) und Mehrzahl (Dinge an sich), ohne hierfür Gründe geltend zu machen.
Die Ding-an-sich-Lehre bringt, geht man auf ihr Wesen ein und sieht von den Inkonsequenzen der Verwendung des Ding-an-sich-Begriffs innerhalb der KANTschen Philosophie ab, deutlich das Schwanken KANTs zwischen Idealismus und Materialismus zum Ausdruck. [!] Indem KANT das Ding an sich als außerhalb des Bewußtseins existierend anerkennt, gibt er seiner Philosophie eine Wendung zum Materialismus. Indem KANT jedoch im weiteren das Ding an sich für unerkennbar erklärt und den Bereich möglicher Erkenntnis auf die Erscheinung einschränkt, gibt er seiner Erkenntnislehre eine Wendung zum Agnostizismus und seiner Philosophie insgesamt in letzter Instanz einen subjektiv-idealistischen Charakter (LENIN 14, II).
Die Ding-an-sich-Lehre und ihre Problematik resultiert zunächst aus der Tatsache der Nichtbewältigung des Erkenntnisproblems durch KANT. [!] KANT legt seiner Erkenntnislehre den Erkenntnisbegriff der mathematischen Naturwissenschaft des 17. und 18. Jahrhunderts zugrunde und verabsolutiert ihn. [!] Insofern erscheint ihm alles das als unerkennbar, was nicht mit den methodischen Mitteln der mathematisch-mechanischen Naturerkenntnis erkannt werden kann (z. B. die Entwicklung der Organismen). Diese Verabsolutierung des Erkenntnisideals der Zeit verführt KANT sowohl zu der undialektischen Gegenüberstellung von Ding an sich und Erscheinung als auch dazu, den Wissensstand seiner Zeit in methodischer Hinsicht unhistorisch für etwas Fertiges, Unveränderliches, Abgeschlossenes zu halten. [!] “
(Philosophisches Wörterbuch, Band 1, A-K, Leitung Manfred Buhr, S. 284)
Das klingt nicht gerade nach Brunner, Höffe, Magee, → S. 14-5.
Aber kommen wir nun zur “Gesetzlichkeit“ zurück:
“The ’Copernican Revolution’ which appeared some years later in the Prefac e to B is of course already being proclaimed in Kant’s proposal to reinterpret the laws of nature as rules. Particular laws, such as those of mechanics, are regarded as only particular determinations of higher ones (nur besondere Bestimmungen noch höherer Gesetze). Neither here nor later, however, does Kant ever come to grips with the problem of the limit at which in proceeding from higher to lower determinations, we pass from synthetic a priori to synthetic a posteriori propositions. It is quite clear that when Kant says, as he does here, that the understanding is the lawgiver of nature he is referring only to the causal principle, not to one or another causal law. Of course, he says, what are only ‘empirical laws cannot trace their origin to the pure understanding.’ But if they are only ‘special determinations of the pure laws of the understanding’ are we to take him to intend the absurdity that synthetic a posteriori propositions are only special cases of synthetic a priori propositions? [Seite 162]
Categories, says Kant, are concepts through which we prescribe laws to nature. How? Here Kant makes a distinction between laws of nature of the most general sort, which alone are meant, and special laws of nature. (This may perhaps be equated with the difference between synthetic laws, known a priori, and those known a posteriori.) By categories we must here think not of mere concepts as named by distinct terms such as ‘substance’ and ‘causality’, but principles such as those formulated under the Analogies of Experience in the next large division of the Critique. Kant here leaves important matters indeterminate. Special laws are said to be derived (abgeleitet) from general laws; they are said to stand under, to be subject to them (stehen unter). They are also said to need empirical determination: they cannot be fully determined only by reference to the categories.
There may be an inconsistency here that is fateful in its consequences [der Meinung sind wir allerdings auch!] . For if Kant cannot specify how causal laws are related to the causal principle, the Critique may be in danger of terminating in contradiction. The whole momentum of the argument dictates the conclusion that all laws are a priori [exakt!] , which, however, Kant’s fundamental good sense and his skill as a natural scientist prevent him from drawing. [...]
While the actual articulation of Kant’s philosophy of science is left unclear he is definitely of the opinion that basic general laws, such as Newton’s three laws of motion, are not to be learned from experience, that they are indispensable to the economy of experience and science, and that they are to be derived, proved, or as he says, shown to be possible, only by the transcendental method. This program can be carried out only because the objects to which these laws or categories apply are appearances rather than things themselves. These, being only representations are subject to the synthesizing faculty. This subjects nature, as comprehensive of all appearances (der Inbegriff aller Erscheinungen), to the categories.” [Seite 190-1] (Karl Aschenbrenner, A
Companion to Kant’s Critique of Pure Reason, 1983, die Seiten 162, 190-1)
“Naturgesetze, Gesetze die dem Naturgeschehen zugrunde liegen. Ihre Kenntnis ermöglicht es, den Ablauf eines Naturgeschehens vorher zu bestim-men. Sie werden aus der Erfahrung erhalten u. dienen dazu, eine umfassende Vorstellung von der Natur zu vermitteln. Während die Wiederholung eines Experiments nach aller unserer Erfahrung immer dieselben Resultate liefert, ändern sich die Vorstellungen über die Natur von Zeit zu Zeit; sie werden immer mehr ausgefeilt u. damit allgemeingültiger. – Die wichtigsten N. sind die 10 Erhaltungssätze der Physik: Energie-, Impuls-, Drehimpuls-, u. Schwer-punktserhaltungssatz; in der Mechanik gilt das Newtonsche Kraftgesetz: Kraft = Masse mal Beschleunigung, und das Gravitationsgesetz, aus dem die Gesetze des Falls und die Keplerschen Gesetze der Planetenbewegungen folgen. Früher hatte man versucht, alle physikal. Erscheinungen durch diese Gesetze zu verstehen; aber in der Elektrodynamik zeigte es sich, daß man andere Gesetze für den elektr. Strom u. seine Wirkungen annehmen muß. Dies sind die Maxwellschen Gleichungen, deren Entdeckung erst durch die Annahme einer ‚Nahwirkungstheorie’ möglich geworden ist. [...] Durch die spezielle Relativitäts-theorie wurde gezeigt, daß die Masse eines Teilchens bei großen Geschwindig-keiten größer wird und daß Masse u. Energie äquivalent sind. Die allgemeine Relativitätstheorie zeigt, daß sogar die Struktur des Raumes und damit die Gesetze der Geometrie nicht von vornherein (a priori) gegeben, sondern Erfahrungstatsachen sind. Das Newtonsche Gravitationsgesetz erscheint dann als auf der Erde gültige Näherung eines allgemeingültigen Zusammenhangs. In den letzten Jahrzehnten sind außer den makrophysikal. N.n der (klass. u. relativist.) Mechanik, Elektrodynamik, Optik, Thermodynamik die N. der Atomphysik studiert u. in der Quantentheorie zusammengefaßt worden. Dabei hat es sich gezeigt, daß es hier prinzipiell nicht mehr möglich ist, den Verlauf eines physikal. Geschehens exakt vorher zu bestimmen, sondern daß man nur voraussagen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein gewisses Endergebnis erhalten wird. Das N. von der Kausalität bleibt erhalten. – Die Gesetzmäßig-keiten der Atomhülle, d. h. der die Atomkerne umgebenden Elektronen, sind im wesentlichen bekannt und damit auch die Grundgesetze der Chemie. Die N. der Atomkerne sowie die der schnellfliegenden kosmischen Strahlen sind noch weitgehend unerklärt [...] Man hofft, alle diese N. durch eine umfassende Theorie der Elementarteilchen erfassen zu können.“ (Das Bertelsmann Lexikon, Jubiläumsausgabe, dritter Band, Bertelsmann Verlag,1964, Seite 385)
“Es [der Begriff d. Gesetzes] ist für ihn [Lenin] das Dauerhafte in der Er-scheinung. Eben deshalb fassen wir das G. [Gesetz] als einen allgemeinnot-wendigen Zusammenhang zwischen Objekten und Prozessen, weil sich durch Allgemeinheit und Notwendigkeit zusammen die Reproduzierbarkeit ergibt. Allgemeinheit verweist auf gemeinsame Merkmale unterschiedlicher Erschei-nungen und Prozesse. Notwendigkeit bestimmt Ereignisse, die aufgrund der Bedingungen möglich sind und mit Gewißheit eintreten.“
(Europäische Enzyklopädie zu Philosophie, Band 2, Meiner, 1990, S. 432)
Das sagt viel – ein ganz wesentliches Moment fehlt aber doch: bloße Gesetzlichkeit an sich ist noch kein hinreichender Grund zum Konkreten. Vielmehr sind zusätzliche Fakten erforderlich – in der Regel präzise eindeutige Werte. Das Ohmsche Gesetz: I = U:R, liefert z. B. genaue individuelle Ergebnisse, vorausgesetzt es werden ebenso individuelle Werte (z. B. für U und R) eingesetzt. Keines-falls ergibt sich aus der potentiellen Fülle der Möglichkeiten, die jenes Gesetz an sich theoretisch enthält irgendein konkreter Ansatz.
Was aber steht für Kant an präzisen Fakten zur Verfügung? Die Anschauung? Anschauung bezieht sich u. a. nach KrV A320/B376-7 auf das Einzelne, (Begriffe auf das Allgemeine) damit gibt sich der Königsberger diesbezüglich zufrieden, und ganze Generationen von Philosophen halten da bedenkenlos mit – wir aber nicht! (vergl.→ S. 158)
Denn die Anschauung bietet im apriorischen Bereich lediglich All-gemeinheit und keine konkreten Werte. Wo also bleiben Letztere? Im empirischen Bereich, über die Affektion? Mit Empirisch verbindet Kant grundsätzlich alles andere als Präzision – eher Zufall. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sich angeblich hinter der Affektion lediglich “roher Stoff“ verbirgt! Spätestens an diesem Punkt bricht Kants hochkarätig gesetzlich-bedingtes System zusammen, denn die Werte und Befehle die Kant für gesetzlichen Einsatz braucht hat er nicht. Weil er sie aber nicht hat, macht er aus der Not schlicht eine Tugend und lässt die erforderlichen Werte, Fakten und Befehle erzeugen – und womit? exakt mit jenen Gesetzen! – schon mehr als dreist, oder? Das ist, als ob z. B. Nahrung dadurch erzeugt würde indem sie zur Bedin-gung gesetzt wird! – angeblich Wissenschaft in Höchstform (→ S. 14-5)!
8 “weil ohne ...“, – sinnlose Bedingungen
Kant sieht in einem Abhängigkeitsverhältnis offenbar grund-sätzlich ein Verwandtschaftsverhältnis – eine gewisse Wesens-gleichheit und Kongruenz. Dabei sind Bedingung und Bedingtes, besonders im Falle entsprechender Beeinflussung – im Falle Kants also – eher gegensätzlicher Natur.
Ohne elektrische Spannung kein elektrischer Strom. Eine Erhöhung der Spannung hat direkt einen höheren Stromfluss zur Folge. Nun, dieser letzte Satz ist nicht ganz korrekt. Er ist im groben physikalischen Alltag immerhin brauchbar, insofern, dass er mehr oder weniger brauchbare Näherungswerte liefert, spätestens im extremen Grenzbereich zeigt sich jedoch, dass er streng genommen falsch ist. Die Spannung ist am höchsten, wenn kein Strom fließt – wenn z. B. durch öffnen des Stromkreises die jeweilige Beziehung ganz aufgehoben wird.
Der Strom ist hingegen am höchsten, exakt wenn sich die Ausgangsspannung gegen Null beläuft – idealer Kurzschluss, nennen wir das – wenn demnach die jeweilige Beziehung auf engstem, höchstmöglichem Stand realisiert wird. Relativ hohe Trennung beider Aspekte durch entsprechende elektrische Wiederstände täuscht hier zunächst direkte Verwandtschaft vor.
Ohne jene Wiederstände, im unmittelbaren Kontakt, zeigt sich hingegen, dass Strom und Spannung im Grunde gegensätzlicher Natur sind und sich gegenseitig das Leben streitig machen, statt sich Hand in Hand zu bestätigen.
Elektrische Spannung ist eine Bedingung für elektrischen Strom und doch ist, entgegen Kant, das Wesen des einen zum anderen gegensätzlich und nicht gleichförmig. Im Strom findet sich keine Spannung – im Gegenteil – der Strom vernichtet oder verbraucht seine unmittelbare Bedingung. Das Wesen des Bedingten entspricht hier gerade eben nicht dem Wesen seiner Bedingung – ein eklatanter Widerspruch somit zur “weil ohne“-Strategie Kants (→ u. a. S. 110).
Stromerzeugung ist generell eine bedingte Angelegenheit.
Hat die Art der jeweiligen Bedingung jedoch irgendwelchen Einfluss auf die sodann fließenden Ampere ? Läuft elektrischer Strom eines Braun-kohlekraftwerks etwa anders als derjenige eines Wasserkraftwerks?
Ohne Wind läuft eine Windmühle nicht sehr geschwind. Hat eine solche Mühle deswegen aber gleich windige Qualitäten?
Ein Auto hat notwendigerweise runde Räder – ist deshalb aber alles rund was das Auto insgesamt betrifft? Sicher, die Reifen ermöglichen das Fahren. Geht hier jedoch der eigentliche Zweck und Inhalt des Autos fahren-zu-können auf die erwähnten runden Räder zurück? Ist es nicht so, dass Zweck und Inhalt bereits feststehen, bevor die jeweili-gen Bedingungen das Ganze zur Realität verhelfen? Ein Auto ohne Räder fährt nicht – das heißt jedoch nicht, dass Sinn und Bedeutung eines Autos zwangsläufig mit den Rädern im Zusammenhang stehen.
Sticht die Mücke die durch die Tür kommt etwa besser wie diejenige die durchs Fenster fliegt?
Gerade das Beispiel eines Fensters demonstriert einfach aber deutlich die beschränkte Reichweite formaler Bedingungen: Es lassen sich nicht lediglich die verschiedensten Flächen durch ein Fenster befördern, sondern vor allem dreidimensionale Körper – Würfel, Ball, Bleistift ... Die körperliche Dimension aber fehlt der Fläche des Fensters, d. h. der bedingte Stoff hat in diesem Fall Form und Inhalte, die der Bedingung gänzlich fehlen.
Der bloßen Tatsache, dass ein bestimmter Gegenstand beschleunigt wurde, ist prinzipiell, entgegen Kant, in keiner Weise zu entnehmen, durch welche Mittel er beschleunigt wurde. Die Kraft führt kein Tage-buch. Einer bewegten Kraft an sich ist nicht anzusehen, über welche Bedingungen sie vermittelt wird. In den soeben genannten Beispielen handelt es sich jedoch ausschließlich um Rahmenbedingungen.
In relativ einmaligen Situationen etwa einer chemischen Reaktion (Kernbedingung) hätten wir hingegen einen Fall bei dem das Bedingte durch die jeweilige (Kern-) Bedingung bleibend gekennzeichnet ist.
Kant versäumt es hier zu differenzieren. Vor allem ist es schlicht nicht korrekt zu unterstellen, dass Bedingungen grundsätzlich immer in das Bedingte inhaltlich einfließen. Jede fixe, “gesetzliche“ formale logische Bedingung bedingt absolut, dass ein solches inhaltliches Einfließen in das Bedingte ausgeschlossen ist (→ u. a. S. 86, 93, 117-9).
Kant ist folglich prinzipiell im Unrecht, wenn er von der Zeit, dem Raum und den Verstandeskategorien als gesetzliche, subjektive, fixe formale Bedingung direkt auf die bedingte Erfahrung irgendwelche inhaltliche Rückschlüsse zieht. Und dazu sollten wir sogleich etwas tiefer ins Detail gehen:
“[...] damit gewisse Empfindungen auf etwas außer mir bezogen werden, (d. i. auf etwas in einem andern Orte des Raumes, als darinnen ich mich befinde,) imgleichen damit ich sie als außer und neben einander, mithin nicht bloß verschieden, sondern als in verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu muß die Vorstellung des Raumes schon zum Grunde liegen.“ (KrV A23/B38)
und daher:
“Der Raum ist eine notwendige Vorstellung, a priori, die allen äußeren Anschauungen zum Grunde liegt.“ (KrV A24/B38)
und daher:
“Jene [reinen Formen der Anschauung von Raum und Zeit] hängen unsrer Sinnlichkeit schlechthin notwendig an [...]“ (KrV A42/B60)
Erneut wird hier ersichtlich, dass Kant seine apriorischen subjekti-ven Bedingungen (d. M. d. E.), entgegen KrV A249/B305, Prol. § 39 (zitiert → S. 81) nicht lediglich mit formalem logischem, sondern vor allem mit inhaltlichem Bezug gebraucht. Denn jenes, “hängen unsrer Sinnlichkeit schlechthin notwendig an“, ist ganz wesentlicher Teil des Inhalts der jeweiligen Erfahrung.
Dass die Erfahrung notwendigerweise vom Raum als reine Form der Anschauung bedingt ist, hat aber entgegen Kant keinesfalls die Folge, dass alle Erfahrung räumlich ist. Sind Flächen, Linien, Punkte oder etwa geistige Aspekte: Politik, Ethik, Religion, Literatur ... räumlich? Nach Kant dürfte es streng genommen keine Flächen, Linien, Punkte ... in unseren Erscheinungen geben, weil jenen Aspekten mindestens eine Dimension zur Räumlichkeit fehlt. Punkte, wie Linien, wie Flächen sind, mit Kant, alle gleichermaßen bedingt durch die apriorische Form der Anschauung, und dennoch enthalten sie nicht den räumlichen Charakter der jeweiligen Bedingung, den sie mit oben zitierter Behauptungen notwendigerweise haben müssten!
Dies beweist, dass Kant nicht berechtigt ist, von einer formalen Bedingung auf das jeweils Bedingte irgendwelche inhaltliche Rückschlüsse zu ziehen.
Überhaupt hat unsere räumliche Anschauung nicht die eindeutige Natur, die sie gemäß Kant eigentlich haben sollte. Wer beispielsweise nur mit einem Auge sieht, hat allenfalls ein sehr beschränktes räumliches Bild. Aber selbst ein Bild resultierend aus zwei Augen der üblichen Art ist nicht absolut räumlich, keineswegs.
Denn der entsprechende plastische Eindruck wird maßgeblich vom Abstand der Augen zueinander bestimmt und der ist grundsätzlich willkürlich variabel.
Kant würde hier auf die Räumlichkeit an sich verweisen.
Unsere Erscheinungen repräsentieren jedoch nicht Räumlichkeit an sich – dann wären sie überall und nirgends – sie stellen hingegen spezielle Fälle jener Räumlichkeit dar.
Generell leistet er sich einen fatalen Fehler, wenn er Notwendigkeit mit Zweck, Inhalt und allgemeiner Gültigkeit verbindet (KrV B4, A24/B38, A68/B93, A320/B377 zu A125-8, B165, A159/B198). Er sieht nicht, dass Bedingungen mit nachfolgender inhaltlicher Konsequenz Teil des Individuellen werden – damit aber unweigerlich ihre eventuell unterstellte Allgemeingül-tigkeit einbüßen (siehe dazu u. a. auch → S. 190-1).
A Priori, notwendig kann jedoch prinzipiell nicht den absoluten Stellenwert haben, den Kant ihm unbedingt zuerkennen will. Dinge sind oft von einer langen Kette all-möglicher sich häufig widerstrebender notwendiger Bedingungen abhängig. Dennoch haben bedingte Aspekte sehr oft einen eigenen Charakter, der kaum, falls überhaupt, irgendetwas mit seinen einzelnen notwendigen Bedingungen gemein hat. “weil ohne ...“ stellt Kant hingegen stets quasi als simplen einmalig-bedingten, zwangsläufig inhaltlich prägenden Fall dar, der zumindest keine Rivalität unter den Bedingungen kennt – was die Anschauung betrifft. Sich direkt widersprechende notwendige Bedingungen führt Kant als Kategorien: Allgemeine – Einzelne, Bejahend – Verneinend, ...
Das merkwürdige dabei ist, dass der Mensch, nach Kant, an gewisse notwendige Bedingungen absolut gebunden ist, während er unter anderen offenbar völlig frei wählen darf. Raum und Zeit sind obligatorisch, Allgemeine und Einzelne indes völlig frei – mehr noch, sie schließen sich gegenseitig aus. Notwendigkeit hat bei Kant auf Ebene der Anschauung somit eine völlig andere Bedeutung als auf jener der Kategorien. – Schade, auf diesem speziellen Aspekt können wir in unserem sehr begrenzten Rahmen nicht weiter eingehen.
Kant sieht vermutlich auch nicht ein, dass es keinen Sinn macht, bloße Bedingungen zu setzen, ohne sich zu fragen, ob jene Bedingungen überhaupt eine Chance auf Erfüllung haben oder nicht?
Bedingungen, zumindest als Rahmenbedingungen, denen keine übergeordne-ten Möglichkeiten der Erfüllung bereits zu Grunde liegen sind aus unserer Sicht unbegründet und leer, vergleichbar z. B. mit einem Sieb: Ein Sieb kann nichts sieben ohne einen zu siebenden materiellen Stoff – es kann sich nicht selbst sieben. Dabei ist eine zu siebende Substanz grundsätzlich unabhängig vom Sieb – die gesamte ursprüngliche Substanz wie auch deren Teilmengen, die zurückgehaltenen wie die durchgeschleusten Elemente.
Kernbedingungen können sich hingegen gewissermaßen selbst sieben, der Preis dafür ist jedoch, dass sie in den entsprechenden Prozess integriert werden und somit ihren Status, der jenem Prozess vorausgeht, aufgeben müssen. Da Rahmenbedingungen von unserem Standpunkt aus als Erzeuger nicht in Frage kommen, bedürfen sie übergeordneter Kern- oder Rahmenbedingung(en), – den eigentlichen Grund dazu kann jedoch nur eine (oder mehrere) Kernbe-dingung(en) liefern, d. h. die Möglichkeit zur Erfüllung einer Rahmenbe-dingung muss bereits vor Inkrafttreten jener Rahmenbedingung potentiell gegeben sein – andernfalls handelt es sich um eine nicht erfüllbare und damit absurde Bedingung. Rahmenbedingungen können einer ideell bereits existieren-den Sache zur Realität verhelfen, sie können hingegen nicht zum eigentlichen Inhalt jener bedingten Sache beitragen.
Ein besorgter Vater, z. B. mag es seinen Töchtern kategorisch vorschreiben, dass sie abends um neun Uhr zu Hause sind. Sollten jene Töchter tatsächlich um neun Uhr zu Hause sein, so ließe sich jener Fakt jedoch nicht allein auf diese gestellte (Rahmen-) Bedingung stützen. Vielmehr müssen zahlreiche und sehr verschiedene Fakten jenseits der vom Vater gestellten bloßen Bedingung gegeben sein, damit jene Mädels auch tatsächlich zur kritischen Zeit im eigenen Heim vorstellig sind. Vor allem die Anlage bzw. die potentielle Möglichkeit um neun Uhr zu Hause zu sein muss definitiv bereits vor jener gestellten Bedingung vorhanden sein, andernfalls macht jene Bedingung keinen Sinn. Es macht keinen Sinn zu jemandem zu sagen er (oder sie) müsse dann und dann zu Hause sein, wenn der Angesprochene beispielsweise ohnehin nicht ausgehen möchte oder nicht ausgehen kann und daher auch nicht ausgeht. Die väterlich gestellte Bedingung schließt zudem nicht aus, dass die Töchter aus eigenem Anlass, oder aus welchen Gründen auch immer, unabhängig des elterlichen Gebots zur festgesetzten Zeit zu Hause sind (unter anderem eben auch vielleicht weil sie erst gar nicht weggingen). Also ließe sich der eventuelle Fakt, dass in unserem erwähnten Beispiel die Töchter um jene Zeit tatsächlich zu Hause erscheinen, keinesfalls auf die vom Vater ursprünglich gestellte Bedingung als dessen tatsächliche Ursache zurückführen. Solche Bedingungen können schon deshalb nicht als Ursachen gelten, weil sie ein entsprechendes Ergebnis aufgrund alternativer “Bedingungen“ nicht ausschließen (das erinnert Kant-Kenner sicherlich an die sogenannte “Trendelenburgsche Lücke“). Schließen hingegen bestimmte Bedingungen Alternativen definitiv aus, so erfordert dies eine Integration dieser Bedingungen in den jeweiligen Gesamtprozess, was den ursprünglich unabhängigen Status aller integrierten einzelnen Kriterien aufhebt.
Sollte unser tapferer Vater im obigen Beispiel mit seiner Bedingung, dass die Töchter um neun Uhr zu Hause sein sollen meinen, dass jene Bedingung der einzige und alleinige, praktische wie theoretische Grund für die Möglichkeit des Erscheinens der Töchter zur kritischen Zeit am kritischen Ort sein sollte, so ist dies nur in einem relativ einmaligen Fall möglich. Der Vater muss diese Bedingung quasi abgeben, er kann sie nicht nochmals in einem weiteren Falle gebrauchen, andernfalls kann sich jene Bedingung nicht “persönlich“ in diesen Prozess eingliedern – wenn sie sich nicht eingliedern kann, kann sie nicht handeln – kann sie nicht wirken und kann sodann unmöglich als einzige Möglichkeit der Realisation dieses Prozesses gelten.
Zudem, wie ist es möglich, dass subjektive Bedingungen von Raum und Zeit und die Kategorien offenbar perfekt mit den äußeren Gegebenheiten der Sinnesinformation harmonieren – sich jene äußere Gegebenheiten scheinbar wie selbstverständlich dem Diktat der subjektiven Vorgaben beugen, obgleich sie ursprünglich völlig unvorbereitet für ein solches Unterfangen sein müssen, denn in der absoluten Realität, aus der jene Informationen stammen, existieren jene subjektiven Vorgaben, so zumindest mit Kant, in keiner Weise.
Man stelle sich vor, dass etwa ein Eingeborener aus dem Urwald Australiens plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, nach Deutschland verschleppt wird – wie soll der Mann (mit uns und wir mit ihm) klarkommen? Ganz einfach, indem für ihn spezielle Umstände geschaffen werden, die wir uns sodann, aus der Pers-pektive Kants, im Laufe der Zeit zu subjektiven Gegebenheiten zu Eigen machen.
Schön und gut, was geschieht aber, wenn nun zusätzlich aus allen Teilen der Welt urplötzlich die verschiedensten Typen im Ländle vorstellig werden? Dann nützen die subjektiv erworbenen Gegebenheiten resultierend aus dem Australo-Ereignis relativ wenig, denn ein Eskimo wird beispielsweise ganz andere Bedingungen benötigen wie ein Einwohner aus dem australischen Urwald.
Wenn Kant behauptet, dass z. B. Raum und Zeit objektiv in absoluter Betrach-tung, d. h. unabhängig vom Subjekt, nicht existieren – nicht existieren können – weil sie lediglich subjektive Bedingungen für das Interpretieren von sensueller Information sind, so stellt Kant entweder völlig absurde Bedingungen, oder er ist gezwungen (gemäß unserer vorhergehenden Grundüberlegungen) seine Bedingungen lediglich als relativ einmaligen Startschuss anzusehen.
Rahmenbedingungen machen keinen Sinn, wenn nicht unabhängig jener Rah-menbedingungen die korrespondierenden Möglichkeiten potentiell bereits voll-ständig vorliegen. Tatsächliche Ursachen erfordern hingegen ein aktives Enga-gement, was sich nicht mit bloßer, passiver Existenz erreichen lässt. Und echtes Engagement bedeutet unweigerlich ein Abgeben bzw. eine Veränderung sowohl auf Seiten der bedingten Wirkung als auch auf Seiten der bedingenden Ursache.
Als relativ einmaligen Startschuss können Kategorien und Anschauungen natürlich nicht gesehen werden, denn sie sollen ja kontinuierlich funktionieren unabhängig vom Grad und der Häufigkeit ihrer effektiven Nutzung, was generell jegliche Art von Abnutzung oder Verschleißerscheinung jener Bedingungen kategorisch verbietet.
“Aber in der Zeit, die ich der Erscheinung als innere Anschauung zum Grunde lege, stelle ich mir notwendig synthetische Einheit des Mannigfalti-gen vor, ohne die jene Relation nicht in einer Anschauung bestimmt (in Ansehen der Zeitfolge) gegeben werden könnte [im Sinne von “weil ohne ...“ → u. a. S. 110] Nun ist aber diese synthetische Einheit, als Bedingung a priori, unter der ich das Mannigfaltige einer Anschauung überhaupt verbinde, wenn ich von der beständigen Form meiner innern Anschauung, der Zeit, abstrahiere, die Kategorie der Ursache, durch welche ich, wenn ich sie auf meine Sinnlichkeit anwende, alles was geschieht, in der Zeit über-haupt seiner Relation nach bestimme. Also steht die Apprehension in einer solchen Begebenheit, mithin diese selbst, der möglichen Wahrnehmung nach, unter dem Begriffe des Verhältnisses der Wirkungen und Ursachen, und so in allen andern Fällen.“ (KrV B162-3 – Original kursiv)
Selbst unter der Annahme, dass die Bedingungen die Kant dem menschlichen Geiste im soeben zitierten Text aufbürdet an und für sich berechtigt sind, sind es völlig leere Annahmen insgesamt, wenn jenen Bedingungen nicht reale Möglichkeiten zur Verfügung stehen, und zwar unabhängig der gestellten Bedingungen selbst.
Eine Rahmenbedingung kann nicht dazu herhalten das Bedingte zu erzeugen, sie kann lediglich Möglichkeiten eingrenzen – viele Möglichkeiten zu ganz bestimmten zu beschränken – zu sieben. (Handelsübliche Hauptschalter und Kettenglieder sind in dieser Geltung beispielsweise mit einem Sieb vergleichbar – sie wirken im Grunde nur rein äußerlich auf eine jeweils bedingte Sache.)
Kants Kategorien und Anschauungsformen verstehen sich als fixe fest vorgegebene Gesetze – als absolute Bedingungen (siehe beispielsweise KrV B163-5, A126-8, A159). Und als Gesetze können sie lediglich im passiven negativen Sinne als Rahmenbedingungen fungieren, andererseits würde sich die fixe und feste Struktur jener Gesetze durch ihre eigene aktive Wirkung rückwirkend selbst verändern, womit sie lediglich einmalig, aber nicht immer wieder in immer der gleichen Art und Weise aktiv sein könnten.
Die Möglichkeiten der Realitätsempfindung müssen, so gesehen, potentiell bereits bestehen, bevor man entsprechende Bedingungen setzt (zumindest wenn es sich nicht um relativ einmalige, sondern um beliebig oft wiederholbare Aspekte handelt) andernfalls machen jene Bedingungen absolut keinen Sinn.
“Ich mache zur Bedingung, dass ich Millionär bin!“ – “Ich fordere absolut, dass ich auf dem Mond lebe!“ ...
Solch fordernde Wünsche erfüllen sich in aller Regel nicht aufgrund der bloßen Bedingung – leider – und sind deshalb im Grunde zwecklos, wenn nicht unabhängig der gesetzten Bedingung etwa auf dem Mond leben zu können nicht bereits vorneweg besteht. Ebenso zwecklos sind Kants gesetzliche Vorgaben in Form von Kategorien und Anschauungsformen, wenn die Möglichkeit der Erfahrung nicht ohnehin gegeben ist unabhängig jener Vorgaben.
Wir essen keine Lebensmittel um Hunger zu bekommen (sieht man von be-wusst eingesetzten, appetitanregenden Mitteln ab) sondern um Hunger zu stillen. Wir fahren nicht mit dem Auto zur Tankstelle um dort einen Bedarf nach Sprit zu wecken, sondern um jenen Bedarf zu erfüllen. Wir schalten nicht das Licht an damit wir endlich merken wie dunkel es ist – dass es dunkel ist, wissen wir in aller Regel bereits zuvor. Lebensmittel, Sprit, Licht sind simple Beispiele der Bedingung deren Bedarf grundsätzlich besteht unabhängig davon, durch welche Bedingung jener Bedarf letztlich konkret gedeckt wird (→ Seite 88). Der Bedarf geht demnach auf echte “Kernbedingungen“ zurück (Rahmenbedingungen können zwischen Kernbedingung und bedingtem Bedarf eingeschoben werden).
Gemäß Kant können wir hingegen keinen Bedarf haben, a priori einer jeweils erfüllten Bedingung (in der Bedeutung: “weil ohne“ → S. 110) was nicht dem Wesen der Realität entspricht.
“Es ist hiermit eben so, als mit den ersten Gedanken des Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen.“ (KrV BXVI-VIII)
Just vage angedeutet und Kant kennt kein Zurück mehr. Statt Pro und Kontra sorgfältig abzuwägen, setzt er ab dieser Andeutung alle starken Argumente auf seine Seite, alle schwachen auf die andere und verrennt sich in diesem Stile zwangsläufig in fixe Ideen – wie ein Kind, das eine Lüge mit weiteren Lügen wahr machen will, und dadurch die Wahrheit umso mehr verlässt (vergl. zu S. 31).
Bedingungen sind, im Stande Kants, kein Auswahlverfahren mittels dem unter der Vielzahl gegebener Umstände die passenden ausgesiebt werden, als vielmehr eine völlige Neuschöpfung bis dato nicht vorhandener Aspekte.
Raum und Zeit z. B. existieren, so Kant, in der absoluten Realität nicht. Raum und Zeit existieren jedoch in unserer subjektiven Realität. Sie werden somit nicht aus der Realität herausgefiltert, sondern der Realität von subjektiver Seite gewissermaßen aufgedrängt.
Damit entwickelt Kant jene Bedingungen allerdings aus dem Nichts, was für sich gesehen bereits extrem problematisch ist und einige wesentliche Grundsätze, die Kant an anderen Stellen deutlich herausstellt, verletzt. (Einige dieser Grund-sätze werden wir nachfolgend noch betrachten.)
Kant sieht offenbar in jeder Bedingung generell eine schöpferische, inhaltlich gestaltende Kraft mit positiver Relevanz. Demzufolge wären bedingte Aspekte generell höherwertig als andererseits gleichwertige jedoch weniger bedingte – im praktischen Leben ist es hingegen in der Regel genau umgekehrt:
Wenn ich beispielsweise von meiner Tante zu Weihnachten bedingungslos hundert Mark bekomme, von meinem Onkel ebenfalls hundert Mark allerdings mit der Bedingung, “du musst mir mal beim Renovieren helfen“, so hat das bedingungslose Geschenk meiner Tante doch sicher höheren Rang.
(Wir haben lediglich etwa 200 Bände zu Kant studiert – das ist natürlich nichts gemessen an den zigtausend Büchern und Artikel die über Kant insgesamt bestehen. Es wäre also denkbar, dass die Art wie wir Kant hier anpacken bereits irgendwo von irgendwem im Prinzip niedergeschrieben wurde und sich aus Gründen, die wir nicht kennen, sich nicht hat durchsetzen können. U. a. um dieser Eventualität nachzugehen, hatte ich zwischen Mai-Juli 2006 acht ver-schiedene Universitäten angeschrieben, u. a. Otfried Höffe persönlich (→ S. 319 [Original], ferner S. 148) ohne bis heute, 10. März 2008, irgendwelche fachliche Stellungnahme erhalten zu haben – abgesehen von: → Anhang III, S. 350 [202].)
[Nachtrag: Daran hat sich auch ein Jahr später, Juli 2009, nichts geändert.]
Den subjektiven Bedingungen des Raumes und der Zeit stehen in der Meinung Kants keine objektiv realen Kriterien gegenüber, während Nahrung und ähnliche Aspekte der allge-meinen körperlichen Instandhaltung tatsächlich vorhanden sind und an und für sich potentiell bereitstehen, unabhängig der menschlichen Bedingung zur Nahrungsaufnahme. Insbesondere wird beispielsweise die Nahrung nicht bereits dadurch erzeugt, indem diese uns schlicht und einfach zur Bedingung gemacht wird – das wäre denn auch offenkundig zu schön (→ S. 100)!
Bei Kant ist ein solches Prinzip indes unbegreiflicherweise nicht zu schön, sondern gerade recht! Gemäß Kant schaffen wir es quasi Dinge zu erzeugen, z. B. die Zeit, indem diese uns schlicht und einfach zur Bedingung gesetzt werden (siehe auch d. Seiten 88, 107, 165-6, 181):
“Die Zeit ist also lediglich eine subjektive Bedingung unserer (menschlichen) Anschauung [...] und an sich, außer dem Subjekte, nichts.“ (KrV A35/B51)
Das gleiche gilt für den Raum:
“Der Raum ist nichts anders, als nur die Form aller Erscheinungen äußerer Sinne, d. i. die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere Anschauung möglich ist.“ (KrV A26/B42)
Prinzipiell gilt das auch für alle Verstandeskategorien:
“[...] Kategorien sind nichts anders, als die Bedingungen des Denkens in einer Möglichkeit der Erfahrung, [...]“
(KrV A111 – Original kursiv)
Das alles gipfelt schließlich in der Generalbehauptung Kants:
“[...] die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung, [...]“ (KrV B197/A158)
Begründet wird der unterstellte inhaltliche Einfluss der sub-jektiven Bedingungen auf die bedingte Erfahrung ganz einfach mit “weil ohne ...“, d. h. damit, dass ohne jene Bedingungen das Bedingte praktisch völlig auf Eis liegt (siehe auch S. 82-3, 86):
“Der reine Verstand ist also in den Kategorien das Gesetz der synthetischen Einheit aller Erscheinungen, und macht dadurch Erfahrung ihrer Form nach allererst und ursprünglich möglich.”
(KrV A128 – Original kursiv)
“[...] daß nämlich die Kategorien [...] die Gründe der Möglichkeit aller Erfahrung überhaupt enthalten.“ (KrV B167- Original kursiv)
“[...] weil, ohne solche, [Regeln des Verstandes, der Verstand gene-rell als apriorischer ’Quell der Grundsätze’] den Erscheinungen niemals Erkenntnis eines ihnen korrespondierenden Gegenstandes zukommen könnte.“ (KrV A159/B198 – “weil ohne” unsererseits hervor-
gehoben)
“weil ohne...“ (in soeben zitierter Bedeutung)
Mit diesem “weil ohne“ (direkt vergleichbar zu dem vormaligen Begriff “etwas zu ermöglichen“, → u. a. S. 93) verschätzt sich Kant.
Weil ohne A kein B ... – diese simple Formel verleitet ihn offenkundig zu der katastrophal-fälschlichen Sicht:
bedingt – und also zwangsläufig von der Bedingung inhaltlich
beeinflusst und bestimmt !
In diesem täuschenden Sinne macht er das Objektive der Welt von notwendigen subjektiven Bedingungen inhaltlich abhängig:
“Da nun von der Synthesis der Apprehension alle mögliche Wahr-nehmung, sie selbst aber, diese empirische Synthesis, von der transzen-dentalen, mithin den Kategorien abhängt, so müssen alle mögliche Wahrnehmungen, mithin auch alles, was zum empirischen Bewußtsein immer gelangen kann, d. i. alle Erscheinungen der Natur, ihrer Ver-bindung nach, unter den Kategorien stehen, von welchen die Natur (bloß als Natur überhaupt betrachtet), als dem ursprünglichen Grunde ihrer notwendigen Gesetzmäßigkeit (als natura formaliter spectata), abhängt.“ (KrV B164-5 – Original kursiv, Hervorhebungen unsererseits)
Spätestens ab diesem Punkt kennt die Widersprüchlichkeit im Systeme Kants eigentlich keine Grenzen mehr!
9 Grundsätzliche Definitionen (Bedingungen, Kausalität, Ursache, Wirkung)
Der Hauptfehler Kants ist möglicherweise eine mehr oder weniger direkte Folge unseres oft unscharfen Sprachgebrauchs, insbesondere hinsichtlich der Begriffe: Bedingung, Ursache und Wirkung – Begriffe, die unglücklicherweise im Zusammenhang mit der Erkenntnistheorie Kants von höchster Wichtigkeit sind. Sehr viel “verdankt“ Kant in dieser Hinsicht seinem Vorgänger David Hume (1711-76) dessen Grundargumente der Kausalität er unwidersprochen übernimmt (auch wenn Kant mit seinen Schlüssen letztlich erheblich von Hume abweicht). Doch sehen wir uns zunächst einige relevante Definitionen an:
“Bedingung (lat. conditio ) ist der Grund der Möglichkeit eines Dinges (= rartio) bzw. die Ursache eines Ereignisses (= causa).“ – heißt es (u. a.) schlicht im Bertelsmann Lexikon (Jubi-läumsausgabe, 1964, S. 376) – eine Definition offenkundig so recht nach Kants Geschmack [ausführlichere Definitionen der B. → S. 78-81].
“Kausalität, neulat. causalitas >die Ursächlichkeit<, der Folgenzusammenhang von Ursache und Wirkung, die innerzeit-liche Abhängigkeit eines Geschehens von etwas anderem, durch das es bedingt, bestimmt bzw. eindeutig festgelegt ist.“ (Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Meiner Verlag 2005, Seite 341)
Selbiges Werk, selbe Seite, besagt unter dem Begriff Kausal-ge setz, Kausalitätsgesetz u. a (innere Querverweise lassen wir aus):
“Während also in bezug auf den Begriff der Kausalität und des K.es Übereinstimmung herrscht, ist seine Herkunft und durchgängige Gültigkeit umstritten. Im Sinne des transzenden-talen Idealismus von I. Kant beruht es auf einer apriorischen (erfahrungsunabhängigen) Denkform unseres Verstandes, im Sinne des Realismus bezeichnet es einen Realzusammenhang in notwendiger zeitlicher Folge. Dagegen betrachtet es der Neupositivismus, z. B. im Hinblick auf den Interdeterminismus des atomaren Geschehens, nur als Wahrscheinlichkeitsregel.“
Mit den soeben erwähnten Zitaten wird bereits ersichtlich, dass bezüglich der Ursache/Wirkungsrelation und des Kausalitätsbegriffs generell die Wissenschaft sich selbst sehr schwer tut und keine einheitliche letztlich für alle wissenschaft-liche Bereiche gültige Definition existiert. Die philosophische Disziplin der Logik macht da keine Ausnahme:
“Conditionals. ‘Conditional’ and ‘hypothetical’ are normally used synonymously before terms like ‘proposition’ or ‘statement’. Standardly a proposition of the conditional form, ‘If p then q’, is taken to entail its CONTRAPOSITIVE, ‘If not -q then not -p’. There are cases, however, whatever their ultimate analysis, which seem not to be of this kind, e.g. ‘If you want it, there is some bread here’ does not entail ‘If there's no bread here, you don't want it’.” (A.R. Lacey, A Dictionary of Philosophy, Routledge, 1986, Seite 40)
Bedingungssätze scheinen ohnedies im Bereich der Logik auf ganz besondere Schwierigkeiten zu stoßen, was u. a. als “paradoxes of material implication“ in der Philosophie allgemein bekannt ist. (Siehe z. B. I. M. Copi/C. Cohen, Introduction to Logic, Prentice-Hall, 2002, Seite 343.) Dabei sollte man aus allgemeiner Sicht annehmen, dass gerade die Logik an dieser Stelle weiterhelfen könnte. – Aber:
“Logic, however, has its disadvantages. One is that it only ever produces tautologies. If you want to find out something new, you can't use it – at best it may be able to help you identify something true out of something very confused.” (M. Cohen, Philosophy Problems, 2002, Seite 199)
Die Logik ist im Grunde nicht dazu da den Inhalt sprachlicher Formulierungen zu erforschen, als lediglich formale Fehler und Widersprüche zu vermeiden oder zu entlarven. – Kommen wir nun zum “Gewohnheitsrecht“ und “prägen“:
“Der Empirist Locke sagt: Wenn wir die ursächliche Verknüpfung zweier Vorgänge wahrnehmen, so erkennen wir hier eine Kraft, die zwischen den >>wirklichen<< Dingen (den Substanzen) wirksam ist. Der Skeptiker Hume sagt: Wir können gar keine kausale Verknüpfung wahrnehmen. Wir nehmen immer nur ein Aufeinanderfolgen wahr. Das Kausalitätsprinzip hat daher auch gar keine objektive Gültigkeit. Es ist nur eine Art (praktisch gerechtfertigtes) Gewohnheitsrecht. Kant sagt: Darin hat Hume ganz recht, daß das Kausalitätsprinzip nicht aus der Wahrnehmung abzuleiten ist. Es stammt nämlich aus dem Verstand. Und doch gilt es allgemein und notwendig für alle Erfahrung! Wie ist das möglich? Es kann gar nicht anders sein: Da alle Erfahrung so zustande kommt, daß der Verstand in den von der Sinnlichkeit gelieferten Rohstoff seine Denkformen (unter ihnen als eine der >>Relationen<< die Kausalität) einprägt, so ist klar, daß wir in aller Erfahrung diese Form auch wieder antreffen müssen!“ (H. J.
Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, 2003, Seite 458-9)
Wenn aber der Verstand in den sinnlichen Rohstoff seine Denkformen, u. a. diejenige der Kausalität einprägt, warum erscheint uns sodann gelegentlich der Zufall? Weil eben auch der Zufall eine Denkform ist, könnte Kant hier kontern? Wer die Wahl hat, hat die Qual – was ist das entscheidende Kriterium zwischen Zufall und Kausalität – beide sind a priori potentiell gegeben, wer oder was bestimmt aber wann das eine, wann das andere zum konkreten Einsatz kommt? Es wäre hier naheliegend den Zufall bei allen aposteriorischen -, Kausalität hingegen bei allen apriorischen Aspekten anzusetzen. Da alle Sinnlichkeit a posteriori ist, müsste alle sensuelle Erfahrung zufälligen Charakter führen – was bliebe sodann jedoch der Kategorie der Kausalität noch übrig? Nichts! Zumindest nichts, was mit Em-pfindungen direkt zusammenhängt. Das wiederum widerspricht höchst eklatant dem eigentlichen Nutzen der Kategorien insge-samt, deren ausdrückliche Eigenschaft ist ja gerade, gemäß Kant, den sinnlichen “Rohstoff“ überhaupt zu ordnen. Ohnehin: wozu eine Kategorie des Zufalls, wenn jener Rohstoff an sich bereits ungeordnet zufällig ist – wozu eine Kategorie der Kausalität, wenn alles Apriorische ohnehin notwendig ist?
Nun, die Kategorie (der Relation) Kausalität ist natürlich bei Kant vor allem ein Mittel um sinnliche Eindrücke zu ordnen, die Kategorie (der Modalität) Zufall könnte man so verstehen, dass sie jene der Kausalität gewissermaßen zeitweilig abschaltet – da kommt das folgende Zitat doch wie gerufen:
“Der absolute Z. [Zufall] setzt das Gesetz der KAUSALITÄT außer Kraft.“ (Alexander Ulfig, Lexikon der Philosophischen Begriffe,
Fourier Verlag, nachzulesen unter dem Begriff: Zufall, S. 492)
Das wiederum wirft sofort die Frage auf: wann gilt der Zufall, wann gilt kausale Notwendigkeit? Eine analoge Frage wäre etwa: wann esse ich, wann trinke ich? Die Antwort zur letzten Frage dürfte in der Regel keine Schwierigkeiten machen – bei der ersten fällt das schon weit schwieriger. Die Zufälligkeit der empirischen Empfindungen, und das ist ein generelles Problem Kants auf das wir später noch zurückkommen werden, bietet jedenfalls an sich kein Indiz für irgendwelche bestimmte Anwendung der Kategorien überhaupt.
Wenn die empirische Anschauung Kants einen Zweck haben soll, so muss sich die Anwendung der Kategorien nach jener Anschauung richten. Verstand, der sich nur nach sich selbst richtet, könnte getrost auf alles Äußere, Empirische verzichten, der Preis dafür wäre allerdings: der Idealismus. Agiert der Verstand hingegen gemäß der empirischen Anschauung, so setzt dies exakte Differenziertheit innerhalb jener Anschauung voraus, die sich sodann jedoch mit deren gleichzeitig unterstellter Zufälligkeit nicht mehr verträgt und zudem ein kapitaler Sprung zum Realismus beinhalten würde, den Kant als Mittler zwischen den rivalisierenden philosophischen Systemen seiner Zeit sich ganz einfach nicht erlauben kann.
“Die Zeiten, in denen Kausalität das Charakteristikum von Wissenschaft-lichkeit war, scheinen sich ihrem Ende zu nähern. Zu Ende ginge damit die Epoche einer Wissenschaftsauffassung, deren Ursprünge bis in die griechische Antike zurückreichen. Dass man die ’Wahrheit nicht getrennt von der Ursache wissen’ könne, hatte Aristoteles seiner Begründung der Wissenschaft vorausgesetzt (Met. 993b23) und war auch noch zu Beginn der neuzeitlichen Wissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert weithin unbestritten. Als philosophischer Vorbote einer tiefgreifenden Krise dieser Wissenschaftsauffassung gilt heute die von David Hume im 18. Jahrhundert geleistete Kritik der Kausalität. Hume bestritt die traditionell angenommene Notwendigkeit der Verbindung von Ursache und Wirkung und führte die Annahme einer kausalen Relation auf die blosse Beobachtung einer regelmäßigen Abfolge von Ereignissen zurück. Nachdem die in der neuzeitlichen Wissenschaft anfänglich noch dominierende kausale Begrifflichkeit zunehmend durch Gesetzesbegriffe expliziert und teilweise auch verdrängt worden war, verschafften sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts Stimmen Gehör, die für die Naturforschung grundsätzlich einen Verzicht auf den Begriff der Ursache verlangten (z.B. G. Kirchhoff und E. Mach).
Seit dem Beginn unseres Jahrhunderts ist dann die seit langem schwelende Krise des herkömmlichen Kausalitätsverständnisses auf verschiedenste Weise unübersehbar zum Ausdruck gekommen: In der Physik konnten zuerst die Relativitäts- und die Quantentheorie und in jüngster Zeit Chaostheorien als Begrenzung der Geltung des Kausalprinzips interpretiert werden; in der Biologie liessen sich vor allem evolutionäre und selbstorganisierende Prozesse nur bedingt kausal erklären; traditionelle Verständnisweisen der Kausalität, die ehemals den Wissenschaftsbegriff bestimmt hatten, konnten sich nur noch in einem Teil der Geistes- und Sozialwissenschaften halten; und schliesslich entwickelte sich eine intensive und bis heute andauernde wissenschaftstheo-retische Diskussion um den Kausalitätsbegriff, in der sein Nutzen für die wissenschaftliche Arbeit wiederholt in Frage gestellt worden ist.“
(Gregor Schiemann, Ohne Telos und Substanz: Grenzen des Naturwissen schaftlichen Kausalverständnisses, Quelle: Internet: http://www.bu.edu/wcp/Papers/Scie/ScieSchi.htm)
Bei einem insgesamt dermaßen unbestimmten, wenn nicht chaotischen Sachverhalt bezüglich der Ursache/Wirkungs-Relation allgemein – und wir haben soweit jenes Thema erst angeschnitten – kann man sich leicht denken, dass Kant analog zu katastrophalen Fehlern verleitet wurde.
“’Bedingungen’
Eine terminologische Deutung auf dem Hintergrund der Subjekt-Objekt-Differenz. Bedingung ist ein Oberbegriff. Man unterscheidet logische, ontische und transzendentale Bedingung.
logische Bedingung : Sie geht in einen Vollzug mit ein, ist im Vollzug unthematisch mitgesetzt. Sie betrifft den Inhalt (Geltung und Berechti-gung der inhaltlichen Setzung). [Das ist leider äußerst vage formuliert!]
ontische Bedingung (faktische Voraussetzung): Sie geht nicht in den Vollzug ein. Sie ist als wirklich vorausgesetzt, wenn der Vollzug funktionieren soll.
transzendentale Bedingung : Sie geht in den Vollzug ein. Sie ist dort unthematisch mitgesetzt, aber sie betrifft nicht das Vollzogene (die inhaltliche Setzung), sondern den Vollzug. Eine transzendentale Bedingung ist z. B. das Verstehen von Sein.“ (Ao. Prof. G. Pöltner, 1995, unter 4.4: Die evolutionäre Erkenntnistheorie, Quelle: Internet)
(Mit dem soeben zitierten Begriff: “Vollzug“ ist sicher ein bestimmter erkenntnistheoretischer Inhalt an sich gemeint.) Jene zitierte Differenzierung des Begriffs der Bedingung kommt unserer Unterscheidung zwischen Rahmen- und Kernbedingungen (Seite 88-91) recht nahe.
Professor Pöltner bezieht in jenem Internetbeitrag u. a. auch Stellung zur “Energiefrage“ im erkenntnistheoretischem Rang:
“Wechselwirkungspostulat: Unsere Sinnesorgane werden von der realen Welt affiziert, d. h. die Oberfläche unseres Körpers tauscht mit der Umgebung Energie aus. Einige solcher Energieaustausche werden als Reize verarbeitet, im Gehirn dann weiterverarbeitet, interpretiert als Information über die Außenwelt und bewußtgemacht.“ (Ao. Prof. G. Pöltner, siehe oben)
Hier geht es allerdings offensichtlich zunächst um rein physikalische Aspekte und nicht (oder zumindest soweit wie zitiert noch nicht) um rein theoretische Kriterien einer Information an sich. Bereits auf Seite 21 unserer Diskussion wurde erwogen, ob nicht Information an sich als eine Energieform zu behandeln sei (auch → S. 120-4).
Von jener Energiefrage einmal ganz abgesehen hätte Kant, sozusagen aus eigener Tasche, die Möglichkeit gehabt von selbst auf seinen Hauptfehler zu kommen, was u. a. die folgenden Zitate andeuten:
“Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetz der Ver-knüpfung der Ursache und Wirkung.“ (KrV B232 – Original kursiv)
“[...] aus nichts wird nichts [...]“ (KrV A185)
“Daher ist der Satz: nichts geschieht durch ein blindes Ohngefähr, (in mundo non datur casus,) ein Naturgesetz a priori; imgleichen, keine Notwendigkeit in der Natur ist blinde, sondern bedingte, mithin verständliche Notwendigkeit (non datur fatum).“ (KrV A228/B280)
“[...] alles Zufällige hat eine Ursache, [...]“ (KrVA243/B300)
Jene kurzen Feststellungen beruhen in der Hauptsache auf dem sogenannten “Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz“:
“Bei allem Wechsel der Erscheinungen beharret die Substanz, und das Quantum derselben wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert.“ (KrV A182 – Original kursiv)
Kant zitiert mehrfach den “Satz vom zureichenden Grunde“, so z. B. in KrV A201 und Prolegomena unter § 3.
Kant zitiert ebenfalls mehrfach das sogenannte “Prinzip der Kontinuität“:
“Das Prinzip der Kontinuität verbot in der Reihe der Erscheinungen (Veränderungen) allen Absprung (in mundo non datur saltus), aber auch in dem Inbegriff aller empirischen Anschauungen im Raume alle Lücke oder Kluft zwischen zwei Erscheinungen (non datur hiatus); denn so kann man den Satz ausdrücken: das in die Erfahrung nichts hinein kommen kann, was ein vacuum bewiese, oder auch nur einen Teil der empiri-schen Synthesis zuließe. Denn was das Leere betrifft [...]“
(KrV A229/B281)
Das wird nachfolgend noch etwas deutlicher:
“Nun hat jede Veränderung eine Ursache, welche in der ganzen Zeit, in welcher jene vorgeht, ihre Kausalität beweiset [merkwürdige Ausdrucksform Kants]. Also bringt diese Ursache ihre Veränderung nicht plötzlich (auf einmal oder in einem Augenblicke) hervor, sondern in einer Zeit, so, daß, wie die Zeit vom Anfangsaugenblicke a bis zu ihrer Vollendung in b wächst, auch die Größe der Realität (b-a) durch alle kleinere Grade, die zwischen dem ersten und letzten enthalten sind, erzeugt wird. Alle Veränderung ist also nur durch eine kontinuierliche Handlung der Kausalität möglich [...]“ (KrV B254)
Kant ist bezüglich des Aspektes der Kausalität durchweg nicht direkt oberflächlich. Umso erstaunlicher ist es allerdings, dass er exakt diese Gründlichkeit hinsichtlich seiner Kategorien und Anschauungsformen nicht beibehält. Andererseits hätte er erkennen müssen, dass unter seinen entsprechend eigens konstruierten Formulierungen fixe Umstände grundsätzlich als Ursachen ausscheiden. Denn ein plötzlicher Sprung tritt unwei-gerlich ein, wenn fixe Umstände als Ursachen zugelassen sind.
“Alle Veränderung ist nur durch eine kontinuierliche Hand-lung der Kausalität möglich [...]“, sagt Kant selbst (KrV B254).
Wie aber soll man sich eine “kontinuierliche Handlung“ vor-stellen, wenn, zum einen, feste starre Bedingungen, scheinbare Ursachen, auf eine sich verändernde Wirkung, zum anderen, zusammentreffen.
Für Kants ist es offenbar völlig in Ordnung, wenn sich auf der Seite der Wirkung eine Veränderung vollzieht, während seitens der Ursache alles bleibt wie gehabt.
Jenes Zusammentreffen ist jedenfalls ohne einen kapitalen Sprung unvermeidbar – akkurat in dem Moment, wo starre fixe Vorgaben von Seiten der Ursache auf eine sich verändernde Situation auf Seiten der Wirkung treffen – genau jenen Sprung, den es laut Kants eigener Forderung, die Kontinuität betreffend, absolut zu vermeiden gilt (KrV A229/B181, B254).
Ein statisch ruhender fixer und daher passiver Umstand (eine Bedingung) ist an und für sich keine “kontinuierliche Hand-lung “. Letztere erfordert vielmehr definitiv eine aktive Haltung, und damit verbunden: eine gewisse Veränderung des ursächli-chen Umstandes der Ursache selbst und zwar proportional zur Veränderung und Wirkung des solchermaßen Bedingten.
Lässt man fixe Bedingungen und Vorgaben, Gesetze, starre Regeln usw. als Ursachen zu, so verstößt man zudem gröblichst gegen den ebenfalls von Kant selbst erwähnten Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz, KrV A182, (der wohl im Einklang des etwas moderner klingenden Satzes von der Erhaltung der Energie und die daraus resultierende prinzipielle Unmöglichkeit eines sogenannten Perpetuum mobile, steht). Eine Wirkung mit der eine Energieübertragung auf das Bedingte verbunden ist, muss diese Energie von der Ursache erhalten.
Will man den Satz der Beharrlichkeit der Substanz (bzw. der Erhaltung der Energie) nicht verletzen, so muss man folgern, dass eine Ursache sich grundsätzlich im Ganzen negativ verändert, direkt proportional zu der positiven Veränderung des Bedingten bzw. zu der involvierten positiven Wirkung insge-samt.
Kant hätte demnach, wie erwähnt, die Mittel gehabt die Unmöglichkeit seines Transzendentalen Idealismuses zu erken-nen, was folgende Gedankengänge noch (indirekt) zusätzlich unterstützen mögen:
Das Prinzip einer jeden mathematischen Verhältnisgleichung ist, dass wenn sich auf der einen Seite jener Gleichung etwas insgesamt verändert, diese Veränderung sich insgesamt exakt auf die andere Seite überträgt.
Fasst man einen Ursache/Wirkungs-Komplex als eine solche Gleichung auf, so wird sofort offenkundig, dass es absolut nicht sein kann, dass sich auf der Seite der Wirkung im Ganzen etwas verändert, während auf der Seite der Ursache alles insgesamt bleibt wie gehabt.
Das Grundprinzip jeglicher Ursache ist (aus unserer Sicht) Aktivität (in positiver Bedeutung). Ein statisch fixer Umstand kann eine Bedingung sein, jedoch keine tatsächliche Ursache im absoluten Tenor. Eine Ursache erfordert generell eine flexible dynamische Haltung des Verursachers. Wer Boxen will muss Schläge austeilen können und sollte sich nicht darauf verlassen, dass eventuelle Gegner sich bereits durch den bloßen äußeren Schein in die Knie zwingen lassen.
Damit wir beim aktuellen Stand unserer Diskussion nicht aneinander vorbeireden, sollten wir uns das Folgende nochmals klar vergegenwärtigen:
Zur Entstehung einer Sinnesinterpretation gehört, gemäß Kant, nebst den fest vorgegebenen apriorischen subjektiven Verstandeskategorien und Anschauungsformen der Zeit und des Raumes, natürlich die Apprehension (Wahrnehmung) äußerer Em-pfindung, die wiederum dadurch gegeben ist, dass sogenannte Dinge an sich selbst auf unsere Sinne einwirken – sie affizieren. Somit könnte man durchaus jene Affektion durch die Dinge an sich selbst als Ursache auffassen, wenn nicht Kant gleichzeitig den Begriff der Ursache als durch die Kategorien subjektiv vorgegeben erklärt, was hier einen absoluten Blick untersagt.
Zudem fehlt gemäß Kant allem Empirischen und damit aller bloßen Sinnesinformation die Notwendigkeit. Notwendigkeit ergibt sich erst mit apriorischen erfahrungsunabhängigen Kriterien, die jedoch erst ab der Stufe der subjektiven Verstandes-kategorien und reinen Anschauungsformen gegeben ist.
Daher konzentriert sich bei Kant bezüglich der Ursache unserer Sinnesinterpretation alles auf jene subjektiven fest vorgegebenen Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung (Verstandeskategorien und reinen Anschauungsformen) und nicht etwa auf die Wirkung der Dinge an sich selbst auf unsere sensuellen Organe (Affektion). Wir sind allerdings im Begriff zu beweisen, dass, entgegen Kant, fest vorgegebene fixe Aspekte grundsätzlich als Verursacher ausscheiden.
Kant erkennt augenfällig nicht, dass die von ihm eigens durchgängig unterstellte Abhängigkeit aller Erfahrung von subjek-tiven Bedingungen der Erfahrung zu dem von ihm ebenfalls kontinuierlich unterstellten empirischen Charakter aller Erfah-rung einen Widerspruch beinhaltet (→ u. a. S. 192). Erfahrung erhält durch die subjektiven Bedingungen (d. E.) einerseits notwendigen Charakter, und dennoch bleibt sie insgesamt empirisch, zufällig, da sie empirische Elemente enthält. Demnach werden jene empirischen Elemente nicht von den notwendigen subjektiven Bedingungen (d. E.) erfasst, andernfalls müssten alle sogenannten empirischen Elemente den notwendigen Charakter der subjektiven Bedingungen (d. E.) führen.
Bliebe Kant in diesem Punkt durchgehend konsequent, dürfte unsere Erfahrung letztlich, keine “empirischen Elemente“ ent-halten, da alle Erfahrung durch den notwendigen Charakter der subjektiven Bedingungen (d. E.) geprägt ist (Kant), und daher auch alle jeweiligen, ursprünglich empirisch-zufälligen Elemente. Es kann nicht sein, dass Kant einerseits absolut alle Erfahrung subjektiven Bedingungen unterstellt und andererseits er dennoch alle empirischen Elemente jener Erfahrung exakt an jenen subjektiven Bedingungen vorbeimogelt (→ S. 58, 74-7).
Das könnte man auch folgendermaßen umschreiben:
“Zwar ist dabei eindeutig, wodurch in der Wahrnehmung als äußerer Erfahrung bestimmt wird, nämlich durch den Begriff und damit durch das Denken des Verstandes. Zweideutig aber bleibt dabei, was durch diesen Begriff des Verstandes bestimmt wird.“ (Prauss, G. Einführung in die Erkenntnistheorie, 1980, 1993, S. 67)
Davon abgesehen, Kant behandelt fälschlicherweise jede Wirkung, aus Sicht der Ursache, quasi wie ein völlig energieloses Vakuum. Ursache und Vakuum sind jedoch generell inkompatibel was bedeutet, dass beide nicht gegenseitig auf sich wirken können. Ein Vakuum kann definitionsgemäß keine Energie übernehmen – folglich kann eine Ursache keine Energie an ein Vakuum abgeben. Da also eine Ursache ein Vakuum prinzipiell nicht beeinflussen kann (denn Einfluss wäre in diesem Sinne nicht zuletzt mit Energieaustausch verbunden) setzt jede Wirkung einer Ursache eine von der Ursache zunächst unabhängige kompatible Grund-kraft (bzw. Energie) voraus, auf die sodann die Ursache wirken kann, womit notwendigerweise eine Rückwirkung von der Grundkraft der Wirkung auf die Kraft der Ursache, und damit auf die Ursache selbst, stattfindet. Die Tatsache, dass wir dies lediglich am Rande vermerken besagt nicht, dass es relativ unbedeutend wäre.
Bedingte Aspekte zeigen zuweilen sehr deutlich Eigenschaften, die durch eine entsprechende Bedingung vorgegeben sind. Spontan ließe sich im Sinne Kants (→ S. 102-4) demnach leicht mutmaßen, dass jene Bedingung die Ursache jener bedingten Eigenschaft des Bedingten sei. Dies hätte jedoch unweigerlich zur Folge, dass jener Ursache exakt jene Eigenschaft abhanden kommt, will man eine unzulässige Erhöhung des Energieniveaus insgesamt vermeiden. Sehen wir uns nochmals einen Teil des Zitats von H. J. Störig (→ Seite 112) an:
“Da alle Erfahrung so zustande kommt, daß der Verstand in den von der Sinnlichkeit gelieferten Rohstoff seine Denkformen (unter ihnen als eine der >>Relationen<< die Kausalität) einprägt, so ist klar, daß wir in aller Erfahrung diese Formen auch wieder antreffen müssen!“
(Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, 2003, S. 459)
Offenbar handelt es sich hier im Grunde um eine energielose Art der Informationsübertragung, bzw. Informationsbeeinflus-sung. Das ist eine allgemein gängige letztlich jedoch irrtümliche Auffassung, der nicht zuletzt Kant völlig erlegen ist.
Information – und damit Sprache generell – ist letztlich kein rein theoretisches Gebilde für sich, sondern ein Synonym der realen Welt. Die Vermittlung von Information erfordert eine gewisse Beachtung praktischer Aspekte, u. a. bezüglich der Energie, wie dessen reale Materialisierung in Form üblicher physikalischer Objekte. (Siehe dazu u. a. auch die Seiten 21, 115.)
Aber Vorsicht hier! Energie ist nicht gleich Intelligenz. Eine gewisse Kraft gehört, praktisch wie rein theoretisch, notwendi-gerweise zur Informationsvermittlung. Das eigentliche Wesen der Information ist jedoch Differenz und nicht Kraft. Diese Unterscheidung spielt später noch eine große Rolle (→ S. 155-6).
“Ein ganzes Bündel von Problemen rankt sich um Kants Auffassung von Raum und Zeit als reinen Anschauungsformen. a) Müssen wir bei-de nicht doch als Eigenschaften der Dinge, als Struktureigenschaften der Materie und ihrer bestimmten Energieverhältnisse denken, wie es die Entwicklung der Relativitätstheorie nahe legt? Einstein selbst und Hans Reichenbach haben Kant in dieser Weise kritisiert.“
(H. M. Baumgartner, Kants „Kritik der reinen Vernunft“, 1985, S. 142)
Davon abgesehen, Störig wie Kant, wie bei weitem die Mehrzahl aller diesbezüglicher Kommentatoren übersehen, dass “einprägen“ mit oben zitierter Signifikanz lediglich funktioniert, wenn das Ein-zuprägende bereits im jeweils zu behandelnden Aspekt potentiell vollständig vorliegt. Dieses sogenannte “Einprägen“ erfordert zu-dem eine prinzipielle Wesensgleichheit zwischen aktivem Stempel und passivem Aktionsempfänger, die im vorliegenden Zusammen-hang allerdings nicht gegeben ist, wie Kant selbst feststellt:
“Nun sind aber reine Verstandesbegriffe, in Vergleichung mit empi-rischen (ja überhaupt sinnlichen) Anschauungen, ganz ungleichartig [...]
Nun ist klar, daß es ein Drittes geben müsse, was einerseits mit der Kategorie, andererseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß, und die Anwendung der ersteren auf die letzte möglich macht [...] Eine solche ist das transzendentale Schema.“ (KrV A137-8/B176-7)
Mit Rücksicht auf das Energieniveau insgesamt, lässt sich eindeutig sagen, dass fixe Vorgaben mit gesetzlichem Charakter, wie etwa Kants Kategorien und Anschauungsformen, starre Regelungen und derglei-chen, prinzipiell keine tatsächlichen Ursachen darstellen können. Fixe Vorgaben und starre Bedingungen mögen wiederholt und somit relativ dauerhaft quasi als Schlüssel zu Ursachen fungieren, sie können jedoch nicht selbst als tatsächliche Ursachen auftreten und gleichzeitig ihren fixen, eindeutig fest vorgegebenen Charakter beibehalten.
Schlüssel sind nutzlos ohne Schloss. Etwas Bedingtes weist, im unmittelba-ren Grenzbereich Merkmale der entsprechenden (Rahmen-) Bedingung auf – Stempel und Prägung haben in jenem Grenzbereich notwendigerweise identische Aspekte. Dieser Umstand besagt jedoch nicht, dass jene Merkmale des Bedingten tatsächlich von der Bedingung stammen, sondern lediglich, dass beide Merkmale identisch sind – nicht mehr und nicht weniger (was allerdings im Allgemeinen wie in Fachkreisen durchweg völlig anders gesehen wird). Ein prägender Stempel ist bei genauer Betrachtung kein Verursacher, sondern lediglich ein Vermittler – wäre er tatsächlicher Verursacher, würde er das was er prägt, exakt in dem Moment, wo er es prägt, an das zu prägende Objekt abgeben und würde damit seine vormalige “Stempelfähigkeit“ (allmählich) verlieren.
Fixe Bedingungen als pauschal standardisierte Ausgangssituation für verhält-nismäßig breitgefächerte wiederholte Anwendungen sind grundsätzlich sogenannte “Rahmenbedingungen“ mit Schlüsselfunktion, sie sind bestenfalls Mittler – jedoch keine wirklichen Verursacher. Sie erfüllen erst dann einen möglichen Zweck, wenn sie durch Kernbedingungen gedeckt sind.
Unsere Sinneseindrücke mögen tatsächlich geprägt sein durch relativ fixe subjektive Gegebenheiten verschiedenster Art (Verstandeskategorien usw.). Das kann jedoch nur funktionieren, wenn jenen Eindrücken der zu prägende Inhalt, insbesondere entgegen Kant, äußerlich bereits potentiell vollständig vorliegt.
10 Resümee des Hauptteils
Man könnte die ganz wesentlichen Argumente unserer zurück-liegenden Diskussion, Kapitel 4 bis 9, nicht zuletzt aufgrund hintergründigem Bezug zu unserer Kant-Hypothese, S. 84-5, folgendermaßen gesetzmäßig festhalten:
1. Bedingungen sind nur dann tatsächliche Ursachen des Bedingten, wenn sie sich im umgekehrt proportionalen Verhältnis zur unmittelbaren Veränderung auf Seiten der Wirkung ebenfalls verändern.
2. Dauerhaft fixe Vorgaben, Gesetze, Regelungen usw. kön-nen keine echten Ursachen sein. Sie können allerdings, quasi als Rahmenbedingungen, entscheidende Schlüsselfunktion (bzw. Alles-oder-Nichts-Funktion) übernehmen, und somit real erschlie-ßen, was bereits potentiell vorliegt.
Ein Gadankenexperiment: Ein Junge schießt einen Ball gegen eine massive stabile Ziegelsteinmauer – der Ball prallt ab und fliegt zum Jungen zurück. Wer ist in diesem Falle für das Zurückfliegen des Balles verantwortlich, der Junge oder die Mauer? Aus unserer Sicht der Junge, denn die Mauer verändert sich in keiner Weise und scheidet somit als Verursacher aus.
Der Junge wird hingegen behaupten, dass er den Ball von-sich-weg und nicht zu-sich-hin geschossen hat. Die Richtung in welcher der Ball fliegt ist jedoch ein völlig relativer Aspekt ohne jeglichen Tenor zu jenem Energieniveau. Dass der Ball vorwärts fliegt, wenn er vorwärts geschossen wird ist keineswegs notwendigerweise der Fall – er könnte prinzipiell in jede beliebige Richtung mar-schieren, wenn ihm bestimmte Wege versperrt wären. Dass der Weg nach vorne frei ist, so komisch das auch klingen mag, ist in dieser speziellen Relation eher ein zufälliger als notwendiger Umstand, der u. a. beim Billardspiel genutzt wird.
Die Farbe Rot, etwa, die durch eine gefärbte Linse scheinbar erzeugt wird ist bereits potentiell im weißen Lichtbündel vor dem Passieren der Linse voll enthalten – sie wird also lediglich aus jenem weißen Lichtbündel herausgefiltert. Ein jeweiliger Vergrößerungs- oder Verkleinerungseffekt einer gewölbten Linse zeigt lediglich den einen oder anderen relativen Aspekt zwischen Subjekt und be-obachtetem Objekt an, ohne dass dabei tatsächlich eine Erzeugung im Spiel wäre.
Eine Linse ist als relativ fest vorgegebene, unveränderliche Einheit (wie die Mauer im vorherigen Beispiel) aus unserer Sicht lediglich eine Rahmenbe-dingung bzw. eine Art Schlüssel mittels der/dem einige spezielle Eigenschaften jenes Lichtstrahls für Sterbliche, denen jene speziellen Eigenschaften im Normalfall nicht offenkundig sind, erschlossen werden.
Daher ist hier die vermeintliche Veränderung letztlich keine Erzeugung im schöpferischen Sinne, als lediglich eine Art der Offenbarung dessen was ohne-dies potentiell bereits vollständig vorliegt.
Kant macht sich offenkundig eine gewisse allgemeine Unsi-cherheit den Begriff der Bedingung betreffend (→ S. 78-81, 11-5) zunutze. Zunächst sieht er die subjektiven Bedingungen d. Möglichkeit d. Erfahrung mit lediglich formalem, logischem Bezug (→ u. a. S. 81-4) was unseren Rahmenbedingungen entspre-chen würde (→ S. 89). Kant zielt jedoch nicht wirklich auf die bloße äußere Form, er zielt vielmehr auf den Inhalt jener Form, was er besonders in der erwähnten Art “weil ohne ...“ (→ u. a. S. 110) unwillkürlich zum Ausdruck bringt. Direkt auf diesen Widerspruch (zwischen logischem und inhaltlichem Bezug) angesprochen, käme Kant in höchste Verlegenheit. Er braucht generell ein Standbein im allgemeinen, notwendigen, objektiven Bereich – gleichzeitig benötigt er jedoch direkte inhaltliche Beziehung zum Individuellen. Diese inhaltliche Bindung zwi-schen apriorischer formaler Bedingung und dem Individuellen des Bedingten kann er nur dadurch erreichen, indem er seine vorgeblich logischen Bedingungen (d. M. d. E.) mit absolutem Charakter der Form “weil ohne“ ausrüstet und damit gegen seine eigene logische Basis rebelliert. Diese Palastrevolution versteht Kant allerdings meisterhaft zu vertuschen – wer sich zu eng mit der KrV befasst wird fast zwangsläufig von deren schierer Komplexität geistig gefangen.
Mit diesem Bruch zur eigenen Basis, provoziert Kant geradezu weitere Widersprüche, die in der Tat nicht lange auf sich warten lassen (wie wir später noch sehen werden).
Der erkenntnistheoretische Hauptteil wäre damit im Wesent-lichen abgeschlossen, wir ziehen hier jedoch keine radikale Grenze, da er noch deutlich bis in den Karnickelbereich nachhallt [Original], mit durchweg relativ fließenden Übergän-gen. In den bald folgenden Kapitel 12 bis einschließlich 20 gehen wir in weitere Details die sich überwiegend mit den soeben ange-deuteten weiteren Widersprüchen im Systeme Kants befassen.
Zunächst aber erlauben wir uns mit Kapitel 11 einen Ausflug ins eher psychologische Lager (ohne direkten Bezug zu Kant).
11 Psychologische Wirkung in sich geschlossener bzw. fixer Aspekte (Fernsehen, Farben, Bilder usw.)
Unterstellt man, dass die wesentlichen Argumente der zurück-liegenden Diskussion im Grunde ihre Richtigkeit haben, so hätte dies nicht zuletzt einige markante psychologische Folgen:
Fernsehen, z. B. beeinflusst nach allgemeiner Auffassung die Menschen in unserer Gesellschaft ganz erheblich. Aus unserer Sicht beschränkt sich dieser Einfluss jedoch eher auf Wirkungen im negativen Bereich. Denn als positive, schöpferi-sche Ursache kann nur gelten, was sich zur nachfolgenden Wirkung selbst verändert. Eine Fernsehdarbietung verändert sich selbst jedoch in keiner Weise zu der (scheinbaren) Wirkung auf einen Fernsehzuschauer, demnach kann (aus unserer Sicht) jene künstliche Darbietung letztlich nicht tatsächlich auf eventuelle Zuschauer einwirken.
Die Repräsentation einer Fernsehübertragung mag daher noch so gestochen scharfe Bilder liefern und in jeglicher technischer Hinsicht noch so perfekt sein, und Einblicke erlauben, die dem Durchschnittsbürger in der Regel völlig versagt bleiben – die künstlich vermittelten Erlebnisse bleiben im Verhältnis zu sogenannten realen persönlichen Erfahrungen in jedem Falle grundsätzlich minderwertig. Fast könnte man meinen:
Ein Fernsehzuschauer sieht entweder alles oder nichts und genau deswegen sieht er eigentlich gar nichts. D. h. er wird sich der gebotenen Information verstandesmäßig jedoch weniger (falls überhaupt) gefühlsmäßig bewusst – paradoxerweise wird er sich umso weniger jener Information (seelisch) bewusst, je perfekter sie ihm präsentiert wird.
Eine verhältnismäßig gefühlvolle persönliche Erfahrung erfordert, dass die betreffende Person selbst aktiv am jeweiligen Geschehen in irgendeiner Form teilnimmt und somit dieses Geschehen mitbeeinflusst – unabhängig vom Grad des persönlichen Einflusses jener Gesamtrelation, vorausgesetzt dieser Grad verläuft nicht nahe Null.
Beim Fernsehen ist jener Grad jedoch nicht lediglich “nahe Null“, sondern exakt Null. Der schlechteste Platz im Stadion oder im Theater ist in dieser etwas eigenwilligen Betrachtung der besten Fernsehübertragung überlegen. Ein Zuschauer im Stadion kann mit einem mittelmäßigen Kraftausdruck aktiv eine, wenn auch insgesamt vielleicht nicht unbedingt spielentschei-dende Wirkung erwarten, ein Fernsehzuschauer kann hingegen vor dem Kasten toben wie er will – er bewirkt somit nicht den allergeringsten Einfluss auf die dargebotene Handlung. Das muss langfristig zwangsläufig nicht lediglich frustrieren, es muss zudem abstumpfen, bis hin zu totaler Verblödung!
Zudem hat der Betrachter im Theater oder in der Arena eher das Gefühl: “Ich bin dabei!“ – während beim Fernsehen der Eindruck: “Ich steh nur außen vor!“ – trotz aller scheinbaren Vorzüge jener Technik nicht wegzubekommen ist. Man gehört besonders bei einer Fernsehübertragung weder physisch noch in der Phantasie zu der gebotenen Handlung dazu.
Dem mag man soweit zustimmen oder nicht, die prinzipielle Unmöglichkeit eine Fernsehrepräsentation (oder Vergleichba-res) von Seiten eines Zuschauers beeinflussen zu können hat eventuell unterbewusst unwillkürlich die Folge, dass man bestenfalls verhältnismäßig oberflächlich zur korrespondie-renden Handlung mitfühlen kann.
Der Rundfunk oder das Lesen eines Romans sind Aspekte die an und für sich mit der gleichen Problematik behaftet sind. Auch hier werden fix- und fertige geistige Produkte angeboten, auf welche die Bezogenen keinerlei Einfluss haben, was die Qualität der vermittelten Erlebnisse generell in Frage stellt. Allerdings hat beispielsweise ein Leser oder ein Radiohörer im Vergleich zum Fernsehzuschauer erhebliche indirekte Möglichkeiten auf das jeweilige Geschehen Einfluss zu nehmen. So bestimmt er bis zu einem gewissen Grade selbst das Tempo (zumindest beim Lesen) und übernimmt vollständig die entsprechende Kameraführung, womit er insgesamt erheblichen Einfluss – zwar nicht auf das Buch (oder Hörspiel) an sich (aber darauf kommt es in diesem speziellen Blick auch nicht unbedingt an) – so jedoch auf die innere Repräsentation jenes Erlebnisses.
Denn was im letzteren Fall tatsächlich erlebt wird, hängt weitgehend von der eigenen Phantasie ab, während beim Fernsehen der eigenen Phantasie kaum Spielraum geboten wird, ganz einfach, weil mehr oder weniger alles bis aufs Kleinste vorgegeben ist. (Entscheidend ist in diesem Zusammenhang also die prinzipielle Möglichkeit von subjektiver Seite Einfluss auf objektive Ereignisse ausüben zu können und sei es auch nur in der Phantasie. Wenn von objektiver Seite bereits relativ detaillierte Information vorliegt – Beispiel: Fernsehen – so schränkt dies notwendigerweise den Einflussbereich der eige-nen Phantasie ein, wobei es an und für sich jedoch keine Rolle spielt ob es dabei um einen realen Ursprung, einen Roman, ein Märchen, um eine technische Animation, um ein Buch, um das Radio, das Fernsehen, (usw.) geht.
Dass Fernsehkonsum nicht unbedingt förderlich für die Phantasie Jugendlicher ist, wird allgemein zuweilen vermutet – wir hätten zu jener allgemeinen Vermutung hiermit, zumindest im Ansatz, eine theoretische Grundlage zu bieten, die darüber hinaus das Fernsehvergnügen generell in Frage stellt. Dabei ist jenes Medium womöglich gerade für ältere Menschen eine Gefahr, die sich unwillkürlich durch den vorwiegend blendenden, äußeren, jugendlich-betonenden Charakter jenes Mediums zusätzlich als abgestellte nutzlose minderwertige Individuen vorkommen – vorkommen müssen – und demnach durch das Fernsehen sehr leicht frustriert werden, trotz aller Unterhaltung.
Farben beeinflussen offensichtlich unsere Psyche was sich u. a. deutlich in Architektur, Mode und in der (rein kommerziellen wie biologisch-natürlichen) Werbung zeigt. Rötliche Töne gelten allgemein als anregend, bläuliche (und auch grüne) hin-gegen eher als beruhigend. Allerdings existiert keine allgemein-gültige, erfahrungswissenschaftliche Begründung der Farben-wirkung auf unser Gemüt (zum Teil aus: Wörterbuch Psychologie, W. D. Fröhlich, Deutscher Taschenbuch Verlag, 24. Auflage 2002, Seite 179). Das überrascht aus unserer Sicht nicht sonderlich. Von unserem Standpunkt gesehen ist hingegen eher überraschend, dass Farben als fixe Vorgaben überhaupt irgendwelche seeli-schen Wirkungen haben können. (Allerdings spricht unser Gefühl allgemein wohl eher auf akustische als auf optische Reize an, → S. 172.)
Nicht nur die angebliche Wirkung von Farben, sondern darüber hinaus jene des Wissens und fixer Vorgaben (Idealen, Universalien) generell, lässt sich vorneweg anzweifeln, worauf wir etwas später im Zusammenhang mit der Objektivität und der Subjektivität gesondert eingehen werden. Wir können uns hier vielleicht merken, dass fixe Vorgaben – Farben, unsere Umwelt allgemein, oder jegliche “bestimmten“ Begriffe unserer Erfahrung, aus unserer Sicht zumindest, keine “kontinuierli-che“ psychologische Wirkung auf unser Gemüt haben (falls sie, wie erwähnt, überhaupt tatsächlich richtig wirken).
Attraktivität (sowie Abneigung) – man höre und staune – schließt (sehr) streng genommen Besitz aus. Attraktivität und Freude sind emotionale subjektive Anreize einen subjektiven Mangel zu beheben. Das heißt, die jeweilige emotionale Erregung wird überflüssig, und schwindet in aller Regel, sobald diesbezügliche Erwartungen als Besitz realisiert sind. Die (scheinbare) Wirkung fixer Vorgaben beruht demnach letztlich nicht auf jene fest vorgegebenen Kriterien selbst, sondern aus der Empfindung eines subjektiven Mangels.
Wem dies nicht sonderlich glaubhaft erscheint, mag zumindest eingestehen, dass bestimmte Photos, Bilder, Farben, optische oder akustische Signale, usw. nicht immer in gleicher Stärke emotional wirken. Es kommt gegebenenfalls sehr darauf an, ob man beispielsweise ein exzellent gebratenes Hühnchen vor oder nach einer Mahlzeit erblickt, oder ob man sich an relativ fixe Gegebenheiten – rote Tapeten, ein neues Auto, Reichtum, glückliche Umstände usw. – bereits gewöhnt hat oder nicht. Eine Art subjektiver Abhängigkeit der (tatsächlichen oder lediglich scheinbaren) emotionalen Wirkung fixer Aspekte auf unser Gemüt ist allgemein unverkennbar. Aber das ist nicht unbedingt nur komisch, sehr wahrscheinlich beruht dies alles a priori auf psychologischer Strategie, auch wenn es zur Zeit noch keine allgemein anerkannte wissenschaftliche Methode gibt sich jener Strategie erfolgreich zu nähern und deren Phänomene in befriedigender Weise erklären zu können.
Relativ blinder Technische Fortschritt – was die Romantiker ohnehin schon immer wussten – stellt allgemein eine vage emotionale Gefahr dar, denn er bietet mehr und mehr fixe Vorgaben der verschiedensten Art, auf die der Einzelne in der Regel keinerlei Einfluss hat. Daher werden Erlebnisse, die ver-hältnismäßig reich an solchen Vorgaben sind, relativ schlecht in der Phantasie der Bezogenen verwertet.
Eine Fahrt durch die schönsten Gegenden der Welt mit dem Auto, dem Bus, der Bahn – hauptsächlich aber als bloße technische Animation mittels Fernsehen oder Computer – ist nach unserem Ermessen kein eigentliches Erlebnis. Vielmehr ist es oft ärgerlich und frustrierend die größten Herrlichkeiten der Welt solchermaßen schmackhaft vor die Nase präsentiert zu be-kommen, ohne damit ein Gefühlserlebnis empfinden zu können.
Weltraumtourismus wäre so gesehen interessant – nicht wegen des offiziellen Erlebnisses an sich, sondern eher wegen der involvierten erheblichen Risiken und allgemeinen Gefahr, die es, mit mehr oder weniger persönlichem Einsatz, zu meistern gilt, während die offizielle Seite dieses Unternehmens – voll durchgeplant und relativ automatisch ablaufend – leicht völlig kalt an einem vorbei läuft.
Bei Autorennen geht es darum wer gewinnt – so sieht man es äußerlich, bzw. so will man es von öffentlicher Seite verstanden wissen. Indes, der Zuschauer ist in seinem tiefsten Herzen im Allgemeinen weniger daran interessiert, was planmäßig auf der Rennstrecke abläuft, sondern mehr daran, was außerordentlich passiert, bzw. was alles passieren könnte – z. B. eine kleine Karambolage – wahrscheinlich weniger aus purer Schadenfreude, sondern weil er instinktiv weiß, dass solche außerordentlichen Szenen oft ganz erheblich mit persönlichem emotional verwert-barem Einsatz verbunden sind. Das Rennen an sich verkommt hingegen leicht zu einer rein technischen Show, die den durch-schnittlichen Zuschauer kaum wirklich interessiert.
Andererseits kann verhältnismäßiger, technischer Fortschritt, sofern er den Mensch “einbindet“ und nicht völlig “außen vor lässt“ natürlich erhebliche, zusätzliche, positive Lebensanreize bieten. Ob allerdings allgemein zunehmender Fernsehkonsum (oder etwa Kernkraftwerke) verhältnismäßig sein kann (können) wage ich sehr stark zu bezweifeln.
Der tatsächliche Einfluss der äußeren Welt auf unser emotio-nales Leben ist also aus unserer Sicht weit geringer als dies allgemein angenommen wird. Umso mehr Bedeutung kommt (aus unserer Sicht) der inneren Disposition eines Individuums zu. Fixe äußere Aspekte – Farben, Bilder usw. – haben nur momentanen, flüchtigen Einfluss – keinen stetigen, dauerhaften. Ein rotes Zimmer – eine schöne Wohnung – ein neues Auto – alle solche relativ fixen Aspekte haben lediglich flüchtige schein-bare Wirkung. Auf die Dauer – abgesehen von zwischen-menschlichen Begleitmotiven wie Prestigebedarf, Selbstwertge-fühl usw. – ist es ziemlich egal ob man in einer Bude haust oder in einem Bungalow, ob man in einem roten oder blauen Zimmer schläft, ob man ein altes oder ein neues Auto fährt (mit einem alten kommt man in der Regel genauso gut vorwärts).
Dies ist soweit nicht lediglich Spekulation, sondern ist teilwei-se wissenschaftlich erwiesen. Sinnverwandte Versuche haben ge-zeigt, dass wir mit zunehmender Dauer, mit der fixe Aspekte auf uns wirken, allgemein dazu neigen sie unwillkürlich zu ignorieren:
Ausgenommen willkürliche Regungen, sind unsere Augen unwillkürlich, mehr oder weniger, ständig in Bewegung. Diese automatischen Bewegungen sind verhältnismäßig gering, so dass wir sie normalerweise nicht bemerken können, sie sind jedoch nachgewiesen. Gleichfalls wurde experimentell nachgewiesen, dass, relativ zum Auge, absolut fixe Gegenstände nach kurzer Zeit buchstäblich aus dem bewusst betrachteten optischen Eindruck verschwinden. (Siehe z. B: H. Gleitman/A. J. Fridlund/D. Reisberg, Psychology, W. W. Norton & Company, fifth edition 1999, Seite 197 unter: Vision, Interaction In Time: Adaptation – siehe auch unser Buch Seite 274 [nur im Original]).
Wie bereits W. Heisenberg (1901-76) erkannte ist ein bloßes Beobachten ohne entsprechende Wechselwirkungen prinzipiell nicht möglich. Jedes Objekt fühlt demzufolge notwendigerweise ob es gerade beobachtet wird oder nicht, was im verhältnismä-ßig groben menschlichen Alltag generell keine große Rolle spielt (obwohl bei sehr feinfühligen Menschen ...), aber im elementaren Bereich der Physik eher von ausschlaggebender Bedeutung ist.
Ein vergleichbarer Effekt könnte zudem auf psychologischer Basis bestehen: Es mag sein, dass es im Grunde nicht möglich ist, von einem beobachteten Geschehen beeinflusst zu werden auf das man rückwirkend selbst keinen Einfluss ausüben kann.
Bewusste (entgegen rein optische) Beobachtung setzt demnach generell Einfluss vom Subjekt auf das beobachtete Objekt voraus.
Wenn uns also z. B. das Fernsehen tatsächlich erheblich beein-flusst wie allgemein angenommen wird, so wäre dies aus unserer Sicht nur möglich, wenn der, bzw. die Fernsehzuschauer(in) die jeweilige Darstellung an sich ebenfalls beeinflusst – vom aktu-ellen technischen Stand ein Unding! Fernsehen kann sehr gut informieren und primitive Neugierde befriedigt; es kann aber auch sehr gut abstumpfen. Es wirkt wohl ohnehin abstumpfend, letztlich verblödend, weil die Seele von sich aus automatisch abschaltet, oder zurückschaltet, sobald ihr bewusst wird, dass sie nicht auf das Gesehene rückwirkend Einfluss ausüben kann, ebenso wie Tiere heutzutage kaum noch reagieren, wenn sie ein Flugzeug am Himmel sehen. Dafür gibt es Hinweise, z. B:
“Noch nie wurden Menschen so umfassend informiert wie heute. Zeitungen, Radio, Fernsehen – das sind in der Geschichte gewaltige Schritte nach vorn gewesen. Wir sehen heute, was in der Welt passiert.
Wir sehen entsetzliche, aufrüttelnde Dinge: Wieviel zigtausend Tote flimmern in jedem Jahr über den Fernsehschirm? Erdbeben, Flutkatas-trophen, Eisenbahn- und Flugzeugunglücke, Kriege, Hunger.
Aber alles passiert sozusagen nur im Kino. Wir hören, daß Men-schen heute die Welt vernichten können. Aber der Puls schlägt nicht schneller. Wir denken keinen Gedanken mehr und schneller als früher.
Fachleute sagen, daß die Menschen heute nicht in der Lage sind, die Wirklichkeit richtig zu erfassen. Das Weltgeschehen läuft über den Fernsehschirmen wie ein prickelnder Unterhaltungsfilm. Und Grau-samkeit ist die große Masche.
Wir nehmen die Welt nicht ernst. Wir nehmen uns selbst nicht ernst. Das wird tödliche Wirkung haben. [...]“ (Ulrich Parzany, Bitte
stolpern! Aussaat Verlag, 1971, 8. Aufl. 1987, Seite 65)
Ein Teil der soeben angedeuteten allgemeinen Abstumpfung geht sicherlich schlicht auf Reizüberflutung zurück. Das schließt jedoch nicht aus, dass uns explizit Fernsehen generell nicht wirklich seelisch erfasst. Fernsehen hat wohl eher indirekten negativen Einfluss auf unser Gemüt – wir stumpfen ab, werden schleichend immer gleichgültiger – gleichgültiger vor allem gegenüber Grausamkeiten, werden hyper-tolerant, und das sind insgesamt vielleicht Grundbedingungen zum allmählichen Heranreifen höchst asozialer, ja apokalyptischer Verhältnisse!
12 Kompatibilität: Generelle Grenzen des
“technisch“ bedingten Einflusses auf
“geistige“ Informationsinhalte
Ein Haus, als Beispiel, benötigt unbedingt ein Fundament. Dennoch spielt die Art dieses Fundamentes für das Haus an sich keine Rolle – es mag aus Bruchsteinen, Ziegelsteinen, Beton, Fels oder Stahl bestehen, vorausgesetzt das gewählte Material erfüllt die statische Bedingungen die das Haus stellt. Die Bedingung, dass ein Haus ein Fundament braucht kann nur negativer Art sein (ihr Einfluss), denn ein bestimmtes Haus setzt quasi im Voraus die Art seiner eigenen Bedingungen fest.
Positiver, inhaltlicher Einfluss der Bedingung auf das Bedingte verbietet sich bereits, wenn man nur bedenkt:
Bedingungen für eine bedingte Sache, Idee, Vorstellung ... macht Sinn – eine Sache, Idee, Vorstellung ... für eine Bedingung macht hingegen keinen.
Kant geht von völlig falscher Grundhaltung aus, wenn er das Bedingte inhaltlich von der Bedingung beeinflusst sieht. Damit erhebt er unwillkürlich Hilfsmittel zu einer Sache, über die Sache selbst – das Werkzeug über das Werk – er spannt den Wagen vor das Pferd.
Das kann man auch von technischer Seite etwas beleuchten:
Im Rundfunk, etwa, werden Signale allgemein ganz erheblich verändert, umgeformt und scheinbar beeinflusst bezüglich aller eingeschlossener Details, ohne dass dies notwendigerweise die ursprüngliche Bedeutung in irgendeiner Art verfälschen müsste (bzw. könnte). Technisch lassen sich relativ einmalige verhältnismäßig kurze Gegebenheiten leicht verfälschen. Es ist in einem modernen Tonstudio kein größeres Problem ein geflüstertes Wort in einen Donnerschlag oder das Toben eines Orkans in das anheimelnde Säuseln eines lauen Lüftchens zu verwandeln. Es ist auch kein überwältigendes Problem den Sinn einzelner Worte zu entstellen.
Bei Wörtern mit Schlüsselfunktion kann das relativ weitrei-chende Wirkung auf einen entsprechenden Text haben. Es ist jedoch weit schwieriger den Inhalt ganzer Sätze von rein technischer Seite zu verfälschen. Einen ganzen Roman in jeder Einzelheit dermaßen zu entfremden ist praktisch wie theoretisch unmöglich, wobei “entfremden“ nicht einfach stören, sondern eine inhaltliche Neuschöpfung bedeutet.
Mit das Eigentümlichste an relativ umfangreicher, verschlüs-selter Information – militärischer Geheimkode, Keilschrift, Hieroglyphen, usw. – ist, dass der betreffende Inhalt in der Regel entweder richtig oder überhaupt nicht verstanden wird.
Beeinflussung bedingt grundsätzlich Kompatibilität. Informa-tion lässt sich nur durch eine weitere Information verändern, so wie eine Kraft sich lediglich durch eine weitere Kraft verändern lässt. Jeglicher technische oder theoretische Aufwand zwecks der Interpretationsmöglichkeiten geistiger Inhalte müsste daher insgesamt quasi eine Eigeninformation darstellen um inhalt-lichen Einfluss auf die ursprünglich zu interpretierende Infor-mation zu erwirken.
Hingegen wird allgemein im gegebenen Kontext fast schon wie selbstverständlich unterstellt, dass der materielle oder theore-tische Aufwand mittels dem eine bewusst wahrgenommene Sinnesempfindung zustande kommen kann (etwa mittels subjek-tiver Verstandeskategorien und Anschauungsformen) an sich schon prinzipiell einer Beeinflussung gleichkommt –
bedingt und damit scheinbar automatisch beeinflusst
– in erster Linie durch die soeben erwähnten vorgelagerten subjektiven Bedingungen. (Siehe dazu beispielsweise die zuvor zitierten Beiträge, der Herren Höffe, Röd, Störig, Seite 18-9 – oder Brunner, Seite 15, zudem die Seiten 86ff, 110).
Kant geht diesbezüglich offenbar grundsätzlich von einem Einfluss der Bedingungen auf alles Bedingte aus, und zwar mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass er es nicht im Min-desten für nötig hält, diese schwergewichtige Unterstellung auch nur annähernd zu untersuchen – die überwiegende Mehrheit der abendländischen Philosophie, vor ihm wie nach ihm, ist in diesem Punkt keinen Deut besser.
“Die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein [...]“ (KrV A125 – Original kursiv)
“Die reinen Kategorien sind aber nichts anders als Vorstellungen der Dinge überhaupt [...]“ (KrV A245 – Original kursiv)
“Alle Erscheinungen liegen also als mögliche Erfahrungen eben so a priori im Verstande, und erhalten ihre formale Möglichkeit von ihm, wie sie als bloße Anschauungen in der Sinnlichkeit liegen, und durch dieselbe der Form nach, allein möglich sind. [...] der Verstand ist selbst der Quell der Gesetze der Natur [...]“ (KrV A127– Original kursiv)
Kant ist hier voll auf Seiten der potentiellen Fülle ohne jeglichen Bezug zum Konkreten. Damit erklärt er die vorgebliche inhaltliche Abhängigkeit des Bedingten zur jeweiligen Bedingung in keiner Weise, sondern unterstellt sie, wie die allerselbstverständlichste Sache der Welt. Vor allem: wie kommt Kant vom Ganzen zum Einzelnen ?
“Der Verstand steuert also einen wesentlich größeren Teil zur Erkenntnis bei als die Sinnlichkeit [...]“ Dieses Zitat von S. 84 ist hier ein Understatement! Die Gesetze der Natur bestimmen das Individuelle unserer Vorstellungen. Da jene Naturgesetze bei Kant aber vom Verstand abhängen, greift er entsprechend mit gesetzlichen allgemeinen Mitteln, formal wie inhaltlich, voll ins Individuelle – darf er das?
Nun, das wäre etwa so, als ob man das Alphabet als eigentliche, inhaltliche Quelle aller geschriebenen Texte ansieht – als ob man die Mathematik als Sinngeber jeder Rechnung hält – man ein bestimmtes musikalisches System letztlich für den Gehalt eines musikalischen Stückes erklärt – man die Aussage der Bilder einer Kamera ultimativ auf jene Kamera selbst oder auf den verwendeten Film zurückführt – man die Optik, die Akustik, die Mechanik usw. jeweils als Quelle der solchermaßen vermittelten Information ansieht – man damit letztlich “die Mittel zum Zweck“ als “Selbstzweck“ missversteht oder gar bewusst missbraucht bzw. man “Bedingungen für eine Sache“ für “die Sache selbst “ fehlinterpretiert (→ u. a. auch S. 190-1).
In einer Kamera müssen vergleichsweise alle Abbildungen, bereits bevor irgendein Photo tatsächlich gemacht wird, quasi als Bedingung der Möglichkeit jeglicher Photos überhaupt potentiell vollständig vorliegen. Der ursächliche Grund, warum in einem bestimmten Moment ganz bestimmte und nicht alle möglichen potentiell vorliegenden Bedingungen der Möglichkeit eines Photos zum Tragen kommen, liegt letztlich jedoch keineswegs “in“ der Kamera selbst begründet, sondern ist eine “rein äußere“ Angelegenheit. Jegliche Art der Differenzierung in einem Photo gründet sich allein auf äußere Gegebenheiten, rein innerlich nutzt ihr buchstäblich alles nichts.
Dass eine gewisse subjektive Bereitschaft – Kant würde sagen erfüllte Bedingungen – von Seiten der Kamera vorhanden sein muss, um überhaupt irgendwelche Bilder zu erzeugen, versteht sich von selbst. Ebenso selbstverständlich sollte es sein, dass wir als sinnende Wesen gewisse subjektive Eigenleistungen (Bedingungen) bezüglich einer Informationsinterpretation erfüllen müssen. Weit weniger selbstverständlich sollte es, entgegen Kant, allerdings sein, dass die somit lediglich bedingte Erfahrung durch die eigenen subjektiven Bedingungen zu jener Erfahrung beeinflusst wird.
Dass alle Erscheinungen a priori im Verstande liegen (KrV A127) soll im Sinne Kants offensichtlich besagen, dass der Verstand letztlich für jene Erscheinungen in der Art wie sie eben erscheinen verantwort-lich ist – sie demnach selbst erzeugt.
Dies ist jedoch eine völlig übereilte Folgerung, denn aus der Masse aller potentiell möglichen Erscheinungen ergibt sich, ganz wie bei einer üblichen Kamera, entgegen Kant, nicht ein einziges Indiz für die Differenzierung eines realen, ganz bestimmten Einzelfalls. Allein aus der Fülle unendlicher Möglichkeiten geht in keiner Weise hervor welche “bestimmten“ Möglichkeiten tatsächlich im konkreten Einzellfalle zum Einsatz kommen.
Dass ein bestimmter Gegenstand etwa blau (und nicht rot oder gelb) und 20 cm groß (und nicht 50 cm oder 6 m) erscheint, lässt sich nicht aus einer potentiell vorliegenden Masse aller Möglichkeiten der Erfah-rung ableiten – aus einer solchen Masse ließe sich Alles oder Nichts ableiten aber eben keine “ganz bestimmten“ einzelne Kriterien, denn Letztere wären praktisch eine unbegründete Differenzierung und damit eine unzulässige Bevorzugung einzelner ausgewählter Aspekte gegen-über allen solchermaßen nicht ausgewählten Aspekten.
Daher ist es absolut notwendig, dass unabhängig von der potentiellen apriorischen subjektiven Möglichkeit der Erfahrung relativ äußere Möglichkeiten (Objekte) der Erfahrung real tatsächlich existieren – nicht wiederum als potentielle unbestimmte Masse, sondern in ganz konkreter individueller Form. Die subjektive Vorstellung einer Erscheinung beispielsweise der Größe von 50 cm erfordert, dass dieser Erscheinung ein realer Gegenstand von 50 cm tatsächlich zu Grunde liegt, andernfalls ergibt sich absolut keine Möglichkeit aus der unterstellten Summe aller potentiell subjektiven Möglichkeiten der Erfahrung überhaupt, auf irgendeinen konkreten Einzellfall, hier auf das bestimmte Maß “50 cm“, zu schließen.
Freilich könnte Kant aus der (subjektiven) potentiellen Fülle der Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung mit Hilfe der empirischen Anschauung vom Ganzen zum Einzelnen schließen, wäre er kein (transzendentaler) Idealist und würde er nicht darauf bestehen, dass alle Erfahrungsinhalte sich ausschließlich aus den subjektiven Bedingungen der Erfahrung (Verstandeskategorien nebst apriorischen Anschauungs-formen) ergeben. Kant hat ohnedies keine Chance in diesem Punkt die empirische Karte zu spielen, weil aus seiner Perspektive alles Empirische zufällig -, und damit für alle bestimmten (folglich nicht -zufälligen) Aspekte definitionsgemäß ohne Bezug ist.
Kants System, darüber hinaus der Idealismus generell, ist allein aufgrund dieses speziellen Sachverhalts prinzipiell unmög-lich. Berkeley lässt uns freundlicherweise wissen, dass eine Idee immer nur eine Idee sein kann und somit stets innerlichen Charakter führt, auch was äußere Aspekte betrifft (Berkeley, 1710). Freilich übersieht er dabei, dass bloß aus inneren Kriterien kein differenzierendes Mittel für irgendwelche Ideen überhaupt besteht.
Ausdehnung, Form und Bewegung sind Ideen – nichts als Ideen, niemals etwas absolut Äußeres an sich, so Berkeley. Wie jedoch gelangen die Herren Kant und Berkeley vom Ganzen zum Einzelnen, von der potentiellen Fülle zur Individualität, von den subjektiven Bedingungen der Möglichkeit aller Erfahrung (Kant) bzw. der Fülle aller Ideen Gottes (Berkeley), konkret herab zu irgendeiner konkreten einzelnen Erfahrung? Berkeley scheint diese Frage komplett zu ignorieren, Kant hat immerhin einen Ansatz, allerdings einen willkürlichen: völlig aus der Luft erklärt er die Anschauung als zuständig für das Einzelne der Erfahrung (u. a. KrV A320/B376-7, auch → S. 54, 100).
“[...] extension, figure and motion are only ideas existing in the mind, [...] an idea can be like nothing but another idea, [...]”
(Berkeley, 1985 [Original 1710] S. 79)
Bei Kant liegt der Fall etwas komplizierter – so redet er u. a. von “Vorstellungen einer Vorstellung“ (u. a. KrV A68/B93, A 108), von “transzendentale Ideen“ (KrV A528/B556), usw. – im Grunde steht er diesbezüglich aber voll auf der Seite Berkeleys:
“Wir haben Vorstellungen in uns, [...] so bleiben es doch nur immer Vorstellungen, [...]“ (KrV A197/B242)
Ist das so sicher? – sind Vorstellungen alle gleich Vorstel-lungen? Diese Frage nehmen wir uns später (S. 180) speziell vor – was uns im Moment beschäfftigt ist der Aspekt “Führung“.
“Der Verstand vermag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, daß sie sich vereinigen, kann Erkenntnis entspringen.“ (KrVA51B75-6)
Der Verstand ist voll, und in sich doch leer – Alles oder Nichts – mehr ist aus bloßer Sicht des Ganzen nicht zu erreichen, das scheint Kant hier uneingeschränkt zu akzeptieren.
“Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. “ (KrV A51/B75)
Ist Kant sich wirklich klar, was er da behauptet? Wird die blinde Anschauung dadurch sehend, dass sie sich eines leeren Inhalts bedient – werden an sich leere Gedanken durch blindes Äußeres gefüllt? Wenn die Anschauungen durch Begriffe sehend werden, so kann dies nur bedeuten, dass die Begriffe selbst führend sind und sodann keiner äußeren Führung bedürfen.
Wenn die Gedanken erst durch äußere Anschauung gefüllt werden, so besagt dies, dass jenes Äußere konkrete Inhalte mit sich führt (und keine bloße Zufälligkeit) und somit nicht der Leere der Begriffe bedarf.
Versuchen wir nun die jüngsten Gedankenzüge etwas praktischer bzw. etwas technischer zu nehmen:
Es ist bei genauer Betrachtung überhaupt nicht möglich mit rein technischen Mitteln, bzw. mit Hilfsmitteln geistliche Information inhaltlich zu beeinflussen, da Geist an sich und Technik an sich (bzw. technische Hilfsmittel generell) zwei zueinander inkompatible Aspekte darstellen. Kants subjektive Vorgaben, namentlich die Verstandeskate-gorien und reine Formen der Anschauung wären sinngemäß Hilfsmittel, wenn nicht rein “technische“ (Hilfs-) Mittel.
Die Übertragung von Information ist an natürliche und/oder künstliche bzw. technische Übertragungsmittel gebunden. Die rein technischen Aspekte einer Informationsübertragung lassen sich technisch strecken, stauchen, verzerren, zerreißen ohne dass dadurch die ursprünglichen “geistigen“ Inhalte berührt werden.
Einem bestimmten akustisch vermittelten Informationsinhalt kann man noch so viele rein technische Fremdgeräusche – Gebrumm, Getöse, Gezische und Gezerre usw. – beimengen, dadurch ergibt sich kein anderer “geistiger“ Inhalt, auch wenn mit relativ kurzen Auszügen einer technischen Informationsbehandlung sich gelegentlich rein zufällig überschneidende Auslegungen ergeben mögen.
Das heißt, “geistige“ Geräusche und technische Geräusche können sich gegebenenfalls gegenseitig stören/überlagern, wenn sie gleichzeitig einem Bewusstsein gegeben werden, sie können sich hingegen grundsätzlich nicht verbinden, da beide zueinander inkompatibel sind.
Jedes chemische Stoffgemisch lässt sich durch geeignete physikali-sche Methoden in die einzelnen Stoffe auftrennen. Vergleichbar dazu lässt sich jedes Gemisch aus “echten“ Informationsinhalten und relativ technischen Aspekten an und für sich jederzeit trennen. Bestimmte chemische Stoffe und deren fundamentale Bestandteile gehen allerdings mitunter Bindungen der verschiedensten Art ein, falls sie kompatibel sind – dies ist zwischen “echten“ Informationsinhalten und relativ technischen begleitenden Aspekten jedoch nicht möglich, da sie, wie gesagt, grundsätzlich zueinander inkompatibel sind und sich daher prinzipiell nicht zu einem neuen Sinn vereinigen können, auch wenn der praktische, relativ oberflächliche Alltag bisweilen eher das Gegenteil vortäuschen mag.
Allerdings, bei weitem nicht alles Gerede und “Gewäsch“ enthält hochka-rätige, rein “geistige“ Elemente. Zudem, selbst relativ gehaltvolle Informations-inhalte sind zwecks einer physikalischen Vermittlung an physikalische Techniken gebunden. Jene Techniken (als mehr oder weniger bedingte Hilfsmittel) ließen sich technisch beeinflussen, nicht jedoch die zu vermittelnden geistigen Inhalte an sich.
Halten wir (technisch) fest:
Mit bestimmten Absichten verbinden sich gemeinhin Hilfsmittel zur Realisation jener Absichten. Dabei sind Hilfsmittel in unserem Kontext jedoch grundsätzlich nicht kompatibel mit den jeweiligen Absichten – was Einfluss des einen zum anderen kategorisch ausschließt – völlig unabhängig ob diese Hilfsmittel insgesamt relativ einfach oder kompliziert, materiell, technisch oder theoretisch sind. Hilfsmittel sind in diesem Sinne generell relativ technischer Natur, Information im erkenntnistheoretischen Zusammenhang ist hingegen im Grunde geistiger Natur. Information lässt sich mit geeigneten Mitteln weiterver mitteln. Allein jene Weitervermittlung an sich stellt in keiner Weise einen Eingriff in die vermittelten Informationsinhalte dar.
Es ist somit prinzipiell unmöglich, dass Hilfsmittel, etwa der techni-sche Apparat einer Rundfunkanstalt oder Kants Kategorien und An-schauungsformen, in unserer speziellen Betrachtung, inhaltlichen Ein-fluss auf individuelle Absichten, etwa auf die Weiterleitung oder Inter-pretation von Information, hätten! Allerdings können Hilfsmittel durch-aus entscheiden, welche Absichten durchkommen und welche nicht.
Die “Durchgekommenen“ werden allerdings nicht dadurch beein-flusst, indem sie durch jene Hilfsmittel zu ihrem Bestimmungsort “hindurchkommen“. Hilfsmittel fungieren hier quasi als Sieb. Ein Sieb beeinflusst in der Regel weder das was es durchlässt noch das was es zurückhält. Es fungiert sozusagen als Rahmenbedingung mit negativer Bedeutung, d. h. es wählt unter gegebenen diversen Inhalten die Inhalte heraus, die der speziellen “Bedingung“ jenes Siebes genügen, ohne selbst die durchgesiebten Inhalte tatsächlich zu beeinflussen.
Kant ist sich der Problematik, die sich aus Gründen der Kompatibilität ergibt, sicher zumindest teilweise bewusst. Jedenfalls baut er den Begriff des “Schemas“ quasi als notwendigen Mittler zwischen an und für sich nicht kompatiblen und damit nicht kooperationsfähigen jedoch unbedingt erforderlichen Aspekten seiner Theorie ein.
“Nun ist klar, daß es ein Drittes geben müsse, was einerseits mit der Kategorie, andererseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß, und die Anwendung der ersteren auf die letzte möglich macht.“
(KrV B177/A138, siehe auch KrV A137/B176 bis A147/B187)
Dabei übersieht Kant, dass ein sogenannter Mittler das angedeutete Problem nicht löst, sondern lediglich eine Stufe weiterschiebt. Denn ein Vermittler ist stets zu Kompromissen gezwungen, die im vorliegen-den absoluten Bereich wiederum eine zusätzliche Vermittlung benöti-gen, womit sich sodann ein unendlicher Regress eröffnet, und daher eine tatsächlich befriedigende Lösung des Problems bezüglich der Erkenntnistheorie Kants schon allein aus diesem speziellen Grunde unmöglich ist.
Der Aspekt der Kompatibilität wäre, nebenbei gesagt, besonders auch für den Dualisten Descartes ein erhebliches Problem. Körper und Geist können logi-scherweise nicht vereint agieren, wenn sie nicht zueinander kompatibel sind. Eine kategorische absolute Trennung beider Begriffe schließt Kompatibilität aus.
Da jedoch Körper und Geist, ersichtlich am Beispiel eines jeden Menschen, zusammenwirken, muss eine gewisse Kompatibilität vorhanden sein, was letztlich für die grundsätzliche Wesensgleichheit des Materiellen und des Seelischen spricht. Materialisten wie Idealisten ziehen hingegen gerne aus diesem Sachverhalt unlogischerweise völlig einseitige Schlüsse.
13 Funktion der “Welt der Erscheinungen“
und der “Welt der Dinge an sich“
“[...] was die Dinge an sich sein mögen, weiß ich nicht, und brauche es auch nicht zu wissen [...]“ (KrV A276-7/B332-3)
Demnach sind objektive Bedingungen für Kant bedeutungslos, subjektive hingegen absolut bestimmend – Inkonsequenz in Perfektion!
Wären Erscheinungen ein bloßes Schattenspiel der Dinge an sich, ohne Funktion, ohne Wirkung, ohne aktive eigene Handlung, so hätte Kant im soeben erwähnten Zitat sicherlich Recht. Erscheinungen haben hingegen offenkundig praktische wie rein theoretische Funktionen, nicht irgendwelche beliebigen, sondern exakt solche, die jenen Erscheinungen angemessene sind, was für Kant einige schwerwiegende Probleme beinhaltet.
Komplexe Aspekte lassen sich in einem komplexen in sich geschlos-senem System letztlich nur eindeutig auf eine ganz bestimmte Art und Weise darstellen und in keiner anderen. Ein Dreieck, etwa, lässt sich nicht ohneweiters als Kreis deuten, denn ein Kreis hat ganz andere Funktionen als ein Dreieck, beide zeigen sehr differenziertes Verhal-ten. Ein übliches Haus kann nicht problemlos als Staubsauger repräsen-tiert werden oder umgekehrt, denn beide komplexe Gebilde haben völlig unterschiedliche Details die zusammen nur in einer ganz be-stimmten Form sinnvoll harmonieren und funktionieren – eben nur als Haus oder nur als Staubsauger. Eine Nadel kann nicht stechen, wenn sie nur spitzt aussieht, sie muss zudem tatsächlich spitz sein. Es nützt dem Ball nichts, wenn er lediglich rund erscheint, er wird nur rollen, wenn er zudem auch wirklich rund ist. Dinge können aus verschie-denen subjektiven Perspektiven (aufgrund unterschiedlicher Rahmen-bedingungen also) ganz unterschiedlich erscheinen, dennoch sind solche unterschiedlichen Erscheinungen im Grunde alle gleich – sie beziehen sich alle auf die bestimmten Funktionen jener Dinge. Die per-sönliche Konstitution und alle diesbezüglichen subjektiven Bedingungen verändern die jeweilige Perspektive, jedoch nicht die eigentümliche Funktion eines betrachteten Objektes. Die Funktion eines Objektes har-moniert zwangsläufig mit dessen wahrer Natur. Das aktive, weltweite, relativ geordnete, gezielte Zusammenspiel verschiedener Objekte mit teilweise sehr unterschiedlichen Subjekten schließt subjektiven funkti-onalen Einfluss bezüglich der inneren objektiven Repräsentation der betreffenden Objekte grundsätzlich aus. Andernfalls wäre es praktisch unmöglich, dass unterschiedliche Subjekte in gleicher Weise auf bestimmte Objekte reagieren (und überhaupt miteinander kommunizieren).
Nach Kant wäre es hingegen unwahrscheinlich bzw. unmöglich dass unterschiedliche Subjekte auf bestimmte Objekte übereinstimmend reagieren, da die subjektive Welterkennung von den subjektiven Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung abhängt, die bei unterschiedlichen Subjekten notwendigerweise unterschiedlich ausfällt (in diesem Punkt gehen die Meinungen jedoch weit auseinander, wie wir noch sehen werden, → S. 186-8 im Zsh. mit O.-Höffe-Zitat, sowie P.-F.-Strawson-Zitat S. 331 [im Original-Text, hier aber S. 201]).
So gesehen ist es sehr überraschend, dass in der freien Natur auch sehr unterschiedlich gebaute Tiere, die sich zum ersten Male treffen, in der Regel spontan gut abschätzen können, ob sie dem fremden Gegenüber gewachsen sind oder nicht – das bedingt eine gleiche Objekterkennung, zumindest bezüglich entscheidender Kriterien wie Größe und Kraft, unabhängig von jeglicher subjektiven Struktur also.
Die Katze, die dem Ball hinterherrennt, interpretiert das Objekt “Ball“ im Grunde genau wie der Mann (Kaninchen, Maus usw.) der ebenfalls dem Ball hinterherläuft, andernfalls würden diese beiden sehr unterschiedlichen Subjekte doch sicher kaum direkt vergleichbare Reak-tionen zu jenem bestimmten Objekte zeigen. (→ u. a. S. 156-7, 182ff)
Dinge erscheinen uns lediglich, d. h. ihr wahres Gesicht bleibt uns, so immerhin Kant, verborgen. Da stellen sich jedoch einige Fragen:
Wenn ein Ball in der absoluten Realität kein Ball ist, warum verhält er sich dann so wie er gar nicht ist – warum rollt er beispielsweise vergnügt und mit Leichtigkeit einen Hang herab, obgleich er in Wirk-lichkeit vielleicht eine unbeholfene schwere Bohle oder gar ein fest verankerter Baum ist? Kant würde hier sagen, dass es nur so scheint, als ob ein Ball rollt, bzw. dass der Gegenstand, der uns als Ball er-scheint, rollt aufgrund unserer subjektiven Vorgaben – hingegen nicht aufgrund dessen, dass er im absoluten Sinne tatsächlich rollt oder über-haupt ein Ball wäre. Gemäß Kant schreiben wir der Natur ihre Gesetze vor, was praktisch besagt, dass wir nicht nur die äußere Erscheinung der Dinge bestimmen, sondern auch ihr Verhalten und ihre Funktion.
Dies hat/hätte zur Folge, dass sich unsere Erscheinungen verhalten gemäß subjektiver Gegebenheiten, während die Dinge an sich selbst auf die sich jene Erscheinungen angeblich gründen, unabhängig von subjektiven Gegebenheiten verweilen wie extrem geduldige liebe Tier-chen, die absolut alles mit sich machen lassen – vor allem das Unmög-liche! Damit erwachsen der Erfahrung die verschiedensten Möglichkei-ten, Funktionen und Wirkungen, die den Dingen an sich selbst, auf die sich alle Erkenntnis gründet, jedoch vorenthalten bleiben, weil sie, im krassen Gegensatz zu unseren Erscheinungen, nicht unseren Verstandes-kategorien und Anschauungsformen unterstehen.
Das wiederum führt theoretisch dazu, dass sich unsere Erscheinun-gen im Einzelnen (wie die Welt unserer Erfahrung im Ganzen) gegebenenfalls verhält und sich weiterentwickelt, wie die Dinge an sich selbst bzw. wie die Welt der absoluten Realität sich eben genau nicht verhält und nicht weiterentwickelt. Das würde im Extremfall bedeuten, dass z. B. einzelne Erscheinungen gerade dabei sind sich gegenseitig zu eliminieren, während die entsprechenden Dinge an sich selbst im Begriff sind sich gegenseitig zu vermehren!
Kants Transzendentaler Idealismus setzt quasi voraus, dass zwischen dem Verhältnis aller Dinge an sich und dem Verhältnis aller unserer Erscheinungen eine kontinuierliche Harmonie besteht (andererseits behauptet Kant allerdings, dass die rein äußere Sinnesinformation zufälliger Natur ist – auf den gesonderten Punkt kommen wir noch zu sprechen). Diese Harmonie kann jedoch nicht bestehen, wenn ab der subjektiven Basis jeder Impuls völlig neue Eigenschaften erhält. Denn jede neue Eigenschaft stört bzw. hebt die ursprüngliche Harmonie der einzelnen Impulse zueinander zwangsweise auf. Es kann z. B. nicht sein, dass einzelne Teile eines Autos in verschiedene Richtungen auseinanderfahren, (es sei denn das Auto explodiert). Ein Auto fährt hierhin oder dahin insgesamt oder gar nicht!
Mit anderen Worten: bezüglich jeglicher Sinnesinterpretation verbietet sich jeglicher subjektive Einfluss. Denn die Verbindung zur ursächlichen Quelle wird durch diesen vermeintlichen Einfluss ja nicht abgebrochen – sie besteht hingegen weiter. Das innere Auge müsste sich also förmlich zerreißen zwischen relativ “junger“ und verhältnis-mäßig “alter“ Information einer bestimmten Quelle.
Denn geht man davon aus, dass der hier strittige Einfluss durch subjektive Gegebenheiten grundsätzlich stattfindet, bekommen alle In-formationsinhalte, ab dem Moment, wo diese menschlichen Gegeben-heiten aktiv in den jeweiligen Prozess eingreifen, eine dynamische Komponente – das bedeutet: Bewegung – Entwicklung – Veränderung ... – was sich insgesamt stetig fortsetzt und steigert und sich damit kontinuierlich vom ursprünglichen relativ fixen Stand der Dinge an sich selbst mit jenem nunmehr dynamischen Komplex entfernt.
Damit wäre eine Übereinstimmung aufeinanderfolgender Daten bezüglich einer beliebigen, jedoch verhältnismäßig fixen Sache nicht mehr möglich, da jene Differenz keine feste Größe annimmt, sondern sich ständig ausdehnt und umso mehr zum Tragen kommt, je länger sie unter dem Einfluss der involvierten subjektiven Gegebenheiten steht.
Wo aber bleibt das Ding an sich selbst, wenn die jeweilige Erschei-nung sich mit subjektiver Möglichkeit just aus dem Staube macht?
Man stelle sich vor, dass die Räder eines Autos Dinge an sich selbst seien, Motor und Chassis hingegen die jeweiligen Endprodukte unserer Vorstellungen wären, so wird sofort ersichtlich, dass Kants System ein Unding ist! Denn es ist unmöglich, dass die Räder eines bestimmten Wagens nach links sausen, nach Paris vielleicht, während Motor und Karosserie jedoch nach rechts, auf München zusteuern. Genau aber das wäre im Prinzip unweigerlich der Fall, würde man im Zuge Kants subjektiven Einfluss auf unsere Vorstellungen grundsätzlich zulassen!
In dem Moment, wo Kant Dinge an sich selbst (als Basis) in sein System aufnimmt, gehören jene Dinge an sich selbst auch zu jenem System. Es kann nicht sein, dass Kant ein System als Grund eines anderen annimmt, gleichzeitig jedoch es zulässt, dass beide völlig getrennte Wege absolvieren. Kant geht in gänzlich unrealistischer Manier davon aus, dass “Grund sein für etwas“ eine Eigenschaft wäre, die auf subjektiver Seite (hier der Dinge an sich selbst) ohne jegliche praktische oder theoretische Konsequenz sein könnte. – Ein Einwand:
Das Alphabet ist Grund dessen, was wir schreiben – die Mathematik die Basis aller unserer Rechnungen, offenbar ohne dass das, was wir errechnen oder schreiben rückwirkend auf jene Systeme der Mathematik oder des Alphabets einwirkt – das ist aber kein fairer Vergleich!
Denn es handelt sich dabei nicht um unhabhängige Systeme – das Alphabet enthält potentiell bereits alle nur irgend möglichen Texte, die Mathematik alle möglichen Rechnungen (wo also Ganzes und Teile des Ganzen wesensgleich sind, bzw. ein in sich geschlossenes System bilden). Die entsprechende potentielle Fülle beeinflusst den Sinn der genannten Systeme quasi im Voraus für alle individuellen Realisationen.
Dinge an sich existieren aber bei Kant in der absoluten Realität, in einer Welt für sich, angeblich völlig unabhängig von der Welt unserer Erscheinungen. Hingegen nimmt er an, dass die uns Menschen eigenen subjektiven Bedingungen der Erfahrung unsere Erscheinungen maß-geblich beeinflussen. In beiden Fällen könnte er kaum krasser irren.
Der Begriff “Grund“ beinhaltet eine gewisse Kraft – nach außen wie rückbezüglich nach innen. Nimmt man jedoch an, dass jene Kraft nicht existiert, so muss man im gleichen Zug voraussetzen, dass jener Grund ebenfalls nicht existiert – weder praktisch noch theoretisch.
Einfluss, nebst Kraft, sieht Kant explizit da, wo er definitiv nicht sein kann: Es ist unmöglich, dass die subjektiven Bedingungen der Erfahrung, die Erfahrung, im positiven schöpferischen Stellenwert, beeinflussen, andernfalls schleicht sich hier unvermeidlich eine Dynamik ein, die dazu führt, dass die Objekte ihren Subjekten gewissermaßen davonlaufen, zudem, dass neue Dinge an sich selbst, exakt durch dieses dynamische “Davonlaufen“, geschaffen werden.
Nehmen wir an: Ein einzelner Baum steht in der absoluten Realität allein irgendwo auf einem Berg. Ein Mann steht vor diesem Berg und betrachtet den Baum – diesen Baum empfindet er aufgrund seines subjektiven Sinnesinterpretationssystems nicht als Baum, sondern als einen großen Ball. Dieser Ball rollt nun kraft der Gesetzmäßigkeit, die ihm von subjektiver Seite, im Zuge Kants, aufgedrängt wird den Berg herab. Bei diesem einen Ball bliebe es jedoch nicht, denn während der Mann kontinuierlich auf jenen Baum starrt, erwachsen scheinbar kontinuierlich neue Bälle in direkter Folge die ständig jenen Berg herunterrollen (denn das reale Ding an sich, der Baum, kann ja nicht den Berg herunterrollen, da er die rollende Funktion erst als subjektive Erscheinung gewinnt). Jener Mann würde daher aus dieser kontinuierlichen Flut von Bällen, selbst in diesem an und für sich recht simplen Beispiel, kaum noch irgendetwas Bestimmtes interpretieren können – allenfalls einen extrem vagen Film einer sich ständig vermehrenden letztlich unendlichen Anzahl rollender Bälle.
Geht man also davon aus, dass der von Kant unterstellte subjektive (menschliche) Einfluss tatsächlich stattfindet, gewinnen alle Sinnesinter-pretaionen eine dynamische Komponente, die sich mit der eigentlichen Quelle, mit der ein Bewusstsein in Verbindung steht, notwendigerwei-se nicht mehr vertragen (was oben die Flut neuer Bälle verursacht).
Zudem ist es prinzipiell unmöglich Schöpfer zu sein, und als Geschöpf dieses Schöpfers zu empfinden. Man kann sich aus psycholo-gischen Gründen kaum selbst überraschen mit einer Sache, die man selbst in jeder Einzelheit produziert hat. Naivität schließt bezügliches Wissen grundsätzlich aus. Da alle Erfahrung subjektiv bedingt ist und, gemäß Kant, folglich ein Subjekt schöpferisch in Erscheinung tritt, ist es sehr überraschend, dass wir die Natur der Welt nicht a priori aller Erfahrung bereits kennen, bevor wir sie praktisch, de facto erfahren.
Dass wir Dinge, insbesondere aufgrund unserer subjektiven Vorgaben, beeinflusst sehen, ist demnach nicht so ohneweiters möglich wie Kant und Kollegen das ins Auge fassen. Denn, abgesehen einiger Überlegungen des Hauptteils, und abgesehen von dem soeben erwähnten Widerspruch: Schöpfer/Naivität, würden sich mit jener vermeintlichen Beeinflussung unsere Erscheinung zwangsweise aufgrund der subjektiven Vorgaben relativ zu den Dingen an sich selbst verändern und zwar nicht nur bildlich, sondern auch funktional.
Das wäre weniger ein Problem, könnte man annehmen, dass die Welt der Dinge an sich selbst in der absoluten Realität weder funktioniert noch dass sie nicht funktioniert. Allenfalls ein Nichts ist funktionslos – Kant besteht hingegen darauf, dass der Welt unserer Erscheinungen eine absolut reale unabhängige Welt (der Dinge an sich selbst) entgegensteht.
Er müsste daher auch davon ausgehen, dass jene reale Welt, mit absolutem Blick, eine gewisse Funktion hat, die sodann mit der subjektiven Welt unserer Erscheinungen harmonieren muss. Letztlich müssen beide, die innere Welt unserer Erscheinungen und die äußere reale Welt der Dinge nicht nur zueinander harmonisch sein – sie müssen identisch sein, andernfalls entwickeln wir uns unweigerlich mit unserer subjektiven Welt an der absolut realen Welt völlig vorbei.
Man kann auf subjektiver Ebene nicht Feuerzeug spielen und in Wirklichkeit Löschwasser sein, das haut nicht hin (→ u. a. S. 56, 132, 157)!
Nehmen wir, mit Kant, fünf verschiedene einzelne Dinge an sich selbst an und benennen sie willkürlich E, B, Z, Mi und Me. Nehmen wir weiterhin an, dass diese fünf Dinge an sich selbst nun die Sinnesorgane eines bestimmten menschlichen Individu-ums affizieren und dass keine weiteren Dinge an sich selbst vorhanden sind (das wird real kaum möglich sein, aber bitte! es geht nur ums Prinzip). Dieser Mensch verbindet nun diese Affektionen mit Hilfe seiner subjektiv gegebenen Anschauungsformen und Verstandeskategorien zu ganz bestimmten Erscheinungen, etwa zu einigen Eiern, etwas Butter, Zucker, Milch und Mehl.
Diese verschiedenen Vorstellungen haben nun aufgrund der subjektiven gesetzlichen Vorgaben ganz bestimmte Eigenschaf-ten, die sich beispielsweise dazu eignen einen Kuchen daraus zu machen. Nehmen wir daher an, dass unser Zeitgenosse in jenem Gedankenexperiment genau dies nun auch praktiziert: er bäckt mit den erwähnten Erscheinungen einen Kuchen.
Dadurch hätten wir jedoch nun ein Problem – ein riesengroßes! Denn diesem Kuchen liegt hier ja kein Ding an sich selbst zu Grunde und somit keine Affektion! (Ursprünglich liegt nur E: Eier, B: Butter, Z: Zucker, Mi: Milch und Me: Mehl – aber kein Ku zu Kuchen vor!) – Oder ein neues Ding an sich selbst wird also erschaffen! Dies ist erst der Anfang des Problems, denn mehrere Kuchen können ein Mahl bilden, ein Mahl lässt sich wiederum zu einem Festbankett erhöhen, usw.
“Jeder Erscheinung liegt ja nach Kant ein Ding an sich zu Grunde und offenbart sich in ihr, [...]“ (Erich Adickes, Kant
und das Ding an sich, 1924, Georg Olms 1977, Seite 38)
Ist sich Herr Adickes da wirklich so sicher?
Oder nehmen wir an, dass ein Herr Müller, sich mit etwas konfron-tiert sieht, das nach seinen Vorstellungen einem mehr oder weniger großen Holzhaufen entspricht. Nun ist dieser Herr Müller einigerma-ßen geschickt, denn er schafft es binnen nicht allzu ferner Zeit, aus diesem Holzhaufen markante einzelne Teile zu formen: Fenster, Türen, Treppen, Wände usw. die er schließlich zu einem Haus zusammenfügt – alles Dinge die ursprünglich nicht vorhanden sind. Will Kant nun in diesem Gedankenspiel vermeiden, dass jene neuen Einzelteile und jenes Haus an sich nicht neue Dinge in der absoluten Realität schaffen, so ist er gezwungen, diese auf ultimativer Ebene bereits vorauszusetzen. Denn Kant darf nicht zulassen, dass rein subjektive Gegebenheiten unserer Erscheinungen in die absolute Realität der Dinge an sich selbst hinüber-greifen, da er davon ausgeht, dass jene absolute Realität grundsätzlich unabhängig von subjektiven Erscheinungen ist (andernfalls würde Kant unweigerlich in den absoluten Idealismus zurückgefallen den er überwinden will).
Wenn Kant jedoch alle Dinge voraussetzt die aufgrund unserer subjektiven Gegebenheiten entstehen, so hätten jene Gegebenheiten keinerlei Funktion mehr und wären völlig überflüssig – überflüssig zumindest in dem Belang, dass sie inhaltlich erzeugende Funktionen, in Form von sogenannten Kernbedingungen (siehe Hauptteil) hätten. Als Rahmenbedingungen (siehe Hauptteil) wären sie hingegen zulässig und hätten sodann eine passive Funktion, die sich, aus unserer Sicht, also definitiv nicht aktiv auf inhaltliche Einflussnahme erstrecken kann.
Ohnehin darf man sich fragen, warum ein Ding an sich selbst unsere Sinne in der Art affiziert, dass wir z. B. einen Hund sehen, während ein anderes Ding an sich selbst uns affiziert und wir sehen eine Katze? Warum? – ganz einfach, weil unsere ge-setzlichen Vorgaben diese Art der Erscheinungen a priori bestim-men (hundertprozentig bestimmen würde Kant sicher noch hinzufügen, zumindest gemäß z. B: KrV B163, obschon in diesem Punkt ein geson-dertes Problem besteht, siehe Seite 75-6). Selbst mit zu Kant günstig geneigter Auffassung (eine Zumutung für uns) erklärt dies jedoch nicht erschöpfend den betreffenden Sachverhalt, keineswegs – es erklärt genau nichts! Der Fakt, dass verschiedene Dinge an sich selbst verschiedene Vorstellungen in uns hervorrufen beweist, dass die Differenz einzelner Vorstellungen weder auf subjektive Gegebenheiten an sich, noch auf zufällige Kriterien der empiri-schen Anschauung beruht, sondern auf äußere differenzierte geordnete und also nicht zufällige Umstände zurückzuführen ist.
Dem könnten einige Kant-Befürworter entgegenhalten, dass eine 1:1 Gegenüberstellung zwischen Erscheinungen und Dingen an sich selbst nicht gegeben ist. Diesen neu eingeschobenen Aspekt sollten wir zunächst etwas genauer unter die Lupe nehmen:
“Daß unseren äußeren Wahrnehmungen etwas Wirkliches außer uns, nicht bloß korrespondiere, sondern auch korrespondieren müsse, kann gleichfalls niemals als Verknüpfung der Dinge an sich selbst, wohl aber zum Behuf der Erfahrung bewiesen werden.“ (Prol. § 49)
Dises Zitat könnte man so deuten, dass es gemäß Kant kein ganz bestimmtes Ding an sich selbst gibt, das einer ganz bestimmten Erscheinung (z. B. Hund oder Katze) entspricht.
Erich Adickes meint hingegen :
“Und diese Tatsachen zeigen nun auch, daß Kant unbedenklich von einer Mehrheit von uns affizierenden Dingen an sich redet und offenbar der Meinung ist, daß jeder Erscheinung auch ein Ding an sich entspreche.“ [Seite 10]
“Denn es handelt sich ja für Kant, wie er oft feststellt, bei dem Gegensatz von Erscheinung und Ding an sich nicht um zwei ver-schiedene Arten von Gegenständen, sondern nur um eine verschiedene Betrachtungsweise ein und derselben Gegenstände, [...]“ [S. 109] (E. Adickes, Kant und das Ding an sich, 1924, Georg Olms 1977, S. 10, 109)
Ähnlich äußert sich Herr Adickes auf Seite 38 seines zitierten Werkes (wie wir zwei Seiten zuvor, unser Buch, gesehen haben).
Kant selbst geht, ursprünglich zumindest, eindeutig von einer direk-ten Beziehung der Dinge a. s. s. zu den jeweiligen Erscheinungen aus:
“Ich dagegen sage: es sind uns Dinge als außer uns befindliche Gegenstände unserer Sinne gegeben, allein von dem, was sie an sich selbst sein mögen, wissen wir nichts, sondern kennen nur ihre Erschei-nungen, d. i. die Vorstellungen, die sie in uns wirken, indem sie unsere Sinne affizieren. Demnach gestehe ich allerdings, daß es außer uns Körper gebe, d. i. Dinge, die, obzwar nach dem, was sie an sich selbst sein mögen, uns gänzlich unbekannt, wir durch die Vorstellungen kennen, welche ihr Einfluß auf unsre Sinnlichkeit uns verschafft, und denen wir die Benennung eines Körpers geben, welches Wort also bloß die Erscheinung jenes uns unbekannten, aber nichts desto weniger wirklichen Gegenstandes bedeutet [aber ein subjektives – kein absolutes Wirkliche!]. “ (Prol. Erster Teil, Anmerkung II)
“Also ist die Wahrnehmung dieses Beharrlichen nur durch ein Ding außer mir und nicht durch die bloße Vorstellung eines Dinges außer mir möglich.“ (KrV B275 – Original kursiv, siehe zu diesem Themen-komplex zudem Zitate und Anmerkungen der zurückliegenden soge-nannten “Vorbereitung zum Hauptteil“.)
Meiner bescheidenen Meinung nach ließe sich der unmittelbare Sachverhalt etwas kürzer und präziser fassen:
Dinge an sich selbst sind Erscheinungen abzüglich des subjektiven Einflusses – oder:
Erscheinungen sind Dinge an sich selbst zuzüglich des subjektiven Einflusses.
Fragwürdig ist allerdings, ob Kant Präzision und Kürze in diesem Zusammenhang gelegen wäre – das ist kaum anzunehmen – andern-falls hätte er sie sicherlich selbst inszeniert.
Zuweilen scheint sich Kant in diesem Punkt gar zu widersprechen, besonders wenn man entsprechende Textstellen der ersten Ausgabe der KrV mit denen der zweiten vergleicht, beispielsweise die soeben zitierte Stelle und KrV BXXVII, BXLI, mit A371, A385, A480-1/B508-9.
Man kann jedoch allgemein, und Theoretiker neigen gerne dazu, leicht auf die Goldwaage legen, was nicht darauf gehört. In diesem Zusammenhang wird in philosophischen Kreisen öfters, im fast wörtlichen Sinne, um jeden Millimeter Land gerungen, wie wir mit Hilfe zweier in unserem Diskussionskreis bereits bekannter Gastredner sogleich (S. 149 und 150) demonstrieren werden.
Man kann sich allerdings auch sehr leicht von der Komplexität einer strittigen Sache übermäßig beeindrucken und somit gefangen setzen lassen. Jede fachliche Diskussion läuft Gefahr, die allgemeine Verhält-nismäßigkeit aus den Augen zu verlieren und umso mehr, je fachlicher sie ist. Je mehr man im Detail prüft, umso leichter wird man von jenen Details eingenommen und erkennt also nicht, dass das jeweilige Projekt insgesamt eventuell fragwürdig ist. Zu Kant sollte man gerade aus der Distanz heraus äußerst vorsichtig sein, wer erst im Detail kritisch wird, ist schon gefangen und hat sodann kaum noch eine Chance seinen fast schon magischen Zauberformeln zu widerstehen.
(Wir werden uns jedenfalls hüten, unser Werk erneut leichtfertig einem Fachmann vorzustellen, → S. 108.)
Dass Kant möglicherweise bewusst allzu eindeutige Definitionen scheut haben wir bereits im Zusammenhang mit dem Wort “affizieren“ angedeutet (S. 47-8, 50). Hier käme also eventuell ein weiterer Fall hinzu. Immerhin sind Aussagen welche die direkte Beziehung zwischen Dingen an sich selbst und Erscheinungen betreffen relativ rar in der KrV (nebst Prol.). Und da jene Relation ohnehin hinsichtlich der damit unweigerlich verbundenen Kausalität problematisch ist, hat dies im Laufe der Zeit vermutlich einige Kommentatoren zu dem höchst fragwürdigen Schritt inspiriert, die Existenz der Dinge an sich selbst bezüglich des Kantschen Systems gänzlich zu verwerfen.
Die Frage, ob unseren Erscheinungen 1:1 oder 1:(unbestimmt) reale Dinge an sich gegenüberstehen, lässt sich ganz ähnlich u. a. dadurch scheinbar umgehen, indem man an der realen Existenz der Dingen an sich (selbst) zu zweifeln beginnt. Letzteres ist, wie gesagt, in der Tat versucht worden (die Gründe dafür sind unterschiedlich, sind jedoch hier nicht von weiterem Interesse). M. P. M. Caimi und S. Brysz seien in diesem Gedankenzug dennoch zitiert, zunächst S. Brysz:
“Denn das Dasein der Dinge an sich, die früher harmlos vorausgesetzt wurden, hat sich infolge der Kritik, die Kants Werk erfahren hat, zum Problem ausgebildet. [...]
Die transscendentale Ästhetik, die in ihren Hauptzügen bereits im Jahre 1770 fertig war, hatte die Dinge an sich vorausgesetzt. Die transscendentale Analytik zieht ihre kritische Konsequenz so weit, dass, wo Anschauung fehlt, nicht nur keine Erkenntnis möglich ist, sondern, dass man von einem derartigen übersinnlichen Dinge nicht einmal aussagen darf, dass es ist. Sie bezieht dies jedoch nur auf Noumena in positiver Bedeutung, weil sie vor allem gegen dogmatische Rationalisten zu kämpfen hat. Hierbei übersieht Kant freilich, dass dasselbe, was sich über das Noumenon in positiver Bedeutung sagen lässt, nicht minder von demjenigen in negativer Bedeutung gilt, und übersieht dies deshalb, weil die Dinge an sich für ihn etwas so Selbstverständliches waren, dass an ihnen zu zweifeln ihm nicht in den Sinn gekommen ist. Infolge der Kritik seitens seiner Gegner wird Kant auf das Problem aufmerksam. Jetzt gibt er zu, dass theoretisch das Ding an sich nicht zu rechtfertigen sei, deutet aber an, es seien praktische Gründe vorhanden, die anzunehmen zwingen, dass dem Sinnlichen ein Übersinnliches zugrunde liege.“
(S. Brysz, Das Ding an sich und die empirische Anschauung in Kants Philosophie, 1913, Georg Olms Verlag 1981, Seite 19. – Die heutigentags kaum verständliche, zumindest ungebräuchliche “ſs“-Kombinationen des Originals haben wir willkürlich in “ss“ umgesetzt.)
Kant hat demzufolge nachträglich versucht die zunächst eindeutige Stellung der Dinge an sich zu relativieren, womit er allerdings die Basis seines Systems mit-relativierte. Damit wurde er hinsichtlich zur zweiten Ausgabe der KrV zu erheblichen Kompromissen gezwungen. Kompromisse überzeugen jedoch nie vollständig; äußerst schwach wirken sie natürlich akkurat im erkenntnistheoretischen Bereich, wo es nicht auf praktischen, sondern auf absoluten Bezug ankommt. Viele Kommentatoren bevorzugen die Originalausgabe der KrV, z. B. Schopenhauer – aus nahe liegenden Gründen. Doch nun zum angekündigten Beitrag M. P. M. Caimis:
“So bestehen nebeneinander die Auffassungen, nach welchen der der Empfindung entsprechende Gegenstand als ein Erscheinungsge-genstand und als ein die Erkenntnisbeziehung transzendierender Gegenstand angenommen wird. [Wir hoffen Herr Caimi weiß genau was er damit meint – wir wissen es jedenfalls nicht! Wir geben uns mit solchen Gedanken auch nicht weiter ab, da, wie aus dem Hauptteil ersichtlich sein sollte, wir die entscheidenden Fehler Kants an anderer Stelle sehen. Dennoch dürfte dieses Zitat insgesamt von einigem Interesse sein.] In der Kantinterpretation lassen sich dementsprechend zwei Hauptströmungen unterscheiden [Vermerk] . Die eine, die ihren Ursprung bei Joh. Sigismund Beck hat und zu ihren Vertretern etwa Maimon, Fichte, Cohen zählt, neigt dazu, die Affektion als von Erschei-nungen verursacht zu betrachten [ein extrem komplizierter Gedanken-gang, den wir hier nicht weiter diskutieren können und auch nicht wollen – aus besagten Gründen.] [Vermerk] , indem sie das Ding an sich ’als eine Konzession [Kants] an die unkritische und naive Denkweise’ [Vermerk] versteht. Die andere Strömung zählt zu ihren Anhängern Schopenhauer, Riehl, Staudinger, Adickes, Paton, Herring u. v. a. Sie vertreten eine Affektion von seiten des Dinges an sich und versuchen auf verschiedene Weise die Probleme zu lösen, die dieser Position unvermeidlich anhängen.“
(M. P. M. Caimi, Kants Lehre von der Empfindung in der Kritik
der reinen Vernunft, Bouvier Verlag, 1982, Seite 65)
Das lassen wir so stehen wie’s steht. Ob Kant ursprünglich tatsäch-lich von der Existenz der Dinge an sich selbst absolut überzeugt war wie S. Brysz behauptet (S. 149 unten) mag hier dahingestellt bleiben. Es könnte auch sein, dass er mehr oder weniger bewusst immer wieder seine Trümpfe ins Spiel wirft um von seinen Schwachstellen abzulenken. Kant ist nicht sehr bescheiden bezüglich seiner eigenen Pluspunkte, die er mit beschwörendem Nachdruck immer und immer wieder wie eine Zauberbrause in den Text der KrV einstreut, vor allem:
“[...] die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung über-haupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegen-stände der Erfahrung, [...]“ (KrV B197/A158)
Die Beschwörungsformel scheint zu wirken, zumindest hat Kant ganze Generationen von Philosophen ziemlich erfolgreich damit genarrt – wir beschränken uns hier auf ein relativ modernes Beispiel:
“[...] es kann einfach nicht genug wiederholt werden [...] daß die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung gleichzeitig die Bedin-gungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung sind.“
(Georg Römpp, Kant leicht gemacht, Böhlau Verlag 2005, Seite 39)
Der Meinung sind wir nicht. Wir behaupten im Gegenteil, dass jene relativ fixe, fest vorgegebene Bedingungskette, in erkenntnistheoreti-scher Raison, an sich inhaltslos und also belanglos ist – es überhaupt prinzipiell unmöglich ist, dass sie Einfluss auf unsere Erscheinungen der Erfahrung hätte.
Nicht belanglos, aber auch nicht unbedingt entscheidend ist die immer noch aktuelle Frage der Relation der Dinge an sich selbst zu den jeweiligen Erscheinungen. Denn egal, ob ein ganz bestimmtes Ding an sich selbst (1:1) oder eine vage Relation von Dingen an sich selbst (unbestimmt : 1) bestimmten Erscheinungen gegenüberstehen, in beiden Fällen scheint der ur-eigentliche Grund für differenzierte Erscheinungen sich, aus unserer Sicht, nicht aus inneren, sondern aus äußeren Umständen zu ergeben, auch wenn man berücksichtigt, dass mit Kant innerliche Bedingungen der Möglichkeiten der Erfahrung grundsätzlich gegeben sein müssen.
Dass wir nicht die Einzigen sind, denen in Bezug zu Kant eine gewisse “Differenziertheit“ Probleme bereitet, beweist das folgende hochinteressante Zitat:
“Wenn wir aber an die Kritik mit folgender Frage herantreten: sind die besonderen Formen der anschaulichen Welt als Folgen der Differenziertheit der Dinge an sich oder als selbstständige Modifika-tionen des Raumes anzusehen? so bekommen wir keine genügend klare Antwort. Die von uns zu Anfang angeführte Einschränkung: ,die unermessliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen’ kann nicht ‚aus der reinen Form der sinnlichen Anschauung hinlänglich begriffen werden’, gibt uns keinen genauen Aufschluss darüber, was unter dem Ausdruck ‚Mannigfaltigkeit’ gemeint sei: versteht Kant darunter nur die Empfindung, oder auch die räumlichen Gestalten? Dass wir trotz der Wahrscheinlichkeit der letzten Deutung Anlass haben, daran zu zweifeln, wird sich bald zeigen. Der obige Satz enthält außerdem eine Einschränkung, die im Worte ‚hinlänglich’ zum Ausdruck kommt. ‚Sie lässt vermuten, dass Kant selbst unsere Frage nicht scharf genug ins Auge gefasst und nicht genau bestimmt habe, was dem Dinge an sich und was der reinen Form als modifizierender Tätigkeit zuzuschreiben sei.“ (S. Brysz, Das Ding an sich und die empirische Anschauung in Kants Philosophie, 1913, Georg Olms Verlag, 1981, Seite 53, ursprüngliches “ſs“ wurde hier erneut unsererseits “ss“ geschrieben.) Unsere Antwort zu diesem
Kommentar wäre → S. 56, 119, nebst:
Nun, wenn man davon ausginge, dass die Differenziertheit der Dinge an sich selbst nicht vorhanden sei, so wäre Kant unweigerlich im absoluten Idealismus gefangen und könnte somit getrost auf die äußeren Dinge an sich selbst komplett verzichten. (Es ist jedenfalls unmöglich anhand undifferenzierter Aspekte auf Differenzen zu schließen.) Dann aber wird es für Kant noch weit ungemütlicher, denn aus der bloßen Fülle innerer Potentialität besteht erst recht kein Indiz für irgendwelche bestimmte Individualität.
Kant bliebe in dieser Überlegung allenfalls noch die Chance, seine Dinge an sich selbst quasi als Motor zu einem Wagen zu sehen. Das wiederum setzt voraus, dass jener Motor zu jenem Wagen mitfährt und nicht etwa stehen bleibt, wo er ist oder ganz andere Wege beschreitet. Das hätte für Kant also die Folge, dass beide grundsätzlich ein gemeinsames System bilden, und dass alsdann z. B. Raum und Zeit generell und absolut existieren und nicht lediglich im Menschen.
Selbst wenn man Kants Dinge an sich selbst als eine Art Kraftwerk zulässt, so wird man dieses spezielle Problem nicht los. Denn ein Kraftwerk ist nicht restlos unabhängig von den jeweiligen Endverbrau-chern. Die individuelle Weise in der Energie genutzt wird bleibt dem Lieferanten nicht verborgen, keineswegs. Ob eine Glühbirne einge-schaltet wird, das Radio, ein Küchengerät oder irgend ein Motor – all das hat direkte Konsequenzen für den jeweiligen Stromlieferanten: er muss letztlich auf jede noch so geringe Forderung des Verbrauchers reagieren, d. h. Energie liefern, was analog zur jeweiligen Forderung mit Arbeit und also mit Veränderung verbunden ist!
Für Kant wäre diese analoge Veränderung jedoch eine Katastrophe, denn das würde bedeuten, dass jeglicher Differenzierung in der Welt unserer subjektiven Erscheinungen eine Differenzierung in der absolu-ten Realität der Dinge an sich selbst entsprechen muss (→ u. a. S. 156).
Kant nutzt seine Dinge an sich selbst als eine Art hyper-autonomes Kraftwerk – eine äußerst bizarre Utopie – eine logische Perversion sondergleichen die quasi voraussetzt, dass Kraft keine Kraft hat.
14. Ist die “Welt der Dinge an sich“ geordnet?
Kant schließt die äußere Realität der Welt und die äußeren Dinge an sich selbst nicht aus, ganz im Gegenteil, allerdings bestreitet er deren Ordnung, bzw. bestreitet, dass die Welt im absoluten Spektrum die gleiche Ordnung hat, wie die subjektive Welt unserer Erscheinungen – unserer Erfahrung generell.
Denn die Ordnung all unserer Erfahrung gründet sich auf subjektive Gegebenheiten, während alles durch die Sinne erworbene Äußere zufälliger Natur ist (siehe z. B. KrV A112, A560/B588) gemäß der Ansicht, dass Notwendigkeit sich lediglich aus apriorischen Umständen ableiten lässt. Will Kant damit sagen, dass die äußere Welt völlig ungeordnet und chaotisch ist, oder will er lediglich andeuten, dass wir die Ordnung der äußeren Welt grundsätzlich nicht erkennen können, weil wir sie lediglich a posteriori als empirische Erfahrung erleben?
Dazu ein weiteres Zitat von S. Brysz:
“Kant hatte behauptet, Raum, Zeit und Kategorien sind für die Erscheinungen ordnende Prinzipien. Wie der zu ordnende Stoff vor dem Eingreifen der apriorischen Formen beschaffen sein müsse, hat Kant nicht erörtert. [...] Nachdem Kant diese Frage offen gelassen hatte, konnte man entweder annehmen, dass das Material bereits vom Ding an sich in einer gewissen, wenn auch nur intelligiblen, Affinität geliefert wird. Die Formen die uns zugebote stehen, haben dann diese Ordnung nur in eine empirische umzuwandeln. Oder aber es lag nicht fern – und die Kantische Erkenntnistheorie drängt es oft geradezu auf – anzunehmen, dass der Stoff in völlig chaotischem Zustande uns gegeben werde, und dass die Ordnung das ursprüngliche Werk von Raum, Zeit und Kategorien sei. [...] die Frage ist: handelt es sich bei dem Ordnen der Erscheinungen nur um eine Übertragung einer Ordnung in die andere, gleich der Aufgabe eines Bildhauers, der ein Gemälde in eine Marmor-Statue umzuwandeln hat, oder hat es dieser Bildhauer nur mit einem Marmorblock ohne jede Form zu tun, den er schöpferisch gestalten muss? [...] Wir haben es also hier unstreitig mit einer Lücke zu tun [...]“
(Simon Brysz, Das Ding an sich und die empirische Anschauung in
Kants Philosophie, 1913, G. Olms Verl. 1985, Seite 45 – hier erneut
mit geringfügigen orthografischen Änderungen meinerseits, → S. 152, oben.)
Wenn Kant darauf verweist, dass alles Empirische zufälliger Natur ist, so kann er damit eigentlich nur meinen, dass sich jene unterstellte Zufälligkeit auf unsere Erkenntnisfähigkeit bezieht und nicht auf die vermeintlich empirischen Fakten und Umstände an sich, denn Letzteres würde quasi bedeuten, dass die absolute Realität der Dinge an sich zufällig, chaotisch und ungeordnet wäre, was wiederum im Widerspruch zu einer an und für sich funktionierenden Welt stehen würde. Denn alles was funktioniert hat eine Ordnung. Die Welt funktioniert, also muss sie gemäß ihrer Funktion eine Ordnung haben. Dass jene Welt aus subjektiver menschlicher Sicht eine zufällige Natur (nach Hume und Kant) zu haben scheint, sollte nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass die absolute Realität der Welt an sich in ihrer Basis eine Ordnung haben muss, denn andernfalls könnte sie, wie gesagt, nicht geordnet funktionieren.
Wir wollen uns nun nicht mehr als unbedingt nötig in diesen speziellen Punkt vertiefen, es sei jedoch ausdrücklich erwähnt, dass vergleichbare Kommentare in der Fachliteratur zum Teil ganz erheblich voneinander abweichen. Wenn Kant, wie oben behauptet wurde, in diesem Zsh. eine Lücke hinterlassen hat, so sollte man nicht mit allen möglichen Kunstgriffen versuchen jene Lücke zu schließen, was nichtsdestoweniger immer wieder versucht wird. Kant hat sich relativ viel Zeit für seine Erkenntnistheorie gelassen und überhaupt lässt die hoch strukturierte Form dieser Arbeit nicht vermuten, dass es sich hier um eine Nachlässigkeit -, als vielmehr um ein Problem handelt, das vom Stande des Transzendentalen Idealismuses schlicht und einfach nicht gelöst werden kann. Kant vertritt jenen Transzendentalen Idealismus meisterhaft – er hat in dieser Hinsicht keine “Verbesserungsvorschläge“ nötig, weder von Schopenhauer und Vaihinger noch von Cohen und Kollegen.
Allerdings leistet nicht zuletzt Kant selbst erheblichen Vorschub für solche “Ausbesserungen“ indem er an seiner ursprünglichen A-Version, sehr deutlich von Kritikern beeinflusst, nachträglich herumbastelt und ihr schließlich eine nicht unerheblich abweichende B-Version gegenüberstellt, und somit insgesamt unwillkürlich weitere “Ausbesserungen“ (anderer Autoren) regelrecht provo-ziert. Denn vollends befriedigend ist weder die A-, noch die nachfolgende B-Version. Die A-Version wird dem Transzendentalen Idealismus meiner bescheidenen Meinung nach optimal gerecht, sie kann hingegen nicht absolut befriedigen, weil jener Idealismus nun mal ein fehlerhaftes Konzept darstellt. Mittels der B-Version versucht Immanuel instinktiv seinem Transzendentalen Idealismus Füße im absoluten Bereich zu beschaffen. Wenn jene A-Version ein Fehler war, so ist die nachfolgende B-Version ein doppelter. Wie dem auch sei, offenbar sah Kant nicht ein, dass sein System gerade von erheblichen Widersprüchen lebt, anderenfalls hätte er es doch gleich bei der A-Version belassen können.
Dass der entscheidende Grund für jegliche Differenziertheit unserer Erscheinungen – für das Mannigfaltige unserer Anschauungen – letztlich auf äußere Umstände beruht, schließt innere Bedingungen keineswegs aus, sofern sie als sogenannte Rahmenbedingungen vorlie-gen, und als solche keinen inhaltlichen Einfluss auf die betreffenden “Erscheinungen“ hätten.
Kant würde allerdings förmlich explodieren auf einen solchen Vorschlag. Denn er geht definitiv davon aus, dass unsere subjektiven Vorgaben ganz erheblich unsere Erscheinungen prägen, was er nicht müde wird immer und immer wieder aus teilweise verschiedenen Blickrichtungen zu propagieren.
Dass dies jedoch prinzipiell unmöglich ist, haben wir im zurücklie-genden Hauptteil erörtert.
Raum und Zeit, Kausalität, Ausdehnung, Form, Farbe usw. sind ge-mäß Kant exklusive subjektive Vorgaben – sie existieren nur “inner-halb“ als Möglichkeiten der Erfahrung überhaupt. Farben (und alle sogenannten sekundären Qualitäten) sind gemäß Kant zudem bedingt durch die individuelle physikalische Struktur unserer Sinnesorgane.
Schön und gut, warum aber ordnen wir der einen Erscheinung z. B. 10 Minuten, einer anderen eine Stunde – einem Gegenstand 30 cm, einem anderen 50 m – einer Erscheinung die Farbe blau der anderen die Farbe rot, usw. zu? Weil es unsere subjektiven gesetzlichen Vorga-ben (und unsere sensuellen Organe) so und nicht anders vorschreiben! Warum aber schreiben sie es genau so vor und nicht irgendwie anders? Spätestens ab dieser Frage käme Kant entschieden in Verlegenheit.
Denn er müsste nun zugegen, dass der Grund für die differenzierte Anwendung bestimmter Kategorien oder bestimmter Anschauungsfor-men in konkreten Einzellfällen nicht wiederum in jenen Vorgaben liegen kann (will er den absoluten Idealismus vermeiden) sondern in äußeren Gegebenheiten liegen muss, also in den Dingen an sich selbst die unsere Sinne affizieren. Damit müsste er jedoch letztlich zugeben, dass Farbe, Größe, Raum und Zeit usw. bereits äußere Realität hätten, bevor sie innerlich als solche “erkannt“ werden.
Was kommt überhaupt von Außen nach Innen? Empfindung, empiri-sche Anschauung und deren Wesen ist bei Kant im Grunde ein völlig ungeordneter Strom, ein völlig undefinierbares “etwas“. Und was soll dieses “etwas“? Nun, ganz einfach, es soll die Phantasie, unser Innenleben, unsere Vorstellungen, unsere Erfahrung in Gang setzen und aufrecht erhalten. So wie ein Motor Strom, Benzin, Windkraft oder sonst eine Quelle als Energie braucht, braucht unser Verstand eben auch mentale Energie, könnte man hier für Kant argumentieren.
Kant braucht aber diesbezüglich eine ganz bestimmte Form der Energie, er braucht Differenz, er braucht bestimmte logische Kriterien, die es ihm erlauben, den individuellen Fall vorzubereiten. Mit bloßer Energie ist Kant hier nicht geholfen – er braucht keine physikalische Kraft, er braucht logische Befehle, konkrete Anhaltspunkte und genau das kann ihm seine empirische Anschauung nicht liefern, weil sie in seinen eigenen Augen ein völlig unzuverlässiges zufälliges Wesen hat – für Kant selbst jedoch offenbar kein Problem!
Warum ist das für Kant selbst kein Problem? Nun, ganz einfach, weil er felsenfest davon überzeugt ist, oder es schlicht und einfach rigoros verlangt, dass seine Maschine Mensch quasi aus un logischen Befehlen logische Ableitungen schaffen kann. Wenn dies aber tatsächlich gelingen sollte, so würde die empirische Anschauung letztlich wirklich quasi als eine Art physikalischer Energielieferant gebraucht werden. Sodann wäre indes jeglicher innere Drang sich überhaupt nach außen differenziert zu verhalten überflüssig:
Energie ist überall gleich Energie. Vorstellungen sind aber immer differenziert. Wenn wir momentan nach links sehen so erscheint uns sodann ein Fenster, sehen wir nach rechts, so sehen wir eine Tür. Die Differenz dieser beiden Erscheinungen lässt sich unmöglich dadurch begründen, dass in beiden Fällen im Grunde der gleiche äußere Stoff auf uns einwirkt. Bräuchten wir lediglich undifferenzierten “Stoff“, so müssten wir erst gar nicht unseren Blick z. B. von links nach rechts wenden – “Stoff“ hätten wir zur Genüge aus jeder beliebigen Richtung.
Warum also ein Richtungswechsel in der Art der Infor-mationsaufnahme überhaupt, wenn, im Sinne Kants, von außen angeblich keine Differenz besteht, die diesen Wechsel begründet?
Der inneren Differenz muss also eine äußere entsprechen, ganz egal welche noch so perfekte apriorische Apparatur auf subjektiver Seite eventuell dahintersteht, andererseits fehlt jeglicher Bezug vom Allgemei-nen zum Einzelnen – fehlt zudem jeder Anreiz äußerlich zu reagieren.
Kant ist offenbar der Meinung, dass unsere innere Ordnung dazu in der Lage ist ein fremdes Medium, ein völlig unbestimmtes etwas aus einer völlig fremden Dimension nach jener inneren Ordnung zu richten.
Damit unterstellt er unwillkürlich dem Zufall eine Art versteckter In-telligenz (→ S. 158, 193, 209) wenn er mysteriöser Zauberei entgehen will.
Aber es geht dabei eigentlich nicht darum etwas zu ordnen. Es geht vielmehr darum, die Differenz der geordneten Vorstellungen zu begründen. Und diese Differenz z. B. zwischen der Erscheinung einer Tür und jener eines Fensters ergibt sich nicht dadurch, dass wir die äußere Welt ordnen. Die Unterschiede in den einzelnen Vorstellungen verlangen differenzierende Kriterien die über den Aspekt bloßer Ordnung kategorisch hinausgehen. Das hat Kant nicht erkannt.
Intelligenz verlangt Differenz. Aus Gleichförmigkeit lässt sich prinzipiell nicht intelligent unterscheiden. Es spielt also keine Rolle wie intelligent ein System an sich sein mag, ein Strom nicht-intelligen-ter Materie kann ihm nicht dazu dienen, sich nach außen intelligent zu verhalten – kann ihm nicht den innerlich notwendigen Schritt vom Ganzen zum Einzelnen begründen – die aktuelle Thematik fassen wir auf Seite 192 in eine Art Formel – jetzt aber wird’s nochmals gesetzlich:
“[...] der Verstand ist selbst der Quell der Gesetze der Natur [...].“
(KrV A127 – Original kursiv)
“Die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein, [...].“ (KrV A125 – Original
kursiv, ein uns offenbar besonders treues Zitat – fünfte und voraus-
sichtlich letzte Wiederholung, → S. 30, 64, 73, 82, 134 .)
Was Kant in diesen beiden kurzen Auszügen sagt ist grundsätzlich extrem problematisch. Denn wir sind selbst von der Ordnung, die wir der Welt, im Zuge Kants, sozusagen vermachen, extrem abhängig. Wir sind dermaßen von der Welt abhängig, dass man – nicht dass wir Kant bewusst provozieren wollen – sagen könnte: Ohne die Welt würden wir nicht existieren. Damit geraten wir in einen sehr merkwürdigen Umstand: Die geordnete Welt unserer Erscheinungen existiert nicht ohne uns – gleichzeitig existieren wir nicht ohne die Welt.
Im Geiste Kants erschaffen wir die Welt über uns, erlauben ihr großzügigerweise, quasi aufgrund unserer apriorischen Existenz, uns empirisch und offiziell zu gebären und zu beherrschen, obgleich wir natürlich a priori voll am Drücker bleiben, und doch fallen wir eventuell bei der einen oder anderen idiotisch-empirischen Kleinigkeiten letztlich voll auf die Nase – das kann doch irgendwie nicht sein!
Denn auf diese Weise wird alle exekutive Gewalt der Welt auf das Subjekt reduziert das zugleich Opfer dieser Gewalt ist. Hier liegt sicher ein eklatanter logischer Fehler vor: Geben bedeutet nicht Nehmen. Befehlen bedeutet nicht Gehorchen – in der Denkart Kants gehorchen wir jedoch der Natur, die wir befehlen – das klingt insgesamt nicht sehr überzeugend!
Allerdings könnte man für Kant einwenden: Die apriorische Gewalt liegt auf einer anderen erkenntnistheoretischen Ebene als die empirische, das Apriorische ist dem Empirischen übergeordnet. Das würde hingegen zu einem völlig unüberschaubaren Hickhack von Bedingungen und Gegenbedingungen führen, auf den wir uns hier nicht weiter einlassen werden (– siehe auch → S. 75-6).
Kant überschätzt zudem erheblich die Möglichkeiten “gesetzlicher“ Mittel bzw. die Mittel jeglicher zentralen Steuerung.
I = U:R, bekannte Formel des Ohmschen Gesetzes, es gilt in Bayern, wie in Hessen, am Wilhelmsturm wie am Kölner Dom und überall – hat also allgemeine Gültigkeit. Der Begriff “Allgemein“ ist aber im Grunde ein Gegenbegriff zum “Einzelnen“. Und doch bezieht jenes Gesetz sich gegebenenfalls auf ganz konkrete Einzelfälle mit individu-ellen Werten. Je nachdem welche Eingangswerte gestellt sind erhält man indes sehr unterschiedliche Resultate, die insgesamt ein allge-meines Ganzes bilden. Gesetze/Regeln sind grundsätzlich allgemeiner Natur, und somit an sich unfähig das Einzelne zu erreichen. Falls mittels eines solchen das Individuelle erreicht wird, so geschieht dies nicht wirklich aufgrund des Gesetzes, sondern aufgrund der be-stimmten Fakten, die mittels jener Regelung verarbeitet werden.
Es gibt freilich sehr verschiedene Arten von Gesetzen, die Bewe-gungszustände, Entwicklungsetappen, Strukturen, Erhaltungszustände, ... beschreiben. Immer aber sind entsprechend verhältnismäßig eindeutige Werte im Spiel. Aus dem spezifischen Verhalten konkreter Werte lassen sich Regeln usw. ableiten. Kant aber leitet jene Werte von Regeln ab (ganz offensichtlich zeigt er das z. B: KrV A125-8/B159-65, → u. a. S. 75, 83, 100), womit er buchstäblich den eigentlichen Charakter des Gesetzlichen auf den Kopf stellt. Den Kopfstand beherrscht Immanuel, das wissen wir bereits von Seite 30 und 94. Hier aber leistet er sich gleich einen doppelten: nicht genug, dass er willkürlich Fakten erzeugt exakt mittels dem Medium, für das sie gebraucht werden, zudem akzeptiert er “rohen Stoff“ und “Zufall“ als intelligente wohl-differenzierte zielbewusste Befehle. Der Verstand als mutmaßlicher Gesetzgeber der Natur reagiert über die Anschauung auf äußeren inhaltslosen nicht-notwendigen blinden Zufall, bzw. auf rohen Stoff mit notwendiger Bestimmtheit und präzisen Inhalten – das ist prinzipiell unlogisch und unzulässig (vergl. zu → S. 31, 193, 207-9).
Kant kommt in diesem (sehr weitreichenden) Zsh. eminent ins Schleudern. Begriffe bezieht er auf das Allgemeine nicht auf das Einzelne (z. B: KrV A113, B4, A25/ B40, A51/B75, A68/B93, A320/B377). Andererseits aber macht er alle Inhalte der Erfahrung in jeder Einzelheit von den Kategorien und reinen Anschauungsformen absolut abhängig (z. B. KrV B163-5, B197/A158) womit er unweigerlich inhaltlich von den Kategorien auf einzelne, individuelle Fakten schließt, was ganz eklatant gegen den allgemeinen Charakter eben jener Kategorien verstößt, die Möglichkeiten des Gesetzlichen willkürlich und unzulässig ins Unmögliche erstreckt und überhaupt dessen eigentliches Wesen gröblichst verletzt (siehe u. a. auch S. 86, 110, 134-7, 190-1, 197-8).
15 Farben, die Zeit, Maße
Je mehr Geld im Sack, umso größer die Möglichkeiten – ein offenbar rundweg rein positiver Aspekt, der freilich völlig über-sieht, dass mehr Möglichkeiten mit mehr Verantwortung usw. verbunden ist und letztlich bei scheinbar absoluter Freiheit die Wahl zur Qual und inneren Gefangenschaft wird [→ S. 418-9, Orig.].
Nun, bei Kant wird die Wahl angesichts der subjektiven Möglichkeiten der Erfahrung nicht lediglich zur Qual – sie wird schlicht unmöglich. Denn aus der bloßen Möglichkeit geht in keiner Weise hervor, wie jene Möglichkeiten zum konkreten Einzelfall umgesetzt werden sollen. Jede Erhöhung jenes Potentials macht jene Umsetzung grundsätzlich nicht einfacher, sondern schwieriger – grenzenlose Möglichkeit macht schließ-lich absolut abhängig von einer also unabhängigen äußeren Realität. Dem Menschen sind alle Möglichkeiten der Erfahrung a priori gegeben, darin stimmen wir mit Kant überein. Entge-gen Kant sind wir jedoch der Meinung, dass dieser Fakt uns nicht zur Freiheit befugt, sondern ganz im Gegenteil, uns umso mehr an eine äußere Realität bindet. Jede Einzelheit unserer Welt der Erfahrung muss uns die Realität vorgeben, allein mit unserem inneren Potential wären wir völlig hilflos und zu jeder bestimmten Vorstellung komplett unfähig (u. a. auch → S. 178-9).
Nehmen wir an, wir hätten zwei völlig identische Bälle vor uns mit nur einem einzigen Unterschied – der eine Ball ist blau, der andere rot. Gemäß Kant wäre die Farbe dieser Bälle nicht zuletzt durch unsere subjektiven Vorgaben bestimmt. Wie aber ist es in diesem Falle möglich, dass wir zwei völlig identische Gegenstände unterschiedlich beurteilen – den einen blau, den anderen rot? Kants bekannte Formel, dass der Grund in uns selbst liegt, dass wir die jeweiligen Farben selbst zum jeweiligen Gegenstand “erfinden“, oder dass dies auf die Beschaffenheit unserer Sinnesorgane zurückzuführen ist, hilft (ganz besonders) in diesem Beispiel nicht weiter. Denn aus rein subjektiver Sicht wäre kein innerer bzw. subjektiver Grund vorhanden zwei völlig identische äußere Gegenstände unter-schiedlich, hier den einen blau den anderen rot, zu interpretieren.
Was also könnte ein menschliches Bewusstsein (in diesem Falle zunächst unsere Augen) dazu bewegen identische äußere Umstände unterschiedlich zu beurteilen? Offensichtlich keine bestimmte Regel, denn nach dem Grundprinzip einer jeden Regel erfahren relativ gleichgeartete Aspekte grundsätzlich gleiche Behandlung. Da die Bälle völlig identisch sind, müssten sie unter exakt den gleichen subjektiven (intellektuellen) Regeln des Verstandes und der sinnlichen Anschauung fallen (einge-schlossen die eher physikalischen Regeln des mitbeteiligten sensuellen Organs) – wir müssten demnach jenen identischen äußeren “Umständen“ letzten Endes identische Farben zuordnen.
Das eigentliche Problem das hier vorliegt ist folgendes: Verschiedene Gesetze/Regeln verlangen verschiedene Fakten – Kant füttert indes ein Gesetz wie das andere – eine Kate-gorie und Anschauungsform wie die andere – just mit undif-ferenziertem rohen Stoff – das ist prinzipiell unzulässig!
(auch → S.. 31, 100, 158, 207)
Dass wir gegebenenfalls unterschiedliche Farben zu identischen Gegenständen sehen, lässt sich aus subjektiven Vorgaben a priori also nicht erklären, was sich allerdings sehr einfach erklären ließe, indem man ganz einfach annimmt, dass farbliche Eindrücke letztlich auf äußere Gegebenheiten der jeweiligen Objekte selbst beruhen – genauer gesagt, auf der gesamten Kette der involvierten, einzelnen Glieder physikalischer Kriterien, wie z. B. die Oberflächenbeschaffenheit des Objekts, die Luftzusammensetzung, eventuelle Streufelder benachbar-ter strahlender Objekte, Gegenlicht oder Hintergrundstrahlung, die mannigfaltige optisch relevante Diversität der Augen, die elektrochemi-sche Eigenart der beteiligten Nervenbahnen usw.
Die Behauptung, dass Farben quasi eine Erfindung unserer Sinnesor-gane sei, ist, wenn nicht schlicht falsch, eine maßlose Übertreibung, bzw. eine völlig einseitige Betrachtungsweise. Allerdings wäre es nicht minder unsachlich, Farben strikt und ausschließlich auf Qualitäten der betreffenden Objekte zu beziehen.
Farben gründen sich zunächst auf objektive Gegebenheiten. Vom Objekt zum Auge und schließlich zur betrachtenden Seele ist allerdings ein relativ weiter Weg auf dem zugegebenermaßen viel passieren kann. Die entsprechende Information kann jedoch grundsätzlich nicht durch absolut starre Zwischenglieder, welcher Art auch immer, in positiver erzeugender Hinsicht beeinflusst werden.
Durch solcherlei starre Vorgaben lassen sich alle möglichen Bedin-gungen für das Sehen überhaupt ableiten – allerdings lediglich als Ein-schränkungen bzw. als Rahmenbedingungen (siehe Hauptteil) in nega-tiver Bedeutung. Eine positive inhaltliche Beeinflussung setzt flexible Bedingungen voraus. Generell steht es eigentlich jedem einzelnen Glied einer Informationskette frei die involvierte Information zu beeinflussen unter dem Preis allerdings, dass dies rückwirkend jenes einzelne Glied selbst beeinflusst und damit verändert, womit (langfris-tig) fixe Vorgaben für eine solche Eventualität – ganz bestimmte fest vorgegebene einzelne Kettenglieder – vorneweg aus-scheiden (relativ einmalige Ereignisse ausgenommen – siehe Hauptteil).
Nun ist der menschliche Körper, besonders im zellularen bzw. atomaren Bereich ständig in Bewegung. Die Reizverarbeitung der lichtempfindlichen Sinneszellen der Augen und die Informationsübertragung durch Nervenbahnen ist mit sehr viel Veränderung verbunden, die allerdings (mehr oder weniger) sofort wieder ausgeglichen wird. Es handelt sich hier ohnedies um “beauftragtes“ – lediglich um praktisches bzw. empirisches Terrain und nicht um die befehlende, a priori gesetzgebende, geistige Instanz unseres Verstandes bzw. unserer apriorischen reinen Anschauungsformen in der Denkart Kants.
“Die Zeit ist nichts anders, als die Form des innern Sinnes, d. i. des Anschauens unserer selbst und unsers inneren Zustandes. Denn die Zeit kann keine Bestimmung äußerer Erscheinungen sein; sie gehöret weder zu einer Gestalt, oder Lage etc. [...]“ (KrV A33/B49-0 )
“Die Zeit ist also lediglich eine subjektive Bedingung unserer (menschlichen) Anschauung [...] und an sich, außer dem Subjekte, nichts.“ (KrV A35, siehe auch A111, A158/B197, Prol. §11)
Dass die Zeit eine bestimmte subjektive Bedingung darstellt muss man nicht bestreiten. Dass die Zeit jenseits unserer subjektiven Vorgaben nichts ist, wie Kant behauptet, ist hingegen viel schwieriger zu akzep-tieren. Denn die subjektive Bedingung, dass wir alle Erfahrungsinhalte notwendigerweise a priori zeitlich verknüpfen bietet soweit noch kein Indiz für die konkrete Anwendung jener Bedingung der Verknüpfung der Zeit im individuellen Einzellfall. Dass eine bestimmte Handlung zehn Minuten dauert, eine andere vielleicht eine Stunde – jene Differenz geht aus der subjektiven Bedingung der Zeit in keiner Weise hervor. Woraus aber geht sie hervor? – eine Frage die Kant sich jedoch nicht stellt, weil er gewissermaßen glaubt das Einzelne gepachtet zu haben – falls nicht bereits mit Kategorien der Quantität (KrV A80/B106) so doch:
“Jene [die Anschauung] bezieht sich unmittelbar auf den Gegen-stand und ist einzeln [...]“ (KrVA320/B377) – Das ist sehr problematisch:
“Die Zeit ist kein diskursiver, oder [...] allgemeiner Begriff, sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauunng.“ (KrV A37/B47)
Und doch stellt Kant Begriffe und reine Anschauung (Zeit, Raum) praktisch auf die gleiche erkenntnistheoretische Rangstufe:
“Die Zeit ist die formale Bedingung a priori aller Erscheinungen überhaupt.“ (KrV B50/A34)
“Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a priori, [...] (KrV B4 – Original kursiv)
Aber je mehr allgemeine Bedingungen Kant auffährt, umso mehr wäre es notwendig, uns zu erklären, wie nun endlich das Allgemeine zur Anwendung im Einzelnen kommt. Er kann jedenfalls diesen erforderlichen Schritt nicht vollziehen, just indem er entsprechend auf weitere Allgemeinheiten (Begriffe, Kategorien) verweist. Seine sog. Synthesis des Mannigfaltigen hilft ihm da auch nicht weiter (→ S. 194).
Vergleichsweise ist die Bedingung innerhalb geschlossener Ortschaften maximal 50 km/h zu fahren noch kein Indiz dafür wie schnell ein bestimmter Fahrer tatsächlich fährt. Die (offizielle) Höchstgeschwindigkeit meines (uralten) Passats ist 143 km/h. Auch diese Angabe – so unabdinglich sie bezüglich dieses bestimmten Autos auch sein sollte – ist an sich noch kein Anhaltspunkt für die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit – sie ermöglicht zwar alles von 0 bis 143 km/h, lässt gleichzeitig dazwischen jedoch alles offen.
Warum in einer bestimmten Situation uns etwa ein Hund erscheint und keine Katze, lässt sich nicht damit erklären, dass wir der Natur die Gesetze diktieren, oder dass alle unsere Erscheinungen unter den verschiedenen Bedingungen von subjektiven Verstandeskategorien und Anschauungsformen stehen, denn Hund wie Katze, oder welche Gegenstände der Erscheinung auch immer, stehen in diesem Sinne alle gleich unter jenen Bedingungen (→ S. 192).
Da also in diesem Punkt eine generelle Gleichberechtigung unter allen möglichen Erscheinungsformen besteht, ergibt sich weder von inneren subjektiven apriorischen Gegebenheiten noch aus äußeren zufälligen Impulsen der empirischen Anschauung, noch aus einem Mix aus beiden irgendein Anlass in bestimmten Situationen ganz bestimmte Formen anderen vorzuziehen, beispielsweise einen Hund, anstatt vielleicht eine Katze.
Ebenso besteht in diesem Komplex absolut kein Anlass einer bestimmten Erscheinung etwa eine Länge von 5 Meter, einer anderen vielleicht 9 Meter oder nur 3 Zentimeter zuzuschreiben, für eine Handlung 1 Stunde, für eine andere nur 5 Minuten anzuerkennen, identische Bälle unterschiedliche Farben zuzuordnen, usw.
Hier könnte Kant natürlich einhaken, dass sich das Empirische ohnehin nicht voll aus subjektiver, apriorischer Gesetzmäßigkeit ableiten lässt (→ u. a. KrV B165) wobei er allerdings aufpassen müsste, dass er exakt an dieser Stelle nicht in den direkten, naiven Realismus abfällt – mit einem Bein wäre er mit dieser vagen Andeutung bereits abtrünnig. Er kann hier somit auf keinen Fall präzise sein.
Die erwähnte Vorgabe, dass unser Verstand der Natur die Gesetze vorschreibt (z. B: KrV A127-8, B163, Prol §17) ist in unserem aktuellen Sinne letztlich nicht befriedigend, wie Kant selbst an verschiedenen Stellen, indirekt zumindest, zugibt:
“Warum aber der intelligibele Charakter gerade diese Erscheinungen und diesen empirischen Charakter unter vorliegenden Umständen gebe, das überschreitet so weit alles Vermögen unserer Vernunft es zu beant-worten, [...]“ (KrV A557/B585, – zudem → S. 194)
Ähnlich verhalten kling das Folgende:
“Der Begriff vom Hunde bedeutet eine Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüßigen Tieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgend eine einzige besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich in concreto darstellen kann, eingeschränkt zu sein. Dieser Schematismus unseres Verstandes, in Ansehung der Erscheinungen und ihrer bloßen Form, ist eine verborgene Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur schwerlich jemals abraten, und sie unverdeckt vor Augen legen werden. Soviel können wir nur sagen [...]“ (KrV A141/B180-1)
Kant ist hier dabei, den bestimmten -, vom allgemeinen Hund abzuleiten – muss letztlich jedoch erkennen, dass er diesen Schritt genaugenommen nicht schlüssig erklären kann. Das ist kein Wunder. Denn er macht hier einen grundsätzlichen schwer-wiegenden Fehler: Dadurch, dass das Allgemeine, Subjektive, Gesetzliche alle unsere Vorstellungen notwendigerweise be-dingt, ist er versucht, die Bedingung in ihrem ganzen Wesen, in ihrer ganzen Bedeutung, lebendig wie abstrakt, kategorisch erhaben über das Bedingte zu erheben.
Dabei übersieht er, dass diesbezüglich das Ganze lediglich eine theoretische Verallgemeinerung einzelner Zustände umfasst. Das Ganze ergibt sich aus jener Verallgemeinerung. [Universalienstreit! – generell gehen in diesem Punkt die Meinungen jedoch sehr deutlich auseinan-der.] Eine allgemeine Bedingung mag mit dazu beitragen, Potentialität des Bedingten zur Realität zu verhelfen. Dennoch geht das Bedingte – wenn nicht körperlich, so jedoch ideell, als eigentlicher Zweck – seinen Bedingungen prinzipiell voraus – ein besonders heikler Punkt, den wir uns später nochmals vornehmen werden (→ S. 190-1).
Zuweilen scheint Kant das voll zu akzeptieren, z. B:
“Eine extensive Größe nenne ich diejenige, in welcher die Vorstellung der Teile die Vorstellung des Ganzen möglich macht, (und also notwendig vor dieser vorhergeht). Ich kann mir keine Linie, so klein sie auch sei, vorstellen, ohne sie in Gedanken zu ziehen, d. i. von einem Punkte alle Teile nach und nach zu erzeugen, und dadurch allererst diese Anschauung zu verzeichnen. Eben so ist es auch mit jeder auch der kleinsten Zeit bewandt. Ich denke mir darin nur den sukzessiven Fortgang von einem Augenblick zum andern, wo durch alle Zeitteile und deren Hinzutun endlich eine bestimmte Zeitgröße [!] erzeugt wird.“ (KrV A162-3/B203)
Nun, hier ist seine empirisch synthetische Maschinerie bereits voll am schnurren. Wie aber kommt er zu einzelnen Aspekten, “Linien, Punkten ...“ überhaupt? – über das Empirische? Rein vom Allgemeinen hätte er da keine Chance, wie er offenbar selbst sieht:
“Es ist merkwürdig, daß wir an Größen überhaupt a priori nur eine einzige Qualität, nämlich die Kontinuität, an aller Qualität aber (dem Realen der Erscheinungen) nichts weiter a priori, als die intensive Qualität derselben, nämlich daß sie einen Grad haben, erkennen kön-nen, alles übrige bleibt der Erfahrung überlassen.“ (KrV A176/B218)
“Durch eine reine Kategorie [...] wird also kein Objekt bestimmt, sondern nur das Denken eines Objekts überhaupt, [...]“ (KrV B304)
“Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a priori [...]“ (KrV B4 – Original kursiv)
Spätestens mit dieser zuletzt zitierten Generalbehauptung bleibt für Kant praktisch nur noch die empirische Anschauung für das Individuelle der Erfahrung übrig.
Wenn aber das Individuelle, oder sagen wir besser: wenn sich die individuelle Anwendung der Kategorien, sich ausschließlich aus dem Empirischen ergibt, so kann dies nur bedeuten, dass im Empirischen an sich differenzierende Kriterien der Zeit bzw. des Raumes vorhanden sind – verdeckt oder offen – und zwar unabhängig der menschlichen reinen Anschauung (Raum u. Zeit).
Das wiederum widerspricht dem absolut bestimmenden Charakter der Kategorien (→ u. a. S. 86, 158).
Kant wäre hier gezwungen der Affektion durch Dinge an sich selbst als durchaus differenzierendes Mittel zu verstehen. So-dann hätte er allerdings Schwierigkeiten mit dem unterstellten zufälligen Charakter des Empirischen, weil wirklicher Zufall keinerlei Intelligenz und somit kein Indiz für irgendwelche Differenziertheit überhaupt zulässt.
Will Kant uns etwa weismachen, dass mit zufälliger Differen-ziertheit – wie etwa dem Murmeln eines Baches, dem Rauschen des Meeres, dem Trommeln des Regens – irgend eine Art der Intelligenz – ein Drama, ein Schauspiel, ein Märchen, die Mathematik und überhaupt alles sich ableiten lässt?
Ja, genau das will er – das muss er wollen! Was sonst könnte bei Kant in letzter entscheidender Instanz die Aufgabe über-nehmen die himmelhohe Allgemeinheit der Kategorien auf den irdischen individuellen Einzelfall niederzuringen?
Ausgerechnet zufällige, geistlose Ziel-, Zeit-, und Raumlosig-keit des Äußeren nutzt Kant zu intelligenten Entscheidungen bezüglich geistiger, zeitlich-räumlicher Vorstellungen. Dass er sich quasi mit äußerem rohen Stoff etwa ein Schiff, ein Auto, ... baut, wäre nicht zu beanstanden – dass er jenem Baumaterial jedoch obendrein intelligente Führung zumutet, die das Schiff, (Auto, ...) an sich nicht hat, ist weit schwieriger zu akzeptieren. Kann man der Unordnung die Führung der Ordnung überlassen?
Aber das geht nicht, das ist prinzipiell ein Unding: Denn damit zwingt Kant (abgesehen u. a. von → S. 155-7) das Zufällige völlig willkürlich in ganz bestimmte intelligente Oberbegriffe – Oberbegriffe, die zu jener Zufälligkeit grundsätzlich im Widerspruch stehen. Er zwingt z. B. das äußere Nicht-Zeitlich-Räuliche der Affektion unter subjektive Oberbegriffe von Zeit und Raum – womit er buchstäblich Geist aus geistlosem Zufall zaubert, eine Perversion der Logik und der Ordnung generell.
Unordnung im absoluten Sinne ist eine Dimension, Ordnung eine ganz andere, beide sind nicht kompatibel. Kant übersieht, dass sich eine völlige Unordnung nicht ordnen lässt. Ordnung hat lediglich ordnende Kriterien die greifen, wenn jene Ordnung bereits potentiell in einer zu ordnenden scheinbaren Unordnung vorhanden ist. Ein tatsächlich völlig zufälliger Aspekt verhält sich zu einer Ordnung wie ein Nichts (siehe u. a. auch → S. 198).
Kant ist bezüglich der ordnenden Qualitäten seiner apriori-schen subjektiven Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung extrem naiv oder ganz einfach völlig über-optimistisch. Kann man etwa Kartoffeln in Automarken einteilen? Kartoffeln lassen sich aber doch in verschiedene Größen ordnen, selbstverständ-lich, allerdings funktioniert das nur, weil sie ohnehin “Größe“ haben noch bevor sie in bestimmte Größen eingeteilt werden.
Ebenso lassen sich jene Pflanzen beispielsweise in farbliche Nuancen, nach Gewicht usw. einteilen – immer wieder voraus-gesetzt jedoch, dass die zu-ordnenden Gegenstände die Größe der jeweils ordnenden Bestimmung an sich bereits haben unab-hängig jener Bestimmungsgröße also. Ein ordnender Mechanis-mus hat, grundsätzlich keinerlei charakterliche Verfügungsge-walt über den zu ordnenden Gegenstand, während bei Kant das Zu-Ordnende überhaupt erst durch den Akt der subjektiven Ordnung Charakter erhält, was prinzipiell ganz einfach völlig unlogisch und daher theoretisch völlig unmöglich ist.
D. h. inhaltliche Einflussnahme und Herstellung einer Ordnung sind zwei entgegengesetzte Dinge die sich gegenseitig aus-schließen und sich daher nicht in einer einzigen Aktion vereinen lassen. Inhaltliche Einflussnahme ist eine Erzeugung und keine Herstellung einer Ordnung. Einflussnahme (bzw. Erzeugung) ist eine dynamische, sich mehr oder weniger ständig verändernde Aktion, während Ordnung eher das krasse Gegenteil verlangt. Kants diesbezügliche Vereinigung von Erzeugung und Ordnung ist eine ganz eklatante logische Verirrung. Man kann nicht ordnen indem man etwas erzeugt (zufällige Überschneidungen mögen freilich existieren); man kann nicht erzeugen indem man etwas ordnet. Dynamik, stetige Veränderung und Entwicklung sind nur möglich jenseits strikter Ordnung, Ordnung wiederum ist nur möglich, wenn im Gegenzug Dynamik, Veränderung und Entwicklung entsprechend zurückweichen.
Ordnung bezieht sich auf das relativ Äußere, Erzeugung und Einflussnahme auf das Innere. Ordnung verändert die Umwelt, aber nicht das Wesen eines zu ordnenden Gegenstandes an sich. Erzeugung bezieht sich hingegen direkt auf die innere Struktur eines bestimmten Gegenstandes. Zufall ist nicht zu ordnen, es sei denn er enthält an sich Kriterien die jener Ordnung entsprechen – aber dann handelt es sich ja nicht wirklich um Zufall im absoluten Sinne – im Sinne Kants!
Mit der rechten Synthesis sieht das bei Kant aber gleich anders aus:
“Und so ist die Möglichkeit kontinuierlicher Größen, ja so gar der Größen überhaupt, weil die Begriffe davon insgesamt synthetisch sind, niemals aus den Begriffen selbst, [!] sondern aus ihnen, als formalen Bedingungen der Bestimmung der Gegenstände in der Erfahrung überhaupt allererst klar; und wo sollte man auch Gegenstände suchen wollen, die den Begriffen korrespondierten, wäre es nicht in der Erfahrung, durch die uns allein Gegenstände gegeben werden? [...]
In dem bloßen Begriffe eines Dinges kann gar kein Charakter seines Daseins angetroffen werden. [!] Denn ob derselbe gleich noch so vollständig sei, daß nicht das mindeste ermangele, um ein Ding mit allen seinen inneren Bestimmungen zu denken, so hat das Dasein mit allem diesem doch gar nichts zu tun, sondern nur mit der Frage: ob ein solches Ding uns gegeben sei, so, daß die Wahrnehmung desselben vor dem Begriffe allenfalls vorhergehen könne. Denn, daß der Begriff vor der Wahrnehmung vorhergeht, bedeutet dessen bloße Möglichkeit; die Wahrnehmung aber, die den Stoff zum Begriff hergibt, ist der einzige Charakter der Wirklichkeit.“ (KrV A224-5/B271-3)
Besonders zwischen KrV A138/B177 und A234/B287, unter: DER TRANS-ZENDENTALEN ANALYTIK ZWEITES BUCH, zeigt Kant immer und immer wieder, dass er ständig zwischen Allmacht und Ohnmacht des Verstandes einerseits, und dem Stoff durch die Wahrnehmung als “der einzige Charakter der Wirklichkeit“ und der grundsätzlichen Zufälligkeit des Empirischen andererseits hin und her wankt.
Die Kategorien bieten im Grunde alles: potentielle Fülle, strenge Allgemeinheit, strenge Notwendigkeit, ... – auf sich selbst gestellt jedoch sind sie nichts! – Warum? Ganz einfach, weil der Schritt vom bloßen Ganzen zum Einzelnen nicht zu rechtfertigen ist.
Und jenen Schritt will Kant offenbar mit Hilfe des Äußeren, der Af-fektion über die Dinge an sich selbst und damit über die Anschauung und die Sinnlichkeit ermöglichen. Das Problem dabei ist, dass der Stoff der Sinnlichkeit über die Affektion, bei Kant, nicht der Dimension und nicht der Logik des Verstandes entspricht, der Verstand allein jedoch ohne jegliche Führung in sich völlig gefangen bleibt. “Ich sage dir schon wie du fahren sollst – steig nur ein und fahr los!“, lässt Kant gewissermaßen der Affektion durch den Verstand ermutigend mittei-len. Wenn jedoch der Verstand dergestalt diktiert, so wäre er der ei-gentliche Führer. Ist es zulässig aufgrund zufälliger Fakten logisch zu befehlen – ist es zulässig ein unlogisches Medium als steuerndes Element in ein logisches System zu integrieren? Können apriorische Bedin-gungen der Erfahrung Zufall in Geist umformen? Ist es überhaupt zulässig undifferenzierten unbestimmten rohen Stoff mittels subjek-tiver Gesetze/Regeln zu bestimmen und zu unterscheiden (→ S. 160)?
16 Träume (1)
Die Realität kann kein Traum sein – kein “brain in a jar“ – keine elektronisch oder sonst irgendwie künstlich erzeugte Animation. Künstlich ließen sich allenfalls verhältnismäßig isolierte Einzelheiten repräsentieren, nicht jedoch ganze, in sich geschlossene logische Systeme. Denn ganze, in sich geschlossene, relativ komplexe Systeme, insbesondere das in sich geschlossene System der Realität, können letztlich nur arbeiten, wenn sie tatsächlich existieren.
Unser Leben kann keine Art erträumter Fiktion sein, denn reale Umstände sind grundsätzlich erforderlich um unsere verschiedenen Gefühle, Gedanken und Sinneseindrücke miteinander zu koordinieren. In Träumen, beispielsweise, sieht man oder fühlt man oder schmeckt man. Im realen Alltag hingegen sieht man und fühlt man und schmeckt man. Räumliches Sehen hat im Traum ohnehin seine Tücken: → ab S. 173.
Im Traum fällt man, ohne dass es weh tut, man ißt, ohne dass es schmeckt usw. weil ohne direkten realen Bezug die Koordination der Empfindungen nicht funktioniert. Sie kann letztlich nur unter real gegebenen Umständen tatsächlich umfassend funktionieren, denn man kann nicht Schöpfer seiner eigenen Phantasie sein und gleichzeitig unvoreingenommene, unvorbereitete Naivität vorgeben.
Ein Schöpfer empfindet auch wie ein Schöpfer, das heißt er versteht sein Werk, was entsprechende Gefühle überflüssig macht bzw. vereitelt (→ S. 52, 294-6). Der bloße Fakt, dass wir fühlende Lebewesen sind be-dingt eine von uns unabhängige Realität. Vielleicht darf man behaupten:
Gott braucht die Welt um sein Wissen zu fühlen. Die Welt braucht Gott um ihre Gefühle zu wissen.
Rein praktisch ist es unmöglich, dass ein künstlich erzeugter Aspekt innerhalb eines bestimmten dynamischen Vorgangs in jeder Beziehung die gleiche Wirkung hat wie ein realer, es sei denn der künstlich erzeugte Aspekt gleicht in absolut jeder nur denkbaren Beziehung exakt dem realen Original – was letztlich nur im realen Normalfall (naiver Realismus) möglich ist.
Das exklusive Problem jeglicher Animation ist zudem, dass jedes für sich betrachtete Detail einer solchen virtuellen Darstellung einer zusätzlichen Animation bedarf um nicht als irreal und künstlich aufzufallen, was letztlich in einen unendlichen Regress münden würde. Eine perfekte virtuelle Realität (Hologramm, Computer-Animation, usw.) ist also prinzipiell unmöglich. Das oben erwähnte, extrem skepti-sche Gedankenexperiment “brain in a jar“, beschrieben beispielsweise in Nigel Warburtons Philosophy: The Basics, (Routledge, third edition, 1999, Seite 98) ist eine nicht zu Ende gedachte, leere Drohung.
17. “Stetige“ Lügen sind letztlich Wahrheiten
[Dieses Kapitel, wie eigentlich auch Kapitel 11, stammt aus einer Vorversion dieses Werkes und ist, zumindest S. 171-2 betr. nicht mehr ganz aktuell zu unserer gegenwärtigen erkenntnistheoretischen Entwicklung und zielt ohnehin eher auf “Fernsehen“ und psychologische Aspekte des Gesamtwerkes.]
Doch nehmen wir einmal an, dass Kant in unserer aktuellen Thema-tik prinzipiell Recht hätte, dass also unsere subjektiven apriorischen Gegebenheiten uns definitiv von der realen Welt trennen würden – wir quasi ständig mehr oder weniger belogen werden über den wahren Zustand der Welt. Diese Lüge müsste sich jedoch ständig selbst belügen, bzw. sich ständig neu formulieren und neu orientieren. Denn wer systematisch, d. h. stetig und beständig in immer derselben Art und Weise und bei jedem noch so winzigen Detail lügt, sagt letztlich insgesamt trotzdem die Wahrheit – die komplette Wahrheit!
Wenn ich z. B. zu Emil sage, dass es 12 Uhr sei, obwohl ich weiß, dass es tatsächlich erst 11 ist, so habe ich gelogen. Wenn ich Emil nun immer wieder jeden Tag auf diese bestimmte Weise belüge, so würde er dennoch sehr bald ungeachtet meiner beständigen Fehlinformation die Wahrheit herausfinden, – nämlich dass es 11 Uhr ist, wenn immer ich sage, dass es 12 Uhr sei. Damit würde Emil letztlich mehr oder weniger zwangsweise die Lüge als Wahrheit verstehen, was ich nur dadurch verhindern könnte, wenn ich denn so wollte, dass ich a) in diesem Kontext nicht mehr lügen würde oder b) dass ich meine Lügen von Fall zu Fall abändern würde.
Eine Uhr die immer gleichförmig falsch geht, egal wie falsch, geht letztlich immer richtig, da sie in der Regel von jedem der sie mehr oder wenige regelmäßig beachtet notwendigerweise richtig interpretiert wird.
Auf Kant übertragen bleibt der tatsächliche oder scheinbare Lügenmechanismus jedoch generell immer der gleiche. Die a priori vorgegebenen Kategorien ändern sich nicht, was ultimativ gemäß unserem soeben vorgestellten Prinzip die scheinbaren Lügen ge-zwungenermaßen in Wahrheiten zurückversetzen muss.
Nun ist Kants relevantes System voller Details die wir hier unmög-lich im Einzelnen angehen können. Es ist auch nicht nötig, denn mit keinem nachfolgenden Detail kann er seine vorgegebene, kategorisch falsche Grundhaltung im Ganzen wieder richten – was auch keines-wegs von Kant selbst angestrebt wird, da, falls nicht generell, zumin-dest in diesem Zusammenhang, er sich in päpstlicher Unfehlbarkeit wägt und Zweifel relativ dogmatisch ganz einfach nicht duldet, oder sie z. B. mit seinen sogenannten Antimonien zu erklären versucht.
Allgemein sind jedoch Ergebnisse letztlich nicht unbedingt abhängig von ihren einzelnen Komponenten, denn einzelne Komponenten sind austauschbar, ohne dass sich dadurch das Ergebnis zwangsweise ändern müsste. Es spielt zum Ergebnis absolut keine Rolle ob man beispielsweise die Zahlen 3 und 4, oder 2 und 5, oder 1 und 6 addiert, – das Resultat: 7 bleibt von diesen Details völlig unberührt. Das Resultat auf das wir hier anspielen, die Realitätsempfindung, steht bereits bevor sie über ein bestimmtes Bewusstsein realisiert wird als potentielles Ergebnis eindeutig und absolut fest. Das Bedingte ist der Zweck der Bedingung – das schließt im erkenntnistheoretischen Zsh. Selbstzweck des Letzteren aus und also auch jeden Einfluss der Bedingung zum Bedingten (→ S. 132, 181).
Bedingungen sind Diener des Bedingten und nicht dessen Herren.
Das heißt, die Mittel zur Realitätsempfindung sind, entgegen Kant, prinzipiell beliebig, wenn sie auch im Falle Mensch – Kant hat in diesem speziellen Punkt wohl Recht – an ganz bestimmte subjektive Gegebenheiten gebunden zu sein scheinen. Individuelle Umstände bedingen selbstverstädlich individuelle Gegebenheiten – dadurch ändert sich jedoch nicht die Zielsetzung noch das anvisierte Ziel.
Die Realität ist wie die Pfosten und der Querbalken eines Tores. Wer mit dem Ball immer nur die Pfosten trifft macht nie ein Tor. Wer sich im Leben zu sehr an einzelne Ideale knechtet verspielt erheblich an Potential. Die reale Welt ist im Grunde so wie wir sie sinnlich erfassen und dennoch findet das geistige Leben nicht wirklich “in“ der Welt, sondern eher “zwischen“ den Idealen dieser Welt statt (→ Seite 313 [199], unten, ferner S. 283 [nur im Original]). Gefühle entstehen nicht wirklich aufgrund der Ideale, eher aufgrund der Differenz verschiedener Ideale, kombiniert mit einer bestimmten subjektiven Absicht – so einfach ist das!
Wäre dies insgesamt allgemein nicht so, so müssten wir beispiels-weise eine gleichmäßig einfarbige Wand oder ein helles unbedrucktes Blatt Papier punktförmig getüpfelt sehen entsprechend der punktför-migen nicht völlig flächendeckenden Signalaufnahme der Augen (bedingt durch die nicht völlig flächendeckende und grundsätzlich relativ uneinheitliche flächenmäßige Verteilung der lichtempfindlichen Sinneszellen) mit einer undefinierbaren Lücke an Stelle des soge-nannten Blinden Flecks (die Stelle auf der Netzhaut des Auges, wo die Augennervenbahnen gebündelt das Auge verlassen und wo demzufolge keine lichtempfindlichen Sinneszellen sind und wir daher exakt an jener Stelle theoretisch nichts sehen dürften).
Selbst bei einer auf die gesamte Fläche der Netzhaut völlig einheitlichen Verteilung der Sinneszellen, sollten sich, rein optisch gesehen, einige gravierende Uneinheitlichkeiten ergeben, bedingt durch die den Sehzellen vorgelagerten Blutgefäße. Zudem ist es rein technisch unwahrscheinlich, dass eine solche Vielzahl von Zellen allesamt gleichförmig arbeitet. Die eine oder andere sollte schon mal einen mehr oder weniger dummen Tick haben, was sich in der nachfolgenden bildlichen Repräsentation bemerkbar machen müsste, käme es bei der Sinnesinterpretation insgesamt darauf an, die Außenwelt 1:1 innerlich zu kopieren.
Die Außenwelt existiert so wie sie uns erscheint, dennoch hat sie, wie alle realen oder abstrakten Ideale, keinen Selbstzweck.
Eine bloße Kopie des realen Äußeren ins subjektive Innere hätte kaum Bedeutung, ebenso wäre die rein innere Präsenz des Idealen bedeu-tungslos, da sich daraus keine emotional verwertbaren Veränderungen ergeben, bzw. weil für das fühlende Ich im totalen Ideal kein Platz ist.
Das Auge wird oft mit einer modernen Kamera verglichen. Der Vergleich hinkt jedoch grundsätzlich. Eine Kamera mit unzähligen vor der Linse (bzw. vor dem Film) kreuz und quer verlaufender Stromkabeln (oder Nervenzellen und Nervenbahnen) und Löchern im Film kann unmöglich ein scharfes einheitliches Bild liefern. Ein übliches Kamerabild ist über die ganze Fläche qualitativ relativ gleichwertig, während das bewusste Sehen über unsere Augen vorwiegend auf einen ganz bestimmten, verhältnismäßig winzigen Punkt fixiert ist, auf die sogenannte Fovea (wenn auch der Gesichtseindruck insgesamt allgemein als einheitlich und gleichwertig empfunden wird).
Dieser relativ einheitliche geschlossene Gesichtseindruck über die Augen ist jedoch rein körperlich als solcher absolut nicht gegeben. Bewusstes Sehen orientiert sich unzweifelhaft anhand der Augen, so wie ein Autofahrer sich an den Verkehrsschildern orientiert. Straßen-verkehrsschilder sind hingegen keine Abbilder des Straßenverkehrs, ebenso stimmt der rein körperliche Sinneseindruck über die Augen keineswegs mit der bewusst wahrgenommenen Empfindung eins zu eins völlig überein. Vielmehr überlagert der Zweck stets die Mittel zum Zweck.
Die Mittel zur Empfindung sind stets mehr oder weniger beschränkt was – wie kann man es spontan anders sehen – ein klares, allgemeines Handikap zu sein scheint.
Aber! Information mag an sich stets war sein, deshalb ist sie jedoch nicht unbedingt geistreich, im Gegenteil. Denn mit Geist verbindet sich notwendigerweise Anreiz bzw. gewisse Absicht. Diese Absicht ist erst aus einer relativ subjektiven Sicht gegeben, während Objektivität (allgemein) grundsätzlich neutral ist, und damit an sich keinen Anreiz hat Information in der einen oder anderen Art zu (be)fördern.
Alle Lebewesen bedürfen der verschiedensten Informationen, allerdings ist eine perfekte und lückenlose Informationsaufnahme, abgesehen davon, dass sie praktisch nicht möglich ist, überhaupt nicht wünschenswert. Denn Information ist an sich neutral und harmoniert somit grundsätzlich relativ schlecht mit dem persönlichen Interesse eines Individuums, welches naturgegeben definitiv nicht neutral ist – wer diesen speziellen Gedankengang im Ganzen eher schlecht als recht nachvollziehen kann, möge sich noch etwas gedulden. Vermutlich wird sich dieses Rätsel, das wir uns hier scheinbar unnötigerweise einge-fangen haben, im Verlauf unserer weiteren Diskussion noch etwas lichten [zumindest im Original – allein mit Kant wird das schon schwieriger].
Aus mehr oder weniger rein technischen Gründen können wir mit den Augen lediglich sehen. Prinzipiell sollte es jedoch möglich sein auch mit den Augen zu hören oder mit den Ohren zu sehen. (Allerdings ist Hören physiologisch und psychologisch ein sehr verschiedener Vorgang zum Sehen mit sehr verschiedener Zielsetzung – beide Vorgänge lassen sich kaum direkt miteinander vergleichen – Hören hat vor allem eine sehr deutliche zeitliche Komponente, Sehen weit geringer, falls überhaupt. Letzteres ist wahrscheinlich dafür verant-wortlich, dass Gefühle sich eher über das Ohr als über die Augen vermitteln. Die Augen dienen vornehmlich der körperlichen Erhaltung und Sicherheit, die Ohren eher der seelischen. Das erklärt mir persönlich zumindest den Fakt, dass ich gute Hörspiele generell befriedigender finde als “gute“ Fernsehfilme (dazu → S. 126-7).)
Die Signale werden also sinngemäß genutzt, es entsteht ein Bild in der Vorstellung welches nicht in jeder Einzelheit dem entspricht, was rein optisch gesehen wird. Stattdessen wird anhand der Sinnesdaten blitzschnell bzw. zum Teil wohl im Voraus errechnet, was sich in unserer unmittelbaren Umwelt wahrscheinlich abspielt, mit sehr deutlicher Hervorhebung persönlich interessanter Aspekte.
Dieses Hervorheben oder diese ganze subjektive Art der Sinnesinterpretation ist jedoch an und für sich keine Beeinflussung, Verfälschung oder Erzeugung von Informationsinhalten. Sie dient, wie zuvor bereits angedeutet, nicht dazu, das Reale (der materiellen Welt) und Ideale (in platonischer Manier) zu kopieren, sondern quasi dessen Aufspaltung vorzubereiten, damit sich das Reale und Ideale mit dem persönlichen Ich zu einer individuellen Bedeutung vereinigen kann.
18 Träume (2)
Die Phantasie hat der Realität voraus, dass in ihr alles Neben-sächliche, alles Neutrale, Unpersönliche verschwindet. Deshalb ist in der Phantasie alles intensiver, emotionaler als in der Sinnes-Realität. Märchen, Fiktionen, Romane – all das ist im Grunde oft wesentlich interessanter als vergleichbare reale Erlebnisse. Je realer ein Ereignis ist, umso mehr nimmt sein Gehalt an nichtssagender, objektiver Neutralität zu.
Im Traum ist alles fokussiert, d. h. im Traum und in der Phantasie sind die Informationslücken auf ein Maximum gedehnt, wahrscheinlich um möglichst viel gefühlsbetontes “Ich“ in jene Lücken einzulassen – was insgesamt so etwas wie einen höchstmöglichen persönlichen Sinn ergeben mag.
Im Realzustand – sehend, hörend, tastend – sind hingegen Informationslücken auf ein Minimum reduziert, Gefühle treten vor unmittelbarem, praktisch-rationalem Bedarf zurück, die Welt wird allgemeingültig, objektiv, neutral, perfekt aber damit (auf emotionaler psychologischer Ebene) kaum gehaltvoller, oftmals eher leer inhaltslos und gegebenenfalls ohne jede Motivation.
Bewusstsein ist ein Kompromiss zwischen nichtssagender Fülle, nichtssagender Leere, nichtssagendem “bloßen Ich“ und ebenso bedeutungslosem bloßen “Alle“, “Allem“, “Alles“.
In der Realität bewegen wir uns nahe der nichtssagenden Fülle, im Traum nahe der nichtssagenden Leere – der wesentli-che Unterschied dabei: im Traum hat das Einzelne seine höchst-mögliche persönliche Bedeutung bei geringstem allgemeinen Bezug, in der Realität seine geringstmögliche persönliche Bedeutung bei maximalem allgemeinen Bezug.
Im Traum ist alles auf das Wesentliche reduziert, dadurch geht jeder Maßstab verloren. Im Traum kann man nichts messen, nichts fest bestimmen, da neben dem Wesentlichen nicht das Unwesentliche, Neutrale besteht, an dem man es messen könnte. Aus bloß subjektiver Bestimmung ergibt sich keine objektive Realität.
Die Welt kann nicht lediglich in unserem Kopf existieren, andernfalls wäre sie gleichzeitig und in jeder Einzelheit ihrer gesamten Fülle fokussiert – man wäre gezwungen die gesamte Vielfalt der Welt in einem einzigen Augenblick zu erleben. Die Möglichkeit, dass wir eins nach dem anderen erleben bedingt eine objektive, vom Subjekt unabhängige Realität.
Selbst im Traum wirkt die Realität, in dem sie uns erlaubt, Aufeinanderfolgendes zu erleben. Alles, was wir träumen hat Intentionalität, hat eine persönliche Note, die uns über die reale, persönliche Existenz gegeben ist.
Und doch können wir im Schlaf nicht im Mindesten unter-scheiden zwischen realen Erlebnissen, bloßen inneren Vorstel-lungen und krasser Fiktion – aber diese Spezialität wird erst im Laufe des nächsten Kapitels ein echtes Thema für uns.
Bewusstsein bedingt die Möglichkeit der subjektiven Fokussie-rung, die wiederum eine objektive, allgemeine, unabhängige Realität bedingt, da andernfalls alles im Bereich des Allgemei-nen, Objektiven verweilt. Wäre die Welt lediglich in unserem Kopf, so wäre alles objektiv, neutral, kalt – wir könnten sie sodann in keiner Weise emotional subjektiv erleben.
Ein Sinnesobjekt ist relativ scharf, nicht durch die eigene Prä-zision, sondern durch die Gesamtheit aller Nebensächlichkeiten, die es eingrenzen. Jedes innere Objekt, sei es durch Traum oder durch Erinnerung oder durch das bewusste Vorstellungsvermö-gen – d. h. ohne äußeren Bezug auf ein reales Objekt – fehlt diese Präzision. Einen Traum kann man, wie gesagt, nicht vermessen, noch kann man überhaupt irgendetwas in der bloßen Vorstellung exakt bestimmen. Daraus ergibt sich eine paradoxe Konstellation: Im Traum ist alles bestimmt, wichtig, fokussiert – gerade deshalb fehlt jedem Traum-Objekt die wohldefinierte Präzision üblicher, äußerer Sinnes-Objekte, deren Präzision wir über ein geschlossenes Band unzähliger Nebensächlichkeiten teuer erkaufen. Denn alle Nebensächlichkeiten rauben dem sol-chermaßen präzisierten Objekt einen erheblichen Teil unserer Aufmerksamkeit. Bei absoluter Schärfe ist diese Aufmerksam-keit gleich Null. (Ab einem gewissen Grad gilt:) Je genauer wir etwas optisch wahrnehmen, umso geringer wird unser Gefühl für das, was wir wahrnehmen.
Das hat nichts mit Schrödingers Katze oder Heisenbergs Unschärferelation zu schaffen, auch nichts mit Descartes klaren und scharfen Ideen [-voreilige Bemerkung! Vorsicht zu Descartes!], auch Locke, Hume oder Kant helfen uns da nicht weiter, weil sie alle keinen prinzipiellen Unterschied zwischen der Traumwelt bzw. der bloßen inneren Vorstellung und der Vorstellung mittels direkter Sinnesinformation erkennen lassen und somit nicht akzeptieren würden, dass alle direkten Sinnesgegenstände der Erfahrung eine ganz andere Qualität haben als solche der Erinnerung, des Traumes oder bei vollem Bewusstsein erdachter, innerlich konstruierter Ideen-Kombinationen.
Der vermeintlich unbedeutende Fakt, dass wir über äußere Empfindungen unzählige Signale empfangen, aus deren Fülle wir uns lediglich einer sehr beschränkten Anzahl wirklich be-wusst werden, beweist, dass hier eine äußere Realität wirkt. Denn unser inneres Auge unterscheidet nicht zwischen Neben-, und Hauptsächlichem – es gibt auf jener Ebene nur Hauptsa-chen und keine Nebenschauplätze. Man kann relativ unbeteiligt sich einen Fernsehfilm anschauen, sich mit dem Bus durch die Gegend spazieren fahren lassen (...) und alles Mögliche dabei optisch sehen ohne das Gesehene inhaltlich wirklich zu erfassen – ohne mit dem Gefühl bei der Sache zu sein.
Das ist im Traum nicht möglich. Denn ein Traum hat vor allem Qualität, ein Sinneserlebnis hat hingegen eher Quantität. Quantität geht in dieser Frage grundsätzlich auf Kosten der Qualität und umgekehrt.
Berkeley, der in unserem gegenwärtigen Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist, hat eine etwas schräge Haltung zur Realität. Einerseits bezweifelt er nicht die reale Welt, und doch existiert Letztere für ihn nur innerlich – also doch nicht richtig real im naiven Sinne. Reale Dinge sind für Berkeley nichts jenseits der Vorstellung. Damit fällt er aber hoffnungslos tief in die Grube, die er und mit ihm seine Vorgänger über ganze phi-losophische Epochen hinweg mit irriger Begeisterung ausgeho-ben haben: er setzt Vorstellungen mit direkter Sinnesbeteiligung willkürlich gleich zu rein inneren Vorstellungen des Intellekts, der Phantasie bzw. des Traumes – ein fataler Fehler! – soviel sei hier bereits zum folgenden Kapitel einleitend verraten.
19 Idealismus
Gelegentlich (wie soeben) haben wir den Idealismus erwähnt und ihn teils so dargestellt, als ob aus dessen Sicht quasi nur Innenleben existiert und keine äußere Realität. Es ist an der Zeit, dass wir nun ein wenig deutlicher unterscheiden.
Klassischer Idealismus, insbesondere denke man da an den englisch-irischen Philosophen Berkeley, sagt eigentlich nicht unbedingt, dass es keine äußere Welt gibt – so wird er gerne interpretiert bzw. so überdeutet er sich selbst. Im Kern aber beschränkt sich die wesentliche Aussage des Idealismus darauf, zu behaupten, dass eine äußere Realität nicht nachweisbar ist – nicht mehr und nicht weniger! Sie ist möglich, ja wahrschein-lich, und der Alltag liefert unzählige praktische Argumente ihre Existenz schlicht hinzunehmen. Und doch – all dies enthält mit strenger philosophischer Kritik keinen Beweis.
“[...] the supposition of external bodies is not necessary for the producing our ideas [...]“, sagt Berkeley (siehe entsprechen-des Zitat in ausfürlicherer Form S. 23-4).
Sicher, der bloße Fakt, dass wir uns in der Phantasie Gegenstände innerlich vorstellen können, ohne dass sie uns äußerlich gegeben sind, spricht zunächst eindeutig für Berkeley – die Traumwelt kommt offenbar völlig ohne die Realität aus!
Nun, das mag so sein, und doch, aus dem soeben kurz vorgestelltem Sachverhalt die äußere Realität anzuzweifeln, ist ein gewagter Schritt, eine möglicherweise übermütige, voreilige falsche Folgerung, die des Weiteren den Schluss nahe legt, dass wir eigentlich auf unsere Sinnesorgane verzichten könnten.
Die bloße Existenz jener Organe spricht aber entschieden gegen Berkeley. Berkeley würde hingegen hier erneut kontern mit der Behauptung, dass unsere Vorstellung, wir hätten solche Organe, nicht beweist, dass wir sie tatsächlich haben. Mit empirischen Fakten ist Berkeley offenbar nicht beizukommen, er wird uns auf diese Art immer zurückschlagen! – Immer?
Wir könnten ihn aber doch höflichst fragen, ob die Tatsache, dass die äußere Welt nicht direkt beweisbar ist, den Beweis enthält, dass wir Vorstellungen gänzlich ohne jegliches Äußere haben können?
Konkret: Ein Mensch von Geburt völlig ohne Sinnesorgane – könnte er theoretisch Phantasie entwickeln wie übliche Sterbli-che? – könnte er Vorstellungen von Stühlen, Häusern, Menschen, Tieren, Katzen, Hasen, Raben ... entwickeln so wie wir? Sind Vorstellungen grundsätzlich unabhängig von äußerer Realität?
Spätestens hier gerät Berkeley ins Schleudern. Es zu vernei-nen käme ihm generell sehr ungelegen, würde er es aber beja-hen, so müsste er praktisch unterstellen, dass das Individuelle einer bestimmten Vorstellung sich direkt aus jeweiliger potentieller Fülle aller möglichen Vorstellungen ergibt.
Indes, das Ganze an sich enthält keine Aussage, kein Indiz, nicht die leiseste Spur eines Hinweises über das Einzelne – nicht einmal die Möglichkeit des Letzteren. Um das Einzelne vom Ganzen ableiten zu können, muss man bereits gewisse Kriterien, Hinweise über das Einzelnen kennen. Dieses Wissen ist a priori aus bloßer Fülle nicht möglich (– sonderbar, dass gerade ein Empirist der Marke B. das übersieht). Ein Mensch kann noch so intelligent sein, ohne die Erfahrung, des Einzelnen, wird er aus Sicht des Ganzen nie auch nur den aller simpelsten Gegenstand konstruieren können. Der vermeintlich einfache Schritt vom Ganzen zum Individuellen ist kategorisch, so, dass er rein logisch prinzipiell nicht zu bewerkstelligen ist. Rationalisten überschätzen durchweg die Power des Verstandes, sie unterschätzen hingegen, dass alle Rationalisten Erfahrung haben. Ohne Erfahrung kommt menschlicher Geist nicht in Schwung, schlimmer noch, er kommt erst gar nicht zustande.
Die Anwendung der Fülle bedingt Bezug jenseits jener Fülle. Mathematik, das Alphabet, Notensystem ... an sich, erlauben keine individuelle Anwendung ohne äußeren Bezug. Allein, die soeben erwähnten Systeme sind in ihrem theoretischen Aufbau bereits mit einzelnen Elementen angehäuft, die sich im Grunde nur aus der Erfahrung ergeben. Alle rationalen Systeme enthal-ten bereits Elemente der Erfahrung. Aus dem Bereich bloßer Möglichkeit ergibt sich kein logisches System und folglich erst recht keine praktische oder theoretische Anwendung jener unmöglichen Systeme. Das Einzelne ist im Grunde empirisch, das Ganze apriorisch. Alle menschlichen “Erfindungen“ bedingen, dass das Wesen des Einzelnen bereits erfahren wurde.
Wer hingegen meint, dass das Individuelle aus bloßer Fülle ableitbar ist, unterstellt damit unwillkürlich, dass im Prinzip eine Kamera an sich bereits Bilder machen könnte, ohne also, dass äußere Objekte, oder überhaupt “Äußeres“, dazu notwendig wäre(n).
Hier wird sicher der eine oder andere einwenden, dass moderne Computer längst in der Lage sind von sich aus Bilder zu erfinden. Indes, ein Computer erfindet nicht im strengen Sinne, er setzt lediglich eine Art verschlüsselter Information um in eine andere, und bedingt zudem, dass ihm anhand entsprechender Software im Grunde jedes einzelne bit-zchen haarklein vorgekaut wird – das ist kurzgefasst die ganze Kunst des Computers. Ein Computer kann nur erfinden was in der eingegebenen Information offen oder verdeckt schon enthalten ist. Computer ersparen uns Zeit und sehr viel Arbeit, rein geistig aber sind sie mausetot, sie erzeugen keine wirklichen Ideen und können, nur auf sich selbst gestellt, daher auch keine Bilder malen. Und das kann, wie gesagt, auch keine ideale, hypermoderne Kamera von über-über-morgen.
Ein Gedankenexperiment: Man stelle sich einen voll entwickelten Menschen vor, der in allem einem gesunden normalen Menschen gleich kommt – nur, er hat keine Sinnesorgane und somit keine äußere Information und keine Erinnerungen zur Verfügung auf die er eventuell zurückgreifen könnte. Er hat gemäß unserer Vorbedingungen nur eines: volle Potentialität (insbesondere zur Erfahrung). Er hat vor seinem inneren Auge sozusagen potentiell alles bereits vorliegen. Um etwa ein Bild zu malen oder sich einen bestimmten Gegenstand innerlich vorzustellen braucht er im Grunde lediglich zu radieren, was des Guten zu viel ist oder er nimmt schlicht eine innere Schere zur Hand (oder zum Kopf) und schneidet möglichst sauber den bestimmten einzelnen Gegenstand seiner Wahl aus der gesamten Fülle aller möglichen Vorstellungen heraus – so einfach ist das!
Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Es ist schwierig – schlimmer als das: es ist letztlich unmöglich! Denn er hat, so wie die Sache liegt, absolut keinen einzigen Anhaltspunkt aus der Fülle des unendlichen Ganzen auch nur irgendetwas Bestimmtes auszuwählen.
Vergleichbares, wenn auch weniger extrem, bietet uns der Alltag: Ein großes Warenhaus kann z. B. sehr interessant sein, es kann aber auch sehr frustrieren. Denn je größer die Menge der Teile die man kaufen könnte, umso schwieriger wird in der Regel die Wahl zu der Ware, die man schließlich tatsächlich kauft. Nun sind auch sehr große Warenhäuser, gerade in unserem aktuellen Zsh. immer noch äußerst beschränkt im direkten Vergleich zur Fülle aller möglichen Vorstellungen aus unserem vorhergehenden Beispiel. Zudem haben wir im Alltagsleben vorneweg gewisse Kriterien, die uns die Erfahrung liefert(e), anhand deren wir uns entscheiden können.
Wie aber sollten wir unsere Wahl treffen, wären wir vor einem unendlich großen Haufen bestimmter Ware – zudem ohne jedes Indiz der Erfahrung und also ohne irgendwelchen Anhaltspunkt das eine dem anderen vorzuziehen, wenn zusätzlich rein willkürlich-wahlloses zufälliges Grabschen nicht erlaubt wäre (weil unlogisch)?
Es ist aber nicht wirklich die Menge die in diesem Zusammenhang den entscheidenden Ausschlag gibt, sondern der Umstand, dass aus Sicht des Ganzen die Konturen des Einzelnen, ohne dass Letzteres bereits erfahren wurde, nicht abzuschätzen sind. Ohne Hinweise der äußeren Welt – selbst wenn sie lediglich indirekt mittels eines (äußeren!) Filmes eingespielt sein sollten – fehlt der Phantasie jegliche Möglichkeit sich zu entfalten, bzw. Differenzen aufzubauen.
Wir können uns Fabelwesen, die real nicht existieren, wie etwa ein Einhorn oder einen fliegenden Bären vorstellen, was uns dazu verleitet anzunehmen, dass wir im Grunde alles erfinden könnten unabhängig davon ob wir es ganz oder teilweise bereits irgendwo, irgendwie erfahren hätten oder nicht. Aber diese Annahme ist falsch. Können wir uns das Unendliche, einen nicht materiellen Gegenstand, eine Welt ohne Zeit, ohne Raum, ohne jeglichen Kontrast oder generell unlogische Dinge, wie eine runde Ecke, eine gerade Kurve oder lautes Schweigen ... vorstellen? Wir haben eine unlogische -, oder absolute, kontrastlose Einzelheit nie erfahren, deshalb sind wir prinzipiell nicht in der Lage uns den simpelsten unlogischen Gegenstand oder ein bestimmtes Ideal an sich (ohne jeglichen Kontrast) vorzustellen.
Aus bloßer Anlage – aus bloßer Fülle des Ganzen ergibt sich Alles oder Nichts und nichts dazwischen, denn es fehlt jeder Anreiz bzw. jeglicher Anhaltspunkt zum Dazwischen.
Berkeley leugnet das Dasein der Dinge außerhalb unserer Vorstel-lungen. [Wie S. 176 erwähnt, halten wir dies für eine Überdeutung der eigentlichen Kernaussage des Idealismus.] Nach seiner Lehre gibt es außer der Seele nur Vorstellungen (Ideen), die der Seele von Gott eingeprägt wurden. (Nach: Lexikon, Lingen Verlag, 1976/7, Band 2, S. 102-3)
Damit löst Berkeley nicht das Grund-Problem des Idealismus, son-dern reicht es nur eine Stufe weiter. – Descartes gibt uns einen Tipp:
“Has it never happened to you, as it has to many people, that things seemed clear and certain to you while you were dreaming, but that afterwards you discovered that they were doubtful or false?”
(R. Descartes, Meditations on First Philosophie, 1641 [Original], S. 66, –
siehe dazu auch → KrV A226/B278-9 unter: “Anmerkung 3“)
Bestätigt uns Descartes da nicht in gewisser Weise den eigentlichen Grundgedanken dieses Kapitels?
Im Traum ist alles wahr, wie wir seit dem letzten Kapitel wissen. Im Traum ist es nicht möglich zu wissen dass man nur träumt – wie das?
Nun, ganz einfach, weil uns im Traum die Sinne nicht direkt zur Verfügung stehen (– allenfalls sehr weit im Hintergrund). Der Traum hat Qualität aber kaum Quantität, weil unbegrenzt durch direkte Empfindungen.
Bei vollem Bewusstsein haben wir zweierlei Möglichkeiten der Vorstellungen, zum einen solche mit direkter Sinnesbeteiligung, zum anderen ohne Letztere.
Die Sinne liefern ein relativ geschlossenes Band unendlicher Nebensächlichkeiten (→ S. 173-5) dadurch werden Vorstellungen erst räumlich und also messbar.
Rein inneren Vorstellungen fehlt indes jedes Maß, jede Präzision, weil das geschlossene Band der Nebensächlichkeiten der Sinnenwelt nicht zur Verfügung steht an dem man sie messen könnte – fehlt somit echte Räumlichkeit schlechthin.
Das Gedächtnis mag Bruchstücke jenes “Sinnenbandes“ im Schlaf teilweise ersetzen – es kommt jedoch zur jeweiligen Leistung der sensuellen Organe offenbar bei Weitem nicht mit. Folglich haben wir grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten der Vorstellung – im Sinnenalltag beide, im Schlaf nur eine der beiden.
Beide Arten der Vorstellung sind prinzipiell so verschieden, dass rein von Seiten der einen kein Indiz der Unterscheidung zur anderen besteht (– ebenso wie vom bloßen Ganzen kein Indiz zum Einzelnen existiert). Und da wir, im Gegensatz zum wachen Zustand des vollen Bewusst-seins, im Schlaf nur eine der beiden Arten zur Verfügung haben, können wir im Traum nicht zwischen Realität und Phantasie unterscheiden.
Wären unsere Vorstellungen alle gleich Vorstellungen im Geiste Berkeleys, so hätten wir entsprechend im Wach-Zustand jenem des Traumes nichts voraus. Es wäre sodann prinzipiell unmöglich zwischen Realität, Phantasie und Traum zu unterscheiden, völlig unabhängig vom jeweiligen Bewusstseinsstand – unabhängig u. a. davon, ob wir gerade träumen oder nicht!
Ohnehin besteht rein innerlich keine Möglichkeit der Täuschung, weil in diesem Falle ja keine Übertragung des Äußeren zum Inneren stattfindet (wie bereits S. 22 vermerkt wurde). Ein Idealist, der ganz ins Innere flüchtet um gewissem Irrtum auszuweichen übersieht, dass exakt jener eventuelle Irrtum den Beweis äußerer Realität mit sich führt.
Kant hat im erkenntnistheoretischen Blickfeld zusätzliche Probleme. Nicht nur, dass ihm jedes Indiz fehlt, aus der Fülle seiner allgemeinen Bedingungen zum konkreten Einzelfall des Bedingten herunterzustei-gen – das Bedingte erfüllt bei ihm grundsätzlich nicht die Forderung der jeweiligen Bedingung! Kant verlangt beispielsweise von allen Vorstellungen, dass sie definitiv räumliche und zeitliche Gestalt annehmen. Diese Bedingung können die Vorstellungen aber unmöglich erfüllen, da der zugrunde liegende rohe Stoff, so jedenfalls Kant, an sich jenseits aller Zeit- und Räumlichkeit ist. Die angebliche Zeit- und Raumlosigkeit der äußeren Welt der Dinge an sich selbst disqualifiziert vorneweg alles Äußere zu den Bedingungen von Raum und Zeit.
Eigentlich müsste Kant spätestens an dieser Stelle endgültig kapitu-lieren. Stattdessen aber dreht er den Spieß völlig um, indem er den Mangel schlicht und ergreifend mit der Forderung füllt. Er fordert etwas, das nicht da ist – bekommt es letztlich dann aber doch, und wodurch? – just dadurch, dass er es fordert.
Ist es nicht unverschämt, was Kant verlangt? Er stellt Bedingungen auf, obgleich er vorneweg genau weiß, dass seine Klienten unmöglich jene Bedingungen erfüllen können!
Und schlagartig mutiert Kant zum ultimativen Gönner und moduliert Mangel zum Gewinn, Forderung zur barmherzigen Dienstbarkeit, ob-gleich er aus seiner eigens erwählten rein logischen Stellung (→ u. a. S. 81) wirklich einer der Allerletzten sein dürfte, der sich solch freizügiges Austeilen leisten könnte.
Aber jetzt geht der Tanz erst richtig los. Denn nun muss das Bedingte blind mit etwas fertig werden, wovon es nichts weiß, nichts hat, nichts erkennen und absolut nichts mit anfangen kann: Raum und Zeit. Und wer heizt da zusätzlich ein? Kant! Jetzt verlangt er nicht lediglich, dass die Bedingungen angenommen werden – er fordert zudem, dass seine unwissenden Schüler alles wissen, alles können, alles richtig machen, und gerade in gänzlich fremden Dimensionen mit völlig fremder Materie. Die Belastbarkeit der Phantasie hat Grenzen, und vorsorglich, wie bestellt erklärt Kant da die Vorstellung zur Vorstellung einer Vorstellung (u.a. KrV A68/B93) unter synthetischer Einheit des Mannigfaltigen, des Bewusstseins, des Denkens, des Empirischen ... Also wirklich, besser kann man kaum Haken schlagen!
In Kleindruck werden im folgenden Kapitel zunächst einige Punkte erörtert, deren Wurzel weit zurück in der Entwicklung dieses Werkes stehen und sich im Laufe der Diskussion teils überholt haben – zu verstehen als Einleitung und Kontrast zum Finale, gemischt mit etwas Nostalgie vielleicht. Möge man stilistisch dazu ein Auge zudrücken!
20 Erfahrung ist grundsätzlich unabhängig von der Struktur eines Subjekts
Ähnlich der Interpretation relativ umfangreicher zusammenhängender tech-nisch übermittelter Morse-, Rundfunk-Signale ... ist die Interpretation unserer Sinneseindrücke relativ zu deren objektivem Ursprung an und für sich entweder gänzlich unmöglich oder sie ist relevant, korrekt und in jeder Beziehung kongruent. Alles oder nichts! – das ist hier das Grundprinzip. Wer die Welt empfindet, empfindet sie im Grunde notwendigerweise richtig.
Diese aus allgemein-phil. Sicht phantastisch anmutende Behauptung ist letztlich vielleicht nicht so abwegig, wie sie zunächst erscheinen mag. Jedenfalls lässt sich jeder beliebige, bildliche, reale oder imaginäre Körper vermenschlichen, z. B. mit einem aufgemalten Mund, Nase und Augen, wobei Details zunächst kaum eine Rolle spielen, als vielmehr die Bedeutung jener Details insgesamt – ein Umstand, von dem u. a. Comics-Hersteller ganz erheblich profitieren. Überhaupt erscheinen alle Tiere eigentlich ziemlich menschlich und umgekehrt. Menschen wie (höhere) Tiere haben im Allgemeinen, grundsätzlich kein Problem sich in die Situation anderer tierischer oder – auf beschränktem Niveau selbstverständlich – menschlicher Lebewesen hineinzudenken (und umgekehrt) andernfalls könnten sie alle kaum zueinander angemessen reagieren.
Dies wäre jedoch kaum möglich, würde die individuelle Struktur eines bestimmten Körpers dessen reale imaginäre oder potentiell mögliche, bewusste “Welterkennung“ generell beeinflussen bzw. bestimmen.
Ein herausragendes Merkmal der realen Natur (oder der Phantasie) ist, dass sich alle empfindungsfähigen Lebewesen im Grunde verstehen. Eine melancho-lisch klagende Katze wird nicht nur von ihresgleichen verstanden. Jeder Mensch kann in der Regel sofort das Winseln eines trauernden Hundes richtig interpre-tieren. Hund und Katze verstehen sich untereinander hervorragend, im gewissen Sinne zumindest. Würden sich beide tatsächlich absolut nicht verstehen, so würden sie sich gegenseitig völlig ignorieren, anstatt sich einander mehr oder weniger höflich beachten. Auch strukturell sehr verschiedene Tiere wie Schaf und Wolf oder Katz und Maus wissen in aller Regel sehr genau was sie voneinander zu halten haben. Alle Lebewesen haben ihre ganz individuellen Vorlieben, Abneigungen, Fähigkeiten wie Unfähigkeit und haben eine ganz bestimmte Struktur, die sich wesentlich von Art zu Art, aber auch von Individuum zu Individuum derselben Art, unterscheidet. Dennoch ist Erfahrung grundsätzlich unabhängig von der persönlichen Struktur und der materiellen Beschaffenheit eines bestimmten Lebewesens, wenn auch der Schwerpunkt der Erfahrung insgesamt sich den unmittelbaren natürlichen Gegebenheiten anpasst.
Wäre Erfahrung hingegen generell subjektiv abhängig, so hätten verschiedene Lebewesen nicht einmal im Ansatz die Chance sich untereinander verständlich zu machen, denn Verständigung bedingt absolut ein gutes Maß gleicher Erfahrung.
Alle Lebewesen erleben ihre Welt subjektiv, das heißt mehr oder weniger beschränkt und betont gemäß den eingeschlossenen subjektiven Umständen. Dennoch ist Erfahrung grundsätzlich unabhängig von der Beschaffenheit eines Individuums – Erfahrung ist stets wahr, egal ob man die Welt als Hund, Katze, Mensch, Fliege, Roboter, oder als Hirngespinst erlebt. Individuelle Strukturen und subjektive Gegebenheiten heben aktuelle individuelle Perspektiven deutlich hervor – dadurch beachten wir eine bestimmte Wahrheit aus persönlichen Gründen mehr als eine andere – was im gesellschaftlichen Zusammenspiel auf relativ natürliche Art und Weise gegebenenfalls zu Meinungsverschiedenheiten und handfestem Streit führt. Dadurch ist jedoch der Wahrheitsgehalt einzelner realitätsbezogener Erlebnisse nicht unbedingt gefährdet. Manch ein Tierfreund, vornehmlich Hundehalter, versteht sich beispielsweise weit besser mit seinem Haustier als mit seinem menschlichen Nachbar, obgleich er körperlich jenem Nachbar weit ähnlicher sein dürfte.
Es gibt nur einen Lebensgeist – in diesem Punkt sind sich alle Lebewesen gleich. D. h. die Voraussetzungen für das Bewusstsein der bewusstseinsfähigen Lebewesen sind prinzipiell gleich. Es sollte aus dieser Sicht nicht verwunderlich sein, dass man sich so ziemlich mit jedem (realen oder imaginären) Lebewesen identifizieren kann – selbst mit beliebigen Fabelwesen oder Außerirdischen (von der Venus, dem Beteigeuze oder woher auch immer). Ein Bauer spricht zuweilen mit seinem Vieh wie mit seinen menschlichen Zeitgenossen. Ein Kind mag sich blendend mit seiner Puppe verstehen als sei es die selbstverständ-lichste Sache der Welt. Schumi wäre nicht halb so oft Weltmeister geworden, hätte er sich nicht vor jedem Rennen intensiv mit seinem Ferrari unterhalten (das jedenfalls vermuten wir hier einmal ganz frech).
Für unsere Behauptung, dass die Interpretation von Sinnesempfindung grundsätzlich, entgegen der allgemeinen Auffassung, relativ unabhängig von subjektiven Gegebenheiten ist, existieren einige lebendige Beweise, z. B. der folgende: Unser Sinneseindruck ändert sich prinzipiell nicht wesentlich durch einen Wechsel von Tageslicht- zu Mondlichtbedingungen, (außer dem allgemeinen Unterschied hell/dunkel, natürlich). Dabei arbeitet bei Tageslicht ein völlig anderes System im Auge als bei Mondlicht. Am Tag sind etwa 7 Millionen sogenannter Zapfen als Lichtempfänger aktiv, unter Dämmerlicht hingegen sind etwa 120 Millionen Stäbchen wirksam. Diese Stäbchen unterscheiden sich sehr wesentlich von den erwähnten Zapfen, was uns allgemein jedoch kaum bewusst wird. Wir nehmen in einem solchen Fall eine mehr oder weniger gravierende Veränderung der Lichtstärke war, nicht jedoch einen gravierenden qualitativen Wechsel des gesamten Bildeindrucks an sich.
Wenn ein Wechsel der Arbeitsweise unserer Augen von Zapfen auf Stäbchen – und damit ein erheblicher körperlicher Wechsel der Art unserer Informations-aufnahme, und damit zusätzlich eine Veränderung des subjektiven Interpreta-tionsapparates insgesamt – relativ geringen Einfluss auf die jeweilige subjektive Bildinterpretation hat, so sollte man doch annehmen, dass ein künstlicher -, in nicht allzu ferner Zukunft vielleicht möglicher Wechsel zu technischen Produkten (künstliche Sehzellen, künstliche Augen insgesamt, usw.) grundsätzlich unser bewusstes Sehen ebenfalls nicht wesentlich beeinflussen müsste, wenn überhaupt.
Wir sind wie wir sind, aber auch wenn wir völlig anders wären würden wir die Welt im Grunde nicht anders empfinden wie das zur Zeit unter den allgemein gegebenen Umständen von Fleisch und Blut der Fall ist. Wir könnten alle Brillen tragen die oben mit unten, links mit rechts, vorne mit hinten usw. vertauschten, es würde generell keinen wesentlichen Unterschied machen, zumindest wenn wir diese Brillen relativ frühzeitig (von etwa der Geburt an) tragen würden. Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt würde sich das Bewusstsein teilweise, nach einiger Zeit, an die neue Sichtweise gewöhnen können, was gewisse Untersuchungen bestätigen. (Siehe dazu z. B. Introduction to Psychology, 4th edition, E. R. Hilgard/R. C. Atkinson, Harcout, Brace & World Inc. 1967, Seite 222 unter: 9.4 Location constancy) Es würde hier auch keinen Unterschied machen, wenn der eine, aus welchem Grund auch immer, Froschaugen -, ein anderer Adleraugen hätte, um nur ein sehr grobes Beispiel zu nennen. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut – im Großen und Ganzen nichts weiter als Wasser verrührt mit gut durchgesiebter Erde, jetzt wissen wir’s – aber auch wenn wir beispielsweise aus Blech und Blei wären, so müsste dieser Umstand an sich keineswegs notwendigerweise unser Gemütsleben in irgendeiner Form beeinflussen (außer dass es natürlich öfters scheppern und anders “bum!“ machen würde, wenn man hinfällt und man statt üblicher Hautcremes einen deftigen Rostschutz bevorzugen würde).
Wer beispielsweise mit einer grünen oder roten Brille geboren werden sollte, würde dennoch die Welt an und für sich wie jeder Normalsichtige empfinden. Die rote oder grüne Brille würde unweigerlich diverse Spektren der em-pfangenen Lichtsignale begünstigen oder benachteiligen, wodurch sich jedoch lediglich die zuvor erwähnte allgemeine Beschränkung unserer Sinnesapparatur verändern -, und sich auf andere Teile des empfundenen Ganzen beziehen wür-de, ohne dass sich dadurch der entsprechende inhaltliche Charakter unbedingt verändern müsste. Die gesamte Bedeutung einer Signalübertragung wäre des-halb in keiner Weise gefährdet, und in keiner Weise beeinflusst, da im Prinzip weder von Brillen noch von irgendwelchen anderen, diesbezüglichen Mitteln selbst Signale, bzw. Geist, ausgeht, der sich mit dem Geist der ursprünglichen Information vermengen und sodann Letzterem einen neuen Sinn geben könnte.
Hilfsmittel sind nicht kompatibel zu ihren Herren, denen sie dienen – das haben wir zuvor bereits diskutiert (Seite 137-8). Aus der erwähnten menschli-chen Beschränkung mögen sich gegebenenfalls Interpretationsfehler wie Täu-schung, Halluzination ergeben. Diese Fehler beruhen jedoch im Wesentlichen auf der Tatsache, dass uns prinzipiell lediglich Teilinformation, statt vollständiger Information zur Verfügung steht. Wir schließen aus mehr oder weniger stets beschränktem Wissen auf bestimmte, ganze Aspekte, was gelegentlich ins Auge gehen kann – bzw. gelegentlich ins Auge gehen muss. Es gibt streng genom-men keine falsche Information, kein falsches Wissen, es kann lediglich fälschlich mit relativ beschränktem Wissen auf einen gesamten Aspekt gemutmaßt werden, oder aber es kann mehr oder weniger bewusst und mit möglicherweise emotional bedingter Absicht über das Maß der eigenen Kenntnis hinaus geurteilt werden. In beiden Fällen ist jedoch die korrespondierende Grundinformation an sich stets korrekt, wenn auch, relativ zu einem mehr oder weniger komplexen gesamten Sachverhalt, stets lückenhaft und relativ beschränkt. Subjektiver Einfluss auf die Interpretation von Information aus der Realität erstreckt sich daher lediglich auf das quantitative Auffüllen relativ lückenhafter Information jedoch nicht auf die tatsächliche qualitative Sinnesinformation an sich. Die Lücken und damit die Quantität bzw. die Ausbeute, zudem die Perspektive, dieser Information, variiert von Individuum zu Individuum teils gering, teils ganz erheblich, die Qualität jener Information an sich, ist jedoch grundsätzlich unabhängig von jeglicher subjektiver Gegebenheit.
Ungeachtet unserer erwähnten, grundsätzlich beschränkten Gegebenheiten der Informationsaufnahmen empfinden wir rein körperlich weit mehr, als uns tatsächlich bewusst wird. Die Augen selbst sind beispielsweise schon darauf spezialisiert, interessante Aspekte von relativ unbedeutenden zu trennen um möglichst lediglich die interessanten Signale zum Gehirn weiterzuleiten. Dadurch wird es dem Bewusstsein erleichtert – bzw. überhaupt erst ermöglicht – sich auf bestimmte Einzelheiten der Sinnesempfindungen zu konzentrieren, insbesondere auf solche, die aus dem einen oder anderen persönlichen Grund eben interessant sind.
Wären wir mit einem ständigen, beliebigen Geräusch im Ohr geboren, wir würden es völlig ignorieren, nicht weil wir es körperlich nicht hören würden, sondern weil dieses ständige Geräusch (für uns) keinen Zweck darstellen würde. Unser Bewusstsein scheint vor allem auf inhaltliche Bedeutung erpicht zu sein, wobei Einzelheiten, welcher Art auch immer, nicht zwangsläufig persönlich interessant sein müssen, hingegen können sie sich als hinderlich erweisen, da sie eventuell die Sicht auf das Wesentliche verbauen.
Die etwas Kurzsichtigen sind durchweg die sichersten Autofahrer, ganz einfach, weil ihr vermeintlicher Augenfehler eine ganze Menge überflüssiger Informa-tion vorneweg aussiebt und somit die Konzentration auf das Wesentliche schärft.
Führerscheinneulinge sind erfahrungsgemäß das größte Sicherheitsrisiko auf unseren Straßen. Sicheres Fahren bedingt eben Übung – das wäre ein Argument. Ein anderes ist, dass man erst sicher fahren kann, wenn man den überwiegenden Teil entsprechender intensiver Schulung wieder vergessen hat und sich endlich auf das konzentrieren kann, was wirklich zählt. Es kommt zumindest vor, dass einer jahrelang relativ sicher und unfallfrei und eben auch führerscheinfrei fährt, er schließlich dann doch irgendwann, irgendeinen guten Rat achtend, den Führerschein macht, und es binnen kurzer Zeit kurz und entschieden kracht. Bum!
Ohrensausen, in der Fachsprache unter Tinnitus geführt, kommt womöglich nur dadurch zustande, weil der Mensch ab einem bestimmten Zeitpunkt seiner Entwicklung alle neue, äußere wie innere Geräusche als potentiell bedeutungs-voll einstuft, während er in einem früheren Stadium die mögliche grundsätzli-che Signifikanz von Signalen der verschiedensten Art erst noch erlernen muss, und sich nur bewusst ist, was ihn zuvor bereits entweder positiv oder negativ gerührt hat und er folglich nur jene Signale bewusst empfindet, die er als relativ bedeutungsvoll kennengelernt hat.
Demnach wird uns Sehen und Hören von Geburt an zunächst überhaupt nicht bewusst, obwohl die Sinnesorgane schon voll funktionsfähig sein mögen. Wir fühlen die Welt (und uns selbst) wahrscheinlich erst nach und nach, nicht schlagartig, auch wenn jene Organe an sich bereits relativ gut arbeiten.
Mit der Geburt ist der Mensch noch kein echtes, fühlendes Individuum, sondern, gemäß der lebensnotwendigen Funktionen, lediglich ein mehr oder weniger grob vorprogrammierter Automat, der reflexartig – jedoch noch (lange) nicht gefühlsmäßig und bewusst reagiert. Die eigentliche Menschwerdung ist, so gesehen, ein lebenslanger Lernprozess der mit der Geburt praktisch erst beginnt.
Erfahrung ist im Grunde unabhängig von der Struktur eines Individuums. Denn die Struktur an sich hat keinen erfahrungsrelevanten Inhalt, der sich mit dem Inhalt einer Erfahrung vermischen könnte. Die Struktur stellt in dieser Überlegung ein Hilfsmittel dar welches zum Zweck jenes Hilfsmittels generell inkompatibel ist.
Dass ein Zweck inhaltlich grundsätzlich unabhängig von jeglicher beteiligter Struktur ist lässt sich dadurch bereits beweisen, dass verschiedene – teilweise sehr verschiedene – Strukturen ein und denselben Zweck haben können. Ein Nagel lässt sich mit einem Hammer ebenso wie mit einem Stein, zur Not auch mit einer Zange oder mit einem Besenstiel, einschlagen. Strukturelle Kriterien haben in dieser Geltung bestenfalls quantitativen – jedoch keinen qualitativen Einfluss. Alle gängigen Autos können heutzutage 50 km/h fahren oder beinhalten überhaupt die “Qualität“ fahren zu können – quantitative Fragen z. B. was die mögliche, strukturell-bedingte Spitzengeschwindigkeit betrifft spielen dabei absolut keine Rolle. Der Zweck bzw. die “Qualität“ Wasser zu kochen, um ein weiteres Beispiel zu nennen, ist weder relevant zur Art und Weise noch zur Struktur mittels der man jene Qualität erzeugt.
Schön und gut, wo bleibt hingegen die offizielle wissenschaftliche Bestäti-gung zu den Ausführungen dieses Kapitels? – hier ist sie (wenn auch nicht gerade so, wie wir sie gerne hätten):
“Die von Kant entdeckten subjektiven Eigenleistungen hängen weder von der Struktur des Gehirns (neurowissenschaftlicher Naturalismus) noch von der Stammesgeschichte des Menschen (evolutionstheoretischer Naturalismus)[...] ab. [Das ist eine sehr bemerkenswerte Interpretation der KrV – der Geist jenes Werkes insgesamt tendiert eher in die entgegengesetzte Richtung. Kant selbst hält sich in diesem Punkt zumindest eher zurück: → u. a. KrV B 72, A 27, siehe ferner: unser Buch , S. 331 [hier: 201], im Zsh. mit P.-F.-Strawson-Zitat.] Trotzdem fällt für Kant das menschliche Erkenntnisver-mögen nicht letztlich vom Himmel (Vollmer 1987, 102). Denn die angeblich fehlenden ontogenetischen [Ontogenie: biogenetische Entwicklungslehre] und phylogenetischen [entwicklungsgeschichtlich, Phylogenie: Stammesgeschichte] Überlegungen gehören nicht zum Thema der Kritik , [aber genau das wird ihm ja offenbar zum Vorwurf gemacht] den Geltungs-, nicht Entstehungsbedingungen von Erkennt-nis. Kant fragt nicht nach der Genese, sondern nach den Bedingungen von Objektivität. [Das ist nicht der Punkt – es geht eher darum, ob Kant dazu berechtigt ist, diese Frage auszuklammern! Hat Kant etwa die Erfahrung erfunden? Sodann hätte er diesbezüglich allerdings freie Hand!]
Einer streng universalistischen Interpretation könnte man zwar entgegenhalten, Kant bringe vom Motto an (B ii) immer wieder die Qualifizierung <<menschlich>> bzw. <<uns>>, <<unser>> oder <<uns Menschen>> ein (B xxx, 72, 195 und 877 u. a.). Selbst der Satz: <<Unsre Natur bringt es so mit sich, daß die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann>> (B 75), schränkt die Gültigkeit aber nicht auf die biologische Gattung Mensch ein. Denn die Kritik hebt nicht auf deren Besonderheiten wie zweibeinig, aufrechter Gang, Fünfzahl der Sinne ab [das wäre in diesem Zsh. auch lediglich zweitrangig. In der KrV spielt die Vernunft – die “menschliche“ Vernunft wohlgemerkt – hingegen eine wesentliche Rolle, was deutlich gegen die hier zitierten Argumente Professor Höffes spricht!] (Lesart 1: bescheidener, anthropologisch eingeschränkter Gattungsuniversa-lismus). Sie befaßt sich vielmehr mit all jenen erkenntnisfähigen Wesen, denen Gegenstände durch die Sinne vermittelt werden (B33), die also auf eine rezeptive Anschauung angewiesen sind (Lesart 2: strenger, gattungsunspezifischer Universalismus). Auch bei etwaigen erkenntnisfähigen Wesen anderer Sonnensysteme findet die Anschau-ung in Raum und Zeit statt und folgen die Ereignisse Kausalitätsgesetzen.“ [S. 46] (Otfried Höffe, siehe nachfolgend)
Und doch behauptet Professor Höffe:
“<<Erscheinungen>> heißen die Gegenstände, sofern sie auch vom erkennenden Subjekt abhängen, <<Dinge an sich>> aber oder <<Ding an sich selbst (betrachtet)>>, sofern sie davon unabhängig sind. [...] Einerseits bedeutet <<Erscheinung>>, daß es vom <<rohen Stoff sinnlicher Eindrücke>> (B1) zur Erkenntnis erst durch subjektive, freilich vorempirische Leistungen kommt. Infolgedessen gibt es von Dingen ohne subjektive Zutaten, von Dingen an sich, keine Erkenntnis. [Wie darf man sich jene “Zutaten“ konkret vorstellen? Überhaupt ist diese Darstellung ein wenig oberflächlich, wenn nicht direkt falsch, denn von Dingen an sich (selbst) gibt es, gemäß Kant – da kennt er absolut kein Pardon – grundsätzlich keine Kenntnis – weder mit noch ohne “Zutaten“, siehe u. a. KrV A42-4/B59-62, – im vorliegenden Werk teils zitiert → S. 94.] Andererseits ist die Subjektivität auf eine sinnl-iche Vorgabe angewiesen, weshalb der Verstand allein zur Erkenntnis nicht ausreicht (B 326).“ [Seite 47] (Otfried Höffe, siehe nachfolgend)
“Die Grundlegung der modernen Philosophie“, nennt Professor Höffe Kants Kritik (d. r. V.) und das bereits im (bzw. unter dem) Titel (seines hier zitierten Werkes). Damit scheint er Kant im Kern als prinzipiell unwiderlegbar zu verehren – erhaben über aller Kritik.
Nun, Professor Höffe hat völlig recht, wenn er behauptet dass Erfahrung unabhängig jeglicher subjektiver Struktur ist, seine Begründung lässt jedoch, aus unserer Sicht, etwas zu wünschen übrig. Wenn Erscheinungen vom “erkennenden Subjekt abhän-gen“ und es “ohne subjektive Zutaten, von Dingen an sich, keine Erkenntnis“ gibt, so stellt sich sofort die Frage: Worauf sollte sich der unterstellte subjektive Einfluss auf Erfahrungs-inhalte begründen, wenn gleichzeitig behauptet wird, dass die subjektive Struktur in dieser Hinsicht absolut keinen Einfluss hat? Dazu hat O. Höffe zumindest eine indirekte Antwort:
“Räumlichkeit und Zeitlichkeit haben keine absolute Realität (B 50 ff.); sie sind an eine auf Sinnlichkeit angewiesene Anschauung gebun-den. Kant nennt dies den Standpunkt eines Menschen (B 42), so daß man meinen könnte, er schränke die Geltung seiner Überlegungen auf eine einzige biologische Spezies ein. Tatsächlich macht er sich nicht etwa von unserem Sinnesapparat oder unserer Gehirnstruktur abhängig, sondern, [...] lediglich vom Angewiesensein auf Rezeptivität [abhängig wohl nicht lediglich von Rezeptivität an sich, als vielmehr von apriorischen Bedingungen der Erfahrung überhaupt] .“ [Seite 110]
(Otfried Höffe, KANTS KRITIK DER REINEN VERNUFT, 2004, die Seiten 46, 47 und 110)
(Man vergleiche hierzu u. a. unser Buch S. 15, 18-9, 133. Wir sind nicht restlos einverstanden mit dem, was Professor Höffe uns da bietet, dennoch sind seine zitierten Ausführungen für uns recht hilfreich – seien wir zunächst eher verhalten als überkritisch!)
Wenn aber der bloße Fakt: “Angewiesensein auf Rezeptivität“ den strittigen subjektiven Einfluss ausmacht, so stellt sich die Frage, was jenen Einfluss der Rezeptivität begründen sollte, wenn die subjektive Struktur und somit auch die subjektiven apri-orischen reinen Formen der Anschauung in dieser Betrachtung ausscheiden? Letztlich bliebe lediglich die empirische Anschau-ung übrig – was man wiederum, ähnlich wie oben, etwas breiter fassen könnte: nicht die empirische Anschauung an sich, sondern der Fakt, dass wir überhaupt auf empirische Aspekte angewiesen sind, – was sodann inhaltlich deutlich über Kant hinaus weiter zurück in die philosophische Weltgeschichte reicht. Das bringt Professor Schnädelbach treffend zum Ausdruck:
“Was jedoch weder Aristoteles noch der Empirismus zu lösen vermochten, war das durch die antike Skepsis und den cartesianischen Zweifel aufgeworfene Problem der Objektivität der Erfahrungserkennt-nis: Woher können wir wissen, daß die repräsentierenden Vorstellun-gen, die wir von den Gegenständen der >>Außenwelt<< haben, nicht nur unsere Vorstellungen von ihnen sind, daß sie sie vielmehr tatsäch-lich so repräsentieren, wie sie selbst sind?“ [Seite 126]
“Der Repräsentationalismus ist [...] ein weit offenes Einfallstor für den erkenntnistheoretischen Skeptizismus, denn wenn wir tatsächlich nur über Vorstellungen verfügen, können wir nie wissen, ob diese mit den vorgestellten Dingen übereinstimmen, denn eine solche Übereinstimmung wäre ja wieder nur eine Vorstellung.“ [S. 57] [vergl.→ S. 136, Berkeley]
“[...] tatsächlich sagen uns die Cartesianer, wir seien ganz in unser Bewußtsein eingeschlossen und erlebten darin wie auf einer Bühne die Vorstellung von Dingen, Zuständen und Ereignissen, von denen wir ja nicht umstandslos glauben sollten, sie seien >>real<< im Sinne einer von uns unabhängigen >>Außenwelt<<.“ [Seite 55] (H. Schnädel-bach, Erkenntnistheorie zur Einführung, 2002, d. Seiten 126, 57 und 55)
Entgegen der soeben vorgestellten Behauptung sind wir definitiv nicht in unserem Bewusstsein eingeschlossen. Wir können wissen, dass unseren Vorstellungen eine äußere Realität tatsächlich entspricht bereits aus einem ganz einfachen Grunde, weil sich aus der potentiellen Fülle innerer Aspekte keine individuelle äußere ableiten lassen.
Kann man einfach so tun als ob ...? Kann man die Realität einfach Realität sein lassen und sich selbst eine eigene subjektive Welt aufbauen inmitten jener Realität? Kann man Erfolg haben oder überhaupt leben und überleben in einer Umgebung die man nicht kennt, nicht sieht nicht fühlt, nicht ... ?
Man stelle sich vor wir wären in einen riesengroßen fremden dichten Wald verschleppt worden und suchten vergeblich einen Ausgang. Plötzlich, aus welchem Grunde auch immer, fallen uns zwei Hefte zu Füßen, das eine enthält eine genaue Karte des Waldes mit etlichen wörtlich beschriebenen Details und Erläuterungen, das andere: eine nicht minder detaillierte Broschüre betitelt: Maximal mögliches Mensch, Subjekt total, erhaben über alle Welten! Der Haken in der Geschichte: wir können nur eines der beiden Hefte wählen. Entscheidende Frage: welche Lektüre wählen wir?
Kant erleichtert uns die Wahl: dass es ein Wald ist können wir gar nicht wissen ohne subjektives Vermögen – mit subjektivem Vermögen aber können wir das erst recht nicht wissen, weil sodann alles notwendigerweise subjektiv vorgeprägt ist; also sind wir prinzipiell blind für den Wald in seiner absoluten Musik, so oder so. Mag er pfeifen wie er will, den Wald lassen wir links liegen!
Flotter Marsch, diese Melodie – spielt der Wald da aber mit? – lässt er uns gleichfalls links liegen? Und gerade das ist unwahrscheinlich, ja unmöglich! Die Realität ist hart, unerbittlich, fordernd! Sie verlagt definitiv gebührendes Verhalten und das kann nur funktionieren, wenn die Welterkennung seitens des Subjekts im Grunde den jeweiligen Objekten angemessen ist und stimmt!
Zwei Sätze, eine Folgerung:
In der äußeren Welt existiert keine Zeit. (u. a. nach KrV A35) In der inneren Welt unserer Vorstellungen existiert die Zeit.
Daraus schließt Kant: Die Zeit ist eine notwendige Bedingung für menschliche Vorstellungen überhaupt, ohne Bezug zur abso-luten Realität – jenseits des Menschen ist sie nichts. (u. a. KrV A35)
Dabei geht Kant offenbar davon aus, dass das Verhältnis äußerer zu innerer Welt grundsätzlich unabhängig von jeglichen subjektiven Zutaten sei. Jenes Verhältnis kann jedoch nur dann konstant bleiben, wenn entsprechende Zutaten zur einen Seite mit Zutaten zur anderen ausgeglichen werden.
Um diesem offenkundigen Widerspruch auszuweichen relativiert Kant die äußere Welt der Dinge an sich selbst zu einem völlig unbestimmten etwas herunter. Mit jenem Schritt zerstört er allerdings jenes Verhältnis im Ganzen. Denn es kann nicht sein, dass auf der einen Seite einer Verhältnisgleichung, die den Vergleich innerer zu äußerer Welt ausdrückt, insgesamt der Zufall regiert und auf der anderen Ordnung.
Kant übersieht, in diesem Zsh. offenkundig, dass allgemeine Bedingungen, in Form von Oberbegriffen, bzw. Universalien, rein theoretische Sammelbegriffe sind ohne real in Erscheinung zu treten – ohne körperlich direkte reale Wirkung. “Wirklich“ ist letztlich nur das Einzelne – das Ganze ist Theorie bzw. ein Sammelbegriff aller möglichen Zustände des Einzelnen. Jene Theorie ist künstliches Hilfsmittel das Einzelne zu begreifen,
Kant macht diesbezüglich aber aus bloßer Theorie quasi einen realen Fakt. Alle menschliche Theorie ist generell Abbild der Realität, eine Folge der Welt – Kant setzt hingegen die The-orie über die Welt über die Welt selbst – macht die Welt prinzipi-ell zur Folge der Theorie, die ihr nach- und ebenso vorauseilt.
Wenn man allgemeine Bedingungen der Erfahrung als sub-jektive Zutaten wertet, mit inhaltlichen Folgen für die be-dingten Vorstellungen, wie Kant, so erklärt man die Bedingung zum Inhalt, zum Inhalt selbst. Wenn das Allgemeine jedoch tat-sächlich also ins Einzelne greift, so verliert es notwendigerwei-se seine allgemeine Gültigkeit – oder aber das Einzelne wird verhindert, bzw. zur Allgemeinheit fälschlich erhöht (→ S. 85).
Es sei an dieser Stelle also nochmals ausdrücklich auf den höchst eklatanten Widerspruch hingewiesen der sich aus Kants allgemeinem Charakter aller apriorischen subjektiven Bedin-gungen der Möglichkeit der Erfahrung und dessen generell unterstelltem Einfluss eben zu jener Erfahrung ergibt.
Jede vorgeblich allgemeine Bedingung, die inhaltlich auf das Bedingte wirkt, ist keine “allgemeine Bedingung“ im absoluten Blick, sondern ein realer Teil des Bedingten selbst. Der Ausdruck “allgemein“ täuscht in diesem Falle eine Unabhängigkeit eben jenes Allgemeinen zum nachfolgend Bedingten vor, die körper-lich nicht existiert. Eine allgemeine Bedingung ist notwendiger-weise neutral zum Inhalt des Bedingten, des Einzelnen, des Individuellen der Erfahrung. Eine Bedingung mit nachfolgendem Einfluss bildet eine feste Einheit mit jenem beeinflussten Ge-genstand, mit Wirkung auf die Bedingung selbst. (auch → S. 109-0)
Apriorische Bedingungen fordern jedoch, mit Kant, allge-meine Gültigkeit und folglich prinzipielle Unabhängigkeit zum Einzelnen. Die geforderte Unabhängigkeit ist hingegen nicht möglich, wenn sich allgemeingültige Voraussetzungen inhaltlich auf individuelle Fälle erstrecken und sodann zwangsläufig eine inhaltliche Bindung zum Einzelnen eingehen.
Kant übersieht zudem, dass ein geordnetes System, soll es denn tatsächlich funktionieren, immer noch abhängig ist und bleibt von äußeren direkten Befehlen. Empirisch zufällige Impulse könnte man insgesamt als eine Art Rahmenbedingung auffassen – dadurch ließe sich sodann ein bestimmter Befehl ausführen, z. B: ein/aus, in der Art eines technischen (Haupt-) Schalters. Somit ließe sich ein komplexer Aspekt insgesamt ein- oder ausschalten, das wäre aber auch schon alles. Auf die einzelnen Funktionen eines diversen Systems lässt sich auf diese Weise nicht beikommen. – Ein weiterer Punkt:
Zufall hat an sich keinen Sinn, es ist daher logisch unzulässig (auch nur teilweise) aus einem zufälligen Strom völlig ungeordne-ter Impulse diverse geordnet und damit sinnvolle Befehle abzu-leiten – Kant versucht aber genau das! Kant macht bezüglich der Affektion (zur äußeren Welt der Dinge an sich selbst) keinen Unterschied – er kann keinen machen, andernfalls droht ihm der Realismus. Dabei bleibt er jedoch zwangsläufig im Allgemeinen gefangen:
Kant leitet alle Erfahrung und damit eben auch alle Diversität der Erfahrung aus der Relation apriorischer subjektiver Gege-benheiten einschließlich empirischer Sinnesimpulse ab.
Dabei übersieht er, dass die Diversität der Erfahrung zur relativ fixen Konstellation: empirische zufällige Impulse plus subjektiver apriorischer Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung, ein krasser Widerspruch darstellt.
“[...] empirisch, mithin zufällig [...]“ (KrV B5)
“Das Bedingte im Dasein überhaupt heißt zufällig, und das Unbedingte notwendig.“ (KrV B447)
Indes, ein Zufall ist charakterlich wie jeder andere Zufall und somit ohne inhaltliche Differenz von einem zum anderen Fall.
Die gesamte Bedingungskette der Erfahrung angefangen von der empirischen Anschauung zur apriorischen Anschauung über die Verstandeskategorien ist im Grunde immer nur ein und der-selbe Vorgang ohne irgendwelchen Unterschied. Es ist logisch unmöglich aus einem insgesamt konstanten undifferenzierten Vorgang differenzierte Aspekte abzuleiten. Kant ist folglich absolut nicht berechtigt aus einer in sich geschlossenen Konstanz auf irgendeine relativ äußere Differenz zu schließen.
Wenn wir die Vorstellung eines Hundes haben, so liegt uns gemäß Kant eine ganz bestimmte Kette erfahrungsrelevanter Kriterien zu Grunde: Eine Flut empirischer, zufälliger Impulse (eA) plus apriorischer Anschauungen (aA) plus Verstandeskate-gorien (Vk) – kurz: eA + aA + Vk.
Das wäre für Kant soweit nicht unbedingt ein Problem, läge uns bei der Vorstellung einer Katze, eines Igels, eines Raben, eines Hauses usw. nicht exakt die gleichen erfahrungsrelevanten Fakten (eA + aA + Vk.) zu Grunde wie z. B. bei einem Hund!
Kant hat in diesem Gedankenzug den Idealisten lediglich die empirische Anschauung voraus, die ihm letztlich jedoch nichts nützt, da “eA“, ein Strom zufälliger äußerer Impulse, im Falle eines Hundes prinzipiell der gleiche Strom zufälliger äußerer Impulse ist, wie im Falle einer Katze und also überhaupt kein Indiz einer entsprechenden Differenzierung, z. B. zwischen der Vorstellung eines Hundes und einer Katze, bietet. Ohne Indiz ist ein Zufall so viel wert wie jeder andere – austauschbar, beliebig. Ohne Indiz keine Chance zum Einzelnen!
Indem Kant den Zufall quasi als differenzierendes Mittel ein-setzt, hat er bereits das Ergebnis vor der eigentlichen Rechnung:
Der Verstand akzeptiert geistlosen Zufall als sinnvolle be-stimmte Befehle. Sinn und Bestimmung erhält der äußere rohe Stoff jedoch erst aufgrund des Verstandes. Der zu ordnende Zufall wird vom Verstand aufgenommen, als hätte jener Zu-fall an sich bereits die Ordnung, die er durch den Verstand erst nachträglich erhält! Damit unterstellt Kant vorneweg dem Zufall Intelligenz – genau jene Intelligenz, die ihm erst nach- träglich zusteht! – Rätsel, die Kant im Grunde völlig offen lässt:
“Nun – wenn a l l e unsere Erkenntnis mit der Erfahrung beginnt, wenn nichts in diesem Sinne ’angeboren’ oder ’a priori gegeben’ ist, so also auch nicht die Raum- (und Zeit-) Erkenntnis. Freilich – was ist andererseits eigentlich damit gesagt, daß mit der Zeit, oder daß nach und nach aus der sinnlichen Mannigfaltigkeit Erkenntnis w i r d? Dieses Werden eben ist das Rätsel, denn wie kann das Sinnliche (= unbestimmte Mannigfaltigkeit) das w e r d e n, was es nie und nimmer i s t, nämlich Erkenntnis, also Bestimmtheit, Einheit!“ (A. Buchenau, Grund- probleme der Kritik der reinen Vernunft, Felix Meiner Verlag, 1914, Seite 58)
“Sensation, and being affected, is an entirely contingent, a posteriori matter: there is no necessity to our having any sensation. Having agreed with empiricism that sensation is a posteriori and originates through the subject’s being somehow impinged upon from the outside, Kant will say nothing more about sensation itself other than that it composes a ‘manifold’ (multiplicity). In contrast with Locke’s meticulous typology of sensible ideas, everything that Kant will go on to say about sense experience has to do with what the mind makes of its manifold of sensation.” (S. Gardner, Kant and the Critique of Pure Reason, 1999, S. 67)
Kant erwähnt zwar häufig das “Mannigfaltige“, ist dabei jedoch offenbar be-strebt jegliche Präzision zu vermeiden. Zumindest bleibt er sodann pauschal und erkennt offensichtlich nicht, dass er lediglich anhand pauschaler Bedingungen niemals irgendeinen individuellen Einzellfall an sich, sondern immer nur ganze Gruppen von Einzellfällen trifft. Andererseits hat Kant aus der Sicht seines transzendentalen Idealismus keine andere Wahl. Denn sobald er den Boden pauschaler Vorbedingungen, insbesondere die Empfindungen betreffend, verlässt, betritt er unweigerlich realistisches Terrain. Wenn er zugibt, dass z. B. die empiri-sche Anschauung bezüglich der Interpretation einer Katze anders ist, als bei einem Hund – bei einem 5 cm großen Gegenstand anders ist, wie bei einem 8 m großen, usw. so gäbe er zu, dass solchen Differenzen unserer Inneren Erfahrung, Äußere notwendigerweise gegenüberstehen.
Kant gebraucht gelegentlich Ausdrücke wie “extensive Größe“, “intensive Größe“, “Grad des Realen“ (KrV B203ff), “Größenerzeugung“ (KrV B208), “Grad des Einflusses auf den Sinn“ (KrV B208) oder gar “Größe [bzw. “Quantität“ ] als Verstandeskategorie“, “Volumen (extensive Größe der Erscheinung)“ (KrV B215), “Der Begriff vom Hunde bedeutet eine Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüßigen Tieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgend eine einzige besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet [...]“ (KrV A141/B180). Kant vergleicht auch die Erscheinung eines Hauses mit der eines fahrenden Schiffes (KrV A190-3/B235-8). Dennoch bleibt er bei all den soeben angeführten Beispielen pauschal und kann daher nicht erklären wie es über das Pauschale hinaus zu konkreten bestimmten Einzelfällen überhaupt kommen kann (→ Zitat S. 163 oben, KrV A557/B585).
Kant bleibt selbst dann pauschal, wenn er von einem “bestimmten“ Raum (bzw. von einer “bestimmten“ Zeit) spricht:
“Alle Erscheinungen enthalten, der Form nach, eine Anschauung im Raum und Zeit, welche ihnen insgesamt a priori zum Grunde liegt. Sie können also nicht anders apprehendiert, d. i. ins empirische Bewußtsein aufgenommen werden, als durch die Synthesis des Mannigfaltigen, wodurch die Vorstel-lungen eines bestimmten Raumes [!] oder Zeit erzeugt werden, d. i. durch die Zusammensetzung des Gleichartigen und das Bewußtsein der syntheti-schen Einheit dieses Mannigfaltigen (Gleichartigen).“ (KrV B202-3,
Original kursiv) – Siehe dazu insgesamt auch KrV A145, B198-226, A162-183, B271-2, B293, B299-0, A432, B460, B743, Prol. § 8, § 24, § 26.
Zunächst ist uns hier pauschal Raum und Zeit gegeben und plötzlich über die Synthesis des Mannigfaltigen haben wir es angeblich mit “bestimmten“ Vorstellungen in Raum und Zeit zu tun – das ist schlicht Zauberei! Denn Kant lässt dabei völlig offen wie die Synthesis des Mannigfaltigen es schafft aus der bloßen völlig unbestimmten potenti-ellen Fülle der a priori gegebenen Formen von Zeit und Raum auf ganz konkrete bestimmte individuelle räumliche und zeitliche Größen zu schließen. Wie sehr wir die KrV auch durchleuchten, wir werden nirgends diesbezüglich eine auch nur annähernd befriedigende Antwort finden. Das ist nicht sonderlich überraschend: Es ist logisch unzulässig anhand völlig undifferenzierter Aspekte auf irgendwelche Differenzen zu schließen, ganz egal durch welche Art von Mühle man das alles jagt.
U. a. in KrV A77/B103 erwähnt Kant apriorische und empirische Mannigfaltigkeit. Dabei sieht er offenbar nicht, dass der Begriff “Mannigfaltigkeit“ bereits Differenzierung enthält, exakt jene Dif-ferenzierung, die es zu begründen gilt. Weder undifferenzierter Zufall, noch undifferenzierte potentielle Fülle des apriorischen Ganzen, noch eine Synthesis beider, kann ihm diese Begründung liefern – gezwungenermaßen muss Kant hier völlig passen.
“Der für die Erkenntnis unverzichtbare intentionale Bezug auf einzelne Gegenstände bleibt dem Verstand verwehrt. Dessen letzte Vorgabe wird nur über die Fähigkeit des Gemüts, affiziert zu werden, über die rezeptive Sinnlichkeit, gegeben. Nicht vom Subjekt selbsttätig <<erzeugt>>, geht der rohe Stoff sinnlicher Eindrücke (B1) auf Rechnung eines unbekannten Etwas, das Kant, hier durchaus unklar, in Analogie einer Ursache vorstellt. [S. 83, einige Seiten weiter heißt es hingegen:] Wie beim Raum, so befaßt sich Kant auch bei der Zeit lediglich mit dem objektiven Substrat, dem es an jeder Bestimmtheit mangelt, weshalb man besser von Zeit überhaupt oder von Zeitlichkeit spricht. Beim Messgerät für Zeit, der Uhr, bewegen sich die Zeiger, während das Zifferblatt als unbewegter Hintergrund verharrt. Die Zeit, auf die es Kant ankommt, ist aber jener vorempirische Hinter-grund zweiter Stufe, der aller Bewegung, selbst aller Zeitmessung zu-grunde liegt. Eine Differenzierung, die in Zeitreihe, Zeitinhalt, Zeitord-nung und Zeitinbegriff, gehört nicht mehr zur reinen Anschau-ungsform, sondern zur Vermittlung von Sinnlichkeit und Verstand, zur Schematisierung nach Maßgabe der vier Klassen von Kategorien [...].
Mittels Räumlichkeit werden äußere Empfindungen hinsichtlich Gestalt, Größe und Verhältnis gegeneinander abgegrenzt (B37) und in ihrer Unverwechselbarkeit, freilich nur der Anschauungs-, nicht auch Empfindungsunverwechselbarkeit, identifiziert. Weil die Zeitlichkeit Entsprechendes leistet, erlauben die Anschauungsformen das, wozu Begriffe außerstande sind: das Individuelle in seiner (anschaulichen) Individualität zu bestimmen. Während nach Leibniz’ Rationalismus alle Individualität restlos von einem unendlich fein differenzierten begrifflichen Inhalt bestimmt wird (z. B. Discours de Metaphysique 8; Bemerkungen zu einem Brief Arnaulds, 14.7.1686), erkennt man nach Kant durch Begriffe zwar Merkmale. Deren auch noch so umfangrei-che Aufzählung (ohne Eigennamen) erreicht aber nicht, was allein die raumzeitliche Lokalisierung vermag: die Individuation. [...] [S. 88] (O. Höffe, KANTS KRITIK DER REINEN VERNUNFT, die Seiten 83, 88)
Otfried Höffe erkennt offenbar nicht, dass seine soeben zitierte “Vermittlung von Sinnlichkeit und Verstand, zur Schematisierung [...]“ weiterhin ausschließlich im Bereich der potentiellen Fülle agiert, da Kant innerlich lediglich allgemeine Mittel zur Verfügung stehen – er also keine logische Handhabe zum Einzelnen hat (→ u. a. S. 136-7, 189).
Zudem, wie soll nach “Maßgabe der vier Klassen von Kategorien“ über etwas entschieden werden, hier individuelle Zeitinhalte, von denen jene Kategorien keinen blassen Schimmer haben können, weil das Zeit-liche nicht zu ihrem Repertoir gehört? Ausgerechnet mittels der unter-stellten absoluten Zeitlosigkeit des Verstandes soll es möglich sein die Pauschalität der Anschauung der Zeit zur Individualität zu zwingen – das ist mehr als gewagt, das ist völlig unlogisch. Denn jegliche Art der Vermittlung setzt grundsätzlich vergleichbare Kriterien voraus, die kategorische Dimensionssprünge verbietet (vergleiche zu → S. 165-6).
Auch die von Professor Höffe angesprochene “Zeitlichkeit“ ist lediglich eine Bedingung die noch nichts über den tatsächlichen Wert der Zeit (z. B. 5 Minuten) im konkreten Einzelfall aussagt. Aus der Sicht Kants könnte man allenfalls aus der Empirischen Anschauung die Differenz einzelner Erscheinungen begründen (aber definitiv nicht aus ein-zelnen oder dem gesamten Komplex apriorischer Bedingungen).
Dass aber letztlich die Empirische Anschauung dazu doch nichts taugt, geht aus ihrem eigens durch Kant unterstellten zufälligen Charakter hervor: Zufälle bieten keine Argumente für irgendwelche Differenziert-heit und somit keine Anhaltspunkte für die tatsächlichen Größen indivi-dueller Ereignisse. Die subjektive Erscheinung von beispielsweise 5 cm setzt eine äußere reale Differenz voraus die exakt der Bedeutung jener inneren Erscheinung entspricht. Alle subjektiven Bedingungen die Kant uns in diesem Zsh. auftischt sind bestenfalls Mittler – ob Anschauungen, Kategorien oder die subjektive Struktur an sich – ohne eigentliche inhaltliche Bedeutung zur jeweils vermittelten Information an sich.
Kant erwähnt diesbezüglich etliche Details z. B:
Allgemeine Logik, transzendentale Logik, Mannigfaltiges der Sinnlichkeit a priori, Bedingungen der Rezeptivität, Mannigfaltiges der reinen Anschauung a priori, Spontaneität unseres Denkens, Synthesis des Mannigfaltigen, Synthesis der reinen Verstandesbegriffe, Synthesis des Mannigfaltigen der reinen Anschauung, Einheit der Synthesis verschiedener Vorstellungen der Verstandesbegriffe, trans-zendentaler Inhalt der Anschauung vermittelst der synthetischen Einheit des Man-nigfaltigen, reine aber abgeleitete Verstandesbegriffe (Prädikabilien) des reinen Verstandes – abgeleitet von den Stammbegriffen (12 Kategorien) des reinen Verstandes, Erkenntnis des menschlichen Verstandes durch Begriffe Einheit der Handlung verschiedener Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen als Funktion der Begriffe, Spontaneität des Denkens, Rezeptivität der Eindrücke der sinnlichen Anschauung – usw (– gemäß KrV A68-82/B93-108).
Entgegen vergleichbarer Kant-Interpretationen gehen wir bewusst nicht auf solche Details hier weiter ein, denn wie Kant auch immer Apriorisches und Empirisches kombiniert, es langte nie zu irgendetwas Bestimmten, Individuellen. Kant braucht definitiv direkte äußere Befehle, andernfalls bleibt er völlig gefangen im Bereich des Pauschalen. Den vermeintlich simplen Schritt vom Möglichen zum Konkreten kleidet Kant in einen gigantischen theoretischen Aufwand der allgemein sehr leicht darüber hinwegtäuscht, dass er (und erst recht alle Idealisten) letzten Endes absolut keine gültige Handhabe zu jenem Schritt hat.
Selbst die einfachsten mathematischen Axiome setzen den Begriff der Größe voraus – sind nur durch ihn möglich (gemäß Prol. § 20). Dennoch lässt sich allein aus dem Begriff der Größe nicht das einfachste Axiom ableiten – auch nicht mit Hilfe weiterer subjektiver apriorischer Kriterien des reinen Verstandes oder der reinen Anschauungen. Denn alle apriorischen subjektiven Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung verweilen bei Kant zwangsläufig im Kreise des Pauschalen und liefern somit nicht das allergeringste Indiz eines konkreten individuellen Einzelfalls.
“Eine Perzeption, die sich lediglich auf das Subjekt, als die Modifikation seines Zustandes bezieht, ist Empfindung (sensatio), eine objektive Perzeption ist Erkenntnis (cognitio). Diese ist entweder Anschauung oder Begriff (intuitus vel conceptus). Jene bezieht sich unmittelbar auf den Gegenstand und ist einzeln [das ist eine übermütige Aussage Kants die sich definitiv weder mit der unterstellten Zufälligkeit des Empirischen noch mit der gesetzlichen Allgemeinheit der apriorischen Anschauung verträgt: ’Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a priori [...]’ (KrV B4)] ; dieser mittelbar, vermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen gemein sein kann.“ (KrV A320/B377)
“Da keine Vorstellung unmittelbar auf den Gegenstand geht, als bloß die Anschauung, [hier kann Kant wohl nur die empirische Anschuung meinen, denn wie soeben gezeigt, bezieht sich “a priori“ generell auf das Allgemeine!] so wird ein Begriff niemals auf einen Gegenstand unmittelbar, sondern auf irgend eine andre Vorstellung von demselben (sie sei Anschauung oder selbst schon Begriff) bezogen. Das Urteil ist also die mittelbare Erkenntnis eines Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer Vorstellung desselben. In jedem Urteil ist ein Begriff, der für viele gilt [!] und unter diesem Vielen auch eine gegebene Vorstellung begreift, welche letztere denn auf den Gegenstand unmit-telbar bezogen wird [genau hier liegt der Haken bei Kant, denn er hat überhaupt keine Handhabe, die exakt den Schluss von der Fülle, vom “Vielen“, zum Individuellen rechtfertigt! Alle Karten sind da, aber wer wählt sie aus? – die Anschauung?] . “ (KrV A68/B93, siehe auch: KrV B4)
“[...] sondern auf irgend eine andre Vorstellung von demselben [...]“, na wirklich! Kant flüchtet da in äußerst komplizierte völlig undurchschaubare Formulierungen. Wie soll z. B. die Anschauung un-mittelbar auf den Gegenstand gehen, wenn sie a) lediglich anhand der reinen Anschauung Pauschalität und b) mit der empirischen Anschau-ung lediglich unbestimmte völlig zufällige Kriterien vorzuweisen hat?
Kant führt das Einzelne als eine von 12 Kategorien – Kategorien stehen jedoch generell auf allgemeinem Niveau (u. a. KrV B4/B377)!
Selbst die einfachsten Aspekte unserer Erscheinungen setzen den Oberbegriff der Größe, oder des Raumes überhaupt, voraus. Alles Individuelle setzt Universalien, Ideen: Oberbegriffe voraus, indes, allein aus solchen Oberbegriffen lässt sich nicht auf den allersimpelsten einzelnen Aspekt unserer Erfahrung schließen.
Auch die empirische Anschauung kann dazu nicht dienen, denn zufällige undifferenzierte Impulse lassen prinzipiell keine bestimmten differenzierten Rückschlüsse zu. Kant handelt hier seine empirische Anschauung mindestens als Wunderwesen, denn nichts geringer als ein Wunderwesen kann zufälligen Charakter führen und gleichzeitig die außerordentliche Intelligenz besitzen im oben erwähnten Sinne immer die richtigen Karten zu ziehen.
Nimmt man hingegen an, dass sich das Einzelne aus der empirischen Anschauung ergibt, so stellt sich die Frage, wie das Empirische, das ursprünglich angeblich weder irgendetwas Zeitliches noch Räumliches mit sich führt, nun plötzlich, nachdem es die Ordnung der reinen Anschauungen übernommen hat, zeitlich-räumliche Entscheidungen treffen kann, die über die rein pauschalen Oberbegriffe der reinen Anschauungsformen entschieden hinausgehen, nämlich direkt auf das Individuelle? Aber das hier eigentliche Problem reicht tiefer:
Das Allgemeine ist zum jeweils Individuellen grundsätzlich wesens-gleich. Es ist logisch unzulässig unter einen Oberbegriff eine fremde Größe, hier das Empirische, zu stellen (→ S. 165-6) – es wäre doppelt unzulässig, sodann aus dem jeweiligen Oberbegriff mittels einer völlig fremden Größe, hier des Empirischen, das Individuelle zu bestimmen.
Die Affektion, das Wesen des Empirischen, hat an sich, gemäß Kant, nichts mit Raum und Zeit zu tun: Raum und Zeit sind Oberbegriffe der reinen Anschauung. Wenn aber von der Außenwelt nichts Räumlich-Zeitliche affiziert wird, so ist es logisch unzulässig, dieses Nicht-Räumlich-Zeitliche unter die Oberbegriffe der reinen Anschauung des Raumes und der Zeit zu setzen. Es ist doppelt unzulässig sodann anhand jenes Nicht-Räumlich-Zeitlichen Definitionen zu treffen, die über die jeweiligen Oberbegriffe hinaus, weiter heruntersteigen, nämlich direkt auf ganz bestimmte individuelle Größen, z. B: 5 m, 30 km, 2 Sek., 8 Std. ... Zudem ist es unzulässig anzunehmen, subjektive Strukturen (Schemata, usw.) könnten die Logik des Ganzen irgendwie kippen. Kant erlaubt sich indes exakt diesen höchst fragwürdigen Hattrick – inspiriert durch maßlose Überdeutung des Begriffs der Bedingung!
Bei Kant ist es letztlich der bedingte Verstand, der bedingungslos aller Natur Bedingungen aufzwingt, von denen er selbst bedingt ist, womit er sodann, als ultimatives Wunder, radikal beschränkte Allge-meingültigkeit, wie selbstverständlich, völlig unbeschränkt aufs Einzelne ausdehnen darf. – Da wird’s doch langsam Zeit für den Osterhasen!
[Nun, mit Osterhasen wird’s heuer reichlich knapp. (Im Original wechselt ab dieser Stelle die weitere Diskussion zu sozialen Themen, Teil 2, und nimmt später, Teil 3, eher politischen und schließlich vorwiegend religiösen Charakter an). Wir hatten ja immerhin Katzen, Hunde und buchstäblich aus dem Nichts sogar einen Kuchen, ...
Wir präsentieren sogleich vier Zugaben und stellen alsdann die ganz wesentlichen Punkte dieser Arbeit nochmals in einer offiziellen kurzen Zusammenfassung vor.]
Beilage 1 [Auszug, Original S. 313]
[...] Weder kommt Gefühl noch Wissen ohne Kontraste aus. Es gibt demnach keine “reinen“ Gefühle, noch gibt es ein menschlich mögliches “absolutes“ Wissen. Glück, Unglück, Wissen sind generell relativ, weil wir Ideale als Relation – nicht als eigenständige Ideale an sich selbst erkennen:
Im absoluten Sinne handelt Wissen nicht von platonischen Idealen (Universalien) an sich, denn Ideale an sich sind kontrastlos und daher sinnlos. Wissen ist stets eine Relation verschiedener Ideale. Wissen ist nur über ein subjektives Bewusstsein möglich, welches den Kontrast zwischen mindestens zweier verschiedner Aspekte ermöglicht. Wenn wir an ein bestimmtes Ideal A denken, so denken wir unwillkürlich alle übrigen Ideale die wir kennen hintergründig mit. Daher ist ein “reiner“ Gedanke z. B. an das Ideal A grundsätzlich nicht möglich – wäre er möglich so wäre er völlig sinnlos, da ohne jeglichen Kontrast, und somit ohne jegliche inhaltliche Beziehung, die sich nur über ein Bewusstsein aus einer bestimmten persönlichen Situation ergibt (→ u. a. S. 446-7).
[hier → S. 205-6]
Beilage 2 [= “Bemerkungen“, Original S. 330-1]
Zu Seite 18(-9): Peter F. Strawson meint dazu:
“Kants Konzeption des Kontrastes zwischen Dingen an sich und Erscheinungen scheint denselben Ausgangspunkt zu haben wie die Konzeption des wissenschaftlich gesonnenen Philosophen. Beide behaupten, daß, weil wir der Dinge nur gewahr werden, indem wir affiziert werden, und sie uns nur so erscheinen, wie es Resultat dessen ist, daß wir so affiziert werden, wir der Dinge nicht gewahr werden, wie sie an sich selbst sind. Aber im nächsten Schritt unterscheiden sich beide. Der wissenschaftlich gesonnene Philosoph bestreitet uns nicht das empirische Wissen der Dinge, wie sie an sich selbst sind, die uns so affizieren, daß sie sinnliche Erscheinungen hervorrufen. Er bestreitet nur, daß die Eigenschaften, die jene Dinge uns unter normalen Umständen zu haben scheinen, in der Menge der Eigenschaften enthalten sind (oder alle in der Menge enthalten sind), die sie tatsächlich besitzen und von denen wir als von Eigenschaften von Dingen, wie sie an sich selbst sind, wissen, daß sie sie besitzen. Kant hingegen bestreitet die Möglichkeit jedes empirischen Wissens überhaupt von den Dingen an sich, die uns so affizieren, daß sie sinnliche Erfahrung produzieren. [Kant behauptet natürlich nicht, dass aus bloßen sinnlichen Eindrücken bereits Erfahrung entsteht – dann wäre sein entsprechendes System, selbst von seinem eigenen Standpunkt aus, überflüssig. Kant behauptet vielmehr, dass zur Erfahrung, nebst den empirischen Sinnesein-drücken, stets eine subjektive, apriorische, aktive Leistung (Verstandeskate-gorien und reinen Formen der sinnlichen Anschauung) absolut erforderlich ist.] Es ist offensichtlich konsistent mit dieser Bestreitung, ja sogar von ihr gefor-dert, daß auch geleugnet wird, daß die physikalischen Gegenstände der Wissen-schaft jene Gegenstände sind , die uns als Dinge an sich affizieren, indem sie sinnliche Erfahrung hervorrufen. Indem Kant das gesamte raumzeitliche System des natürlichen Universums der rezeptiven Verfassung des Subjektes der Erfah-rung zuschreibt, indem er das gesamte natürliche Universum zur bloßen Erscheinung erklärt, ist er in der Lage, seine Bestreitungen formell mit dem gemeinsamen Ausgangspunkt für die Anwendung des Kontrastes zwischen Dingen an sich und Erscheinungen auszusöhnen, den er mit dem wissenschaft-lich gesonnenen Philosophen teilt. Aber der Preis für diese formale Aussöhnung ist hoch. Denn die resultierende Transposition der Terminologie von Gegen-ständen, die die Konstitution des Subjekts ‚affizieren’, nimmt diese Terminolo-gie völlig aus dem Bereich verständlicher Anwendung, dem Bereich von Raum und Zeit, heraus. Die Lehre, daß wir der Dinge nur gewahr werden, wie sie er-scheinen, und nicht, wie sie an sich selbst sind, weil ihre Erscheinungen Resul-tat dessen sind, daß unsere Konstitution von den Dingen affiziert wird, können wir nur solange verstehen, wie ‚Affizieren’ als etwas gedacht wird, was in Raum und Zeit geschieht; aber wenn hinzugefügt wird, daß wir Raum und Zeit selbst als nichts anderes als unsere Fähigkeit oder Neigung verstehen müssen, auf gewisse Weise von Dingen affiziert zu werden, die selber nicht in Raum und Zeit sind, dann können wir diese Lehre nicht länger verstehen. Denn wir wissen dann nicht mehr, was ‚affizieren’ meint oder was wir unter ‚uns selbst’ verste-hen sollen.“ (P. F. Strawson, Die Grenzen des Sinns, Verlag Anton Hain, 1981, Seite 33-4 – Titel der englischen Originalausgabe: THE BOUNDS OF SENSE, 1966.)
Bestimmt wird der soeben zitierte Gedankengang durch folgende kurze Aussage, die Peter Strawson auf Seite 32 seines soeben erwähnten Werkes trifft:
“Die Weise, in der Gegenstände erscheinen, und welche Charakteristika sie zu haben scheinen, hängt zum Teil von der Konstitution des Wesens ab, dem sie erscheinen. Wo diese Konstitution verschieden ist, mögen dieselben Dinge verschieden erscheinen. Diese Tatsachen waren für viele Philosophen, z. B. Locke und Lord Russel, gute Gründe dafür, zu bestreiten, daß wir uns in der Wahrnehmung der Dinge so bewußt sind, wie sie wirklich sind oder wie sie an sich sind. Beispielsweise scheinen Gegenstände farbig zu sein, aber, so wird behauptet, sie sind nicht wirklich farbig; tatsächlich ist es so, daß Gegenstände gewisse physikalische Eigenschaften haben [...].“ (P. Strawson, siehe oben)
Das ist grundfalsch! O. Höffe würde das zumindest vehement bestreiten (→ S. 186-8). Unsere Erfahrung wird nicht durch unsere Struktur, Konstitution oder subjektive Leistung beeinflusst. Die individuelle Konstitution hat zugegebener-maßen erheblichen quantitativen -, jedoch definitiv keinen qualitativen Einfluss.
Zu Seite 24: Kant differenziert gelegentlich z. B. zwischen “a priori“ und “völlig a priori“, zwischen “rein“ und “schlechthin rein“ (KrV B24/A11), oder zwischen “a priori“ und “gänzlich a priori“ (KrV B2). Siehe dazu auch Vaihinger, H. Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, 2. Aufl. 1922, Scientia Verlag 1970, insbesondere die Seiten 184-95, 451-56. Erwähnter Herr Vaihinger sieht 4 verschiedene Bedeutungen des bei Kant mehr oder weniger (zu “a priori“) identischen Begriffs “rein“, ferner 3 verschiedene Bedeutungen des Begriffs der “Vernunft“. Solche rein deffinitionsgemäß bereits erheblich problematische Formulierungen finden in unserer Diskussion hingegen keine Berücksichtigung, ausgenommen z. B. “Objektivität“ und “empirisch“.
Zu den Seiten 156, 192-3, 209, ferner zu S. 81, 85: Kant ist evident der Meinung, dass er keine direkten äußerlichen Befehle braucht, sondern lediglich “rohen Stoff“ – die jeweiligen Anordnungen obliegen vollständig den subjek-tiven Bedingungen (d. M. d. E.). Aber das ist ungenügend, ihm fehlt hier definitiv eine dritte Komponente.
“Roher Stoff“ präsentiert in diesem Zsh. Allgemeinheit par excellence.
Subjektive Bedingungen d. M. d. E. sind indes nicht minder allgemein.
Wie also kommt Kant zum Individuellen? Über die empirische Anschauung? Wo genau aber sollte Letztere zum Einzelnen anknüpfen, wenn sich zu beiden Seiten lediglich Allgemeinheit anbietet?
Kant würde hier einwenden: ein Bäcker kann sehr wohl mittels “rohem Teig“ und seiner Phantasie Plätzchen formen. – Freilich kann er das, aber nicht bloß mit Teig und Phantasie! Er braucht zusätzlich eine Beziehung zu realer äußerer Einzelheit, die ihm an sich weder Teig noch Phantasie, weder roher Stoff noch Bedingungen d. M. d. E. ersetzen können (→ u. a. S. 176-81).
“Das Allgemeine Niveau des rohen Stoffs, wie eben auch der rein inneren Potentialität bieten an sich keine bestimmten Reize, somit auch keine bestimmten Handlungsanreize! Woher sollte daher mit Kant der Antrieb entstehen z. B. nach links oder rechts zu sehen oder überhaupt zu handeln (→ S. 156)?
Beilage 3 [= Anhang III, Original S. 350-2]
Zwei Emails seien hier zitiert, die u. a. das bis zum gegenwärtigen Stand: 18. Mai 2008, typische, schlicht umwerfende fachliche Interesse zur Entwicklung unserer Kant-Arbeit widerspiegelt. Lobend sei erwähnt, dass sich die Universität Köln immerhin, wenn auch nicht unaufgefordert, zu einer Antwort herabließ – andere Universitäten, z. B. Tübingen, waren da weniger großzügig.
Anfrage, per Email, 16.08.2006:
“Sehr geehrte Damen und Herren der Philosophischen Abteilung der Universität Köln,
Anfang Juni hatte ich Ihrer Abteilung eine Kant Dissertation (Gegenthese zu Kants Erkenntnistheorie) im Zusammenhang eines meinerseits eventuell angestrebten Masters-Programms gesendet (Post). Leider bekam ich diesbezüglich bis zur Zeit keinerlei Antwort.
Mit freundlichem Gruß
[...]“
Antwort, per Email, 21.08.2006:
“Sehr geehrter Herr [...] Hier ist gegen Semesterende ein Text auf meinem Schreibtisch gelandet, worin ein, wie es darin hieß, "informeller" Versuch einer "Widerlegung" gewisser Kantischer Thesen im Zusammenhang mit der Deduktion der Kategorien unternommen wurde. Der Text war von jemandem, der irgendwo in England, wenn ich mich recht erinnere, einen Bachelor-Abschluss erworben hat und fragt, ob sich die entsprechende Arbeit für ein weiterführendes Studium eignet. Sollte das Ihre Anfrage gewesen sein, will ich gleich dazu Stellung nehmen. Falls nicht, betrachten Sie das Folgende bitte als Gegenstandslos. Vorausgeschickt sei, dass dies nach unseren Begriffen nicht einmal ansatzweise ein Dissertation war, aber dies ist nur ein Begrifflicher Unterschied zu den angelsächsischen Gewohnheiten. Der Text, der mir vorgelegt wurde, und den ich flüchtig angeschaut habe, hat nicht nur den Mangel, dass er "informell" ist. Der Mangel besteht insbesondere darin, dass er auf einem dramatischen Missverständnis der Art und Weise, wie die reinen Verstandesbegriffe mit der synthetischen Einheit der transzendentalen Apperzeption zusammenhängen, beruht. Die Thesen, die darin Kant "widerlegen" sollen, sind alle bloß ein Zeugnis zahlreicher Missverständnisse. Formulierungen, wie jene, dass die Kant-Forschung bestimmte Gedankengänge, die in diesem Text formuliert werden, "ignoriert hätte", sind lächerlich. Das gesamte Unternehmen zeugt insbesondere von mangelnder Sachkenntnis und von Vermessenheit. In Bezug auf die Frage, ob sich dies für ein weiterführendes Studium eignet, will ich folgendes sagen: Die formalen Bedingungen für ein Studium unseres Faches sind die allgemeine Hochschulreife und die Immatrikulation an der Universität zu Köln. Sofern sie bisher bereits Leistungen im Fach Philosophie im Ausland erbracht haben, erkennen wir diese selbstverständlich an und sie können das Studium entsprechend weiterführen. Sollte aber Ihre Anfrage eine Stellungnahme in Bezug auf Ihre "Gegenthese" zu Kants Philosophie beabsichtigt haben, seien Sie versichert, dass eine gründliche Auseinandersetzung mit Kant eine tragfähigere Grundlage für ein weiterführendes Studium darstellt als unreflektierte Kritik. Sofern sie den Gedanken verfolgen wollen, rate ich Ihnen , sich mit §16 der B-Deduktion auseinanderzusetzen und nachzuvollziehen, was es mit dem "Ich denke" hier auf sich hat. In der vorgelegten Gestalt waren die Thesen, die auf meinem Tisch gelandet sind, nicht ausreichend für beispielsweise einen Leistungsnachweis im Grundstudium. Ich hätte Ihnen dafür eine 5 im Grundstudium gegeben. Auch würde es mich wundern, wenn jemand anders Ihnen dafür eine bessere Note gegeben haben sollte. Das Schreiben ist vernichtet worden, daher ist es ausgeschlossen, dass es in die Hände Dritter gelangt und eventuell missbraucht wird. Soviel in aller Kürze Mit freundlichen Grüßen [...] ------------------------ Dr. des. [...] Geschäftsführender Assistent Philosophisches Seminar Universität zu Köln Albertus-Magnus-Platz 50923 Köln Tel.: [...]“
Nun, dem könnte man, nicht zuletzt was das erwähnte Lächerliche in unserer Haltung zur Kant-Forschung betrifft, immerhin z. B. das Folgende entgegenhalten:
“,Ich glaube nicht, daß ein Mensch sich rühmen kann, diese Gedanken wirklich zu verstehen, d. h. denken zu können’. Mit diesem Satz verkündet Paulsen [.] im Jahre 1892 die allgemeine Kapitulation der Kant-Forschung vor der Aufgabe, Kants Theorie des Wahrnehmungsurteils zu verstehen. Doch nicht nur das. Die Lage erscheint ihm so hoffnungslos, daß seine Stimmung gleichsam wieder umschlägt und er sich dazu berechtigt fühlt, diese Verkündung in einer Weise abzufassen, daß sie geradezu darauf hinausläuft, die vorangegangenen Niederlagen [.] und damit auch diese Kapitulation selbst nicht nur zu rechtfertigen, sondern recht eigentlich als Siege zu werten. Ganz deutlich läßt er darin durchblicken, daß es sich dabei nur scheinbar um ein Versagen der Kant-Forschung, in Wahrheit jedoch um ein Versagen von Kant selber handle. Denn wie sollte wohl diese Forschung verstehen, was gar nicht zu verstehen ist? Die Forschung hat eigentlich gar nicht verloren, sondern eher gewonnen, nämlich Einblick in die Unmöglichkeit dieser ganzen Theorie.
Mag nun dieser Satz von Paulsen als Kennzeichnung der damaligen Situation der Kant-Forschung auch seine volle Berechtigung besitzen, so tritt er doch zugleich als eine Art Voraussage für alle Zukunft auf, die man nur als eine außerordentliche Kühnheit werten kann. Mit eben dieser seiner Kühnheit aber wird er anderseits gerade zum Maßstab, an dem sich das ganze Ausmaß der Schwierigkeit ermessen läßt, die diese Theorie des Wahrnehmungsurteils der Kant-Forschung nach wie vor bereitet. Denn wie kühn auch immer, – dieser Satz ist bis heute unwiderlegt. Bis heute ist es nicht gelungen, der Unterscheidung zwischen Erfahrungs- und Wahrnehmungsurteilen, die Kant in den Prolegomena trifft, und insbesondere seiner Theorie des Wahrnehmungs-urteils, die er dabei zu entwickeln sucht, einen vernünftigen Sinn abzugewinnen. [Seite 139-0] [...]
Nicht Kant, sondern die Kant-Forschung hat bezüglich dieser Theorie nun schon beinahe zwei Jahrhunderte versagt. [Seite 141] [...]
Da diese Theorie jedoch bei Kant nur im Ansatz vorliegt, dem keine eigentliche Durchführung mehr folgt, stößt dieses Vorhaben freilich auf Schwierigkeiten, die nur durch ein Verfahren zu beheben sind, das bereits Kant selbst nicht nur charakterisiert, sondern ausdrücklich auch legitimiert hat. Dieses Vorhaben erfordert, Kant in einem eminenten Maße ‚besser zu verstehen, als er sich selbst verstand’ [KrV A314/B370].“ [Seite 141] (Gerold
Prauss, Erscheinung bei Kant, Ein Problem der „Kritik der reinen Vernunft“, 1971, d. Seiten: 139-41, unter: Kapitel II, §9. Die Problematik des Wahrnehmungsurteils)
Was die in diesem Zsh. kurz erwähnte “Masters-Ambitionen“ betrifft: zugegeben, die wahren meinerseits ein wenig halbherzig und sicherlich schon rein formal – sagen wir – sehr ungewöhnlich. Ich wollte auf diesem Wege vor allem mit meinen Ideen zu Kant irgendwie ins Geschäft kommen – zusätzlich ein Masters so nebenbei – warum nicht? Aber es hat wohl nicht sollen sein. Vielleicht gilt in diesem Zsh. auch:
“Einen neuen Schritt, einen neuen Gedanken fürchten sie mehr als alles andere . . . “ (Dostojewskij, Schuld und Sühne, 1866, Seite 6)
Beilage 4 [= Original S. 446-7]
Ein überaus penibles Stochern im Makrobereich – nicht nur bezüg-lich der Politik – ist relativ müßig, sind wir uns doch im Mikrobereich, und hier wäre natürlich die Physik zu nennen, alles andere als sicher.
So existieren in der Physik gegenwärtig zwei allgemein sehr ge-achtete Theorien, die jede für sich zu stimmen scheint und doch widersprechen sich beide, Quantenmechanik und Relativitätstheorie, in kaum zu überbietendem Maße.
Ohnehin, Welle oder Teilchen – welchen Charakter hat nun letztlich der Mikrokosmos? Die Antwort fällt je nach Theorie verschieden aus – fällt extrem verschieden aus – so verschieden wie Licht und Finsternis, wie Tag und Nacht. Das ist aus unserer Sicht nicht sonderlich überraschend. Denn im Mikrokosmos handelt es sich im Grunde um absolut ideale Aspekte. Da wir das Ideal, zumindest im Sinne unserer zurückliegenden Diskussion, grundsätzlich nicht erfassen können, ist es so gesehen ganz natürlich, dass die Physik exakt bezüglich der elementarsten Dinge nicht wirklich vorankommt und sich explizit in jenem Bereich die absurdesten Widersprüche finden.
Dem Elektron wird als (sehr wörtlich zu nehmendes) kleines Bei-spiel einerseits räumliche Ausdehnung abgesprochen – nimmt man je-doch ein elektrisch geladenes Teilchen an, das keine räumliche Aus-dehnung hat, so ergeben sich selbst aus unendlich geringer gleichge-richteter elektrischer Ladung eine unendliche Kraft, die bestrebt wäre, jenes räumlich praktisch nicht existierende Elektron auseinander zu reißen und damit in die räumliche Realität hineinzuzwingen. Ohnehin ist die Vorstellung von elementaren Teilchen, die sich nicht weiter teilen lassen unmöglich. Denn jede Vorstellung ist räumlich und alles Räumliche hat eine räumliche Ausdehnung. – hat ein Links, ein Rechts und eine Mitte. Jede Vorstellung hat folglich mindestens den Kontrast Links zu Rechts. Jeder absolute Begriff für sich gesehen ist für den menschlichen Geist nicht erkennbar, weil ihm jeglicher Kontrast fehlt.
Wir können Differenzen erkennen und sie mit unseren eigenen Prädispositionen in gewisse Verhältnisse setzen. Mit einzelnen idealen Dingen an sich (wie auch mit einer relativ geschlossenen Kette einzelner Ideale) kann unser Geist jedoch nichts anfangen, weil in diesem Falle das Subjektive keinen emotionalen Einstieg in das Objektive findet (→ u. a. S. 170, u. [im Original zusätzl. die Seiten: 199-01, 215]).
Die Widersprüchlichkeit zwischen Quantenmechanik und Relativi-tätstheorie ist also wohl unvermeidlich – ist direkt eine Bestätigung unserer sehr eigenwilligen Ausführungen zum Ideal im absoluten Sinne. Eine Ver-einigung beider Theorien, etwa durch eine Feldtheorie oder eine alles umfassende Weltformel, wie Einstein, Heisenberg und viele andere erfolglos versucht haben, ist aus unserer Sicht prinzipiell unmöglich.
Entsprechende gegenwärtige Bemühungen z. B. die sogenannte Stringtheorie, zielen im Grunde alle darauf ab Kontraste ohne Kontrast zu erklären – vorneweg eitles Unterfangen.
Bewusstsein benötigt vor allem zwei Dinge: Subjekt und Objekt, bzw. Anreiz und Ziel. Dem Objektiven mangelt es im Vergleich zum Subjektiven an Motivation, dem Subjektiven mangelt es hingegen an Orientierung. Ein Ideal an sich ergibt noch keine Orientierung.
Das Subjektive benötigt demnach gleichzeitig verschiedene Ideale die sich als Orientierung sodann nutzen ließen – das Manko dabei ist: einzelne Universalien, Ideale, absolute Dinge an sich sind unserem Geiste generell verschlossen – nicht weil wir die Welt lediglich indirekt über unsere Struktur erfahren, sondern weil ein Ideal definitionsgemäß ein abgeschlossenes und kein offenes Spiel darstellt. Absolut wahr wird die Welt uns in dem Moment wo sie uns emotional nichts mehr bedeutet. Das zeigt sich vor allem an den Begriffen des Unendlichen, des absoluten Seins wie des Nicht-Seins, Gott, usw.
“[...] der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Un-sterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, [...]“
(Die Bibel, 1.Timotheus 6, 15-6)
Eine Vorstellung absolut nicht mehr zu existieren ist ebenso unmög-lich, wie sich seiner selbst vollends bewusst zu sein. Wir können uns alle möglichen realen/imaginären Gegenstände vorstellen, vorausgesetzt es handelt sich dabei grundsätzlich um zusammengesetzte Aspekte und nicht um irgendeinen einzelnen für sich selbst gesehen, d. h. nicht ohne direkten oder indirekten Vergleich. Eine unendliche Größe ist, z. B. ein absoluter Begriff, der sich nicht aus einem Kontrast ableiten lässt und sich also unserem Vorstellungsvermögen generell entzieht, gleichfalls: unendlich großer Kosmos, Unendlichkeit generell, Alles, Nichts ... (→ u. a. zu S. 168, u. – 170, u. [Original auch: – 208 – 269, o. – 283, u. – 294-6 – 313, u. – 384, u.]).
Dennoch ist unsere Welt, insbesondere entgegen Kant, im Grunde so wie wir sie sehen – sie ist kein Mischmasch zwischen Objektivität und Subjektivität. D. h. das Objektive des Objekts bleibt auch im subjektiven Bewusstsein objektiv – es wird jedenfalls nicht subjektiviert aufgrund der Tatsache, dass es subjektiv zur Bewusstseinsbildung mittels subjektiver Gegebenheiten genutzt wird.
Denn ein Vergleich ist an sich eine un körperliche Leistung auf die körperliche Dimensionen keinen qualitativen Einfluss haben können.
[...]
Zusammenfassung
Kant sucht bewusst den Kompromiss zwischen Empirismus und Rationalismus, zwischen Realismus/Materialismus und klassischem Idealismus und ist bestrebt Skeptikern möglichst allen Wind zu nehmen.
Damit ist er vorneweg dem absolut Realen wie auch dem subjektiv Ideellen verpflichtet: Absolute Realität existiert, vertreten durch sogenannte Dinge an sich selbst, und das unabhängig von eventuellen Bewusstseinszuständen. Lebende Individuen, Menschen, Tiere ... können die Realität erleben, aber nicht in ihrer tatsächlichen absoluten Gestalt. Denn Bewusstsein ist grundsätzlich bedingt, nebst etlicher praktischer Kriterien, vor allem durch apriorische subjektiv-gesetzliche Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung (Anschauungen und Kategorien). Dinge an sich selbst der äußeren realen Welt affizieren unsere Sinne und liefern rohen Stoff, der mittels entsprechender subjektiver Gesetzlichkeit geordnet, geformt und schließlich zu konkreten Bewusstseinsinhalten gestaltet wird.
Kant leistet sich in diesem Zuge einen unglaublich simplen wie katastrophalen Fehler: Gesetze sind keine Motoren, die sich mit “rohem Stoff“, d. h. Treibstoff, bzw. Energie begnügen könnten. Vielmehr bedürfen sie bestimmter Werte, Fakten, Faktoren ... Kant aber füttert ein Gesetz wie das andere just mit “rohem Stoff“. Die erwähnten notwendigen Fakten gewinnt er scheinbar exakt über die Gesetze, die jene Fakten bedürfen – gleich mehrfache äußerst grobe Verletzung entscheidender gesetzlicher Wesenszüge!
Parallel dazu unterläuft dem Königsberger ein weiterer ebenso simpler wie fataler Fehler: etwas zu ordnen, bedingt selbstverständlich, dass zum einen der zu ordnende Aspekt existiert, zum anderen, dass Letzterer an sich bereits Elemente enthält, die der Grundordnung des ordnenden Mediums entsprechen. Für Kant ist dies offenbar jedoch nicht selbstverständlich – er kehrt dieses Naturprinzip um: er ordnet etwas, das noch gar nicht existiert – etwas, das erst über den Akt der Ordnung erschaffen wird – eine Perversion der Logik!
Oberbegriffe verlangen eine gewisse grundsätzliche Wesensgleich-heit zu ihren Elementen. Zufall hat keine Argumente zur Ordnung:
Kant zwingt indes erwähnten “rohen Stoff“ völlig willkürlich unter ganz bestimmte Oberbegriffe der subjektiven gesetzlichen Ordnung, obgleich jener “rohe Stoff“ absolut nichts mit jenen Oberbegriffen (Universalien, gesetzliche Begriffe oder Gesetze überhaupt) gemein hat – zwingt somit das Allgemeine der apriorischen Fülle des Ganzen mit völlig unwesentlichen fremden Elementen völlig grundlos zum bestimmten Einzelfall des Individuellen.
Dies alles ist nicht zuletzt unmittelbare Folge Kants schwerwiegen-der Überdeutung, bzw. fälschlicher Pauschalisierung des Begriffs der Bedingung, im weitesten Sinne eine grobe Überschreitung des Energie-Erhaltungssatzes und eine Missachtung jeweiliger Wechselwirkungen.
Fixe Bedingungen zur Ermöglichung der Erfahrung, wie Gesetze generell, sind keine Generatoren, sie sind bestenfalls brauchbare Transformatoren, sie sind Mittel zum Zweck, sie haben eine Alles-oder-Nichts-Funktion, ohne positiven inhaltlichen Einfluss.
Kant täuscht mit dem Begriff transzendent, mit gigantischer Theorie, mit zahllosen Widersprüchen, vor allem mit maßloser Überdeutung des Begriffs der Bedingung über die Tatsache hinweg, dass er, gleich allen Idealisten, keine gültige Handhabe hat, den Schritt vom Allgemeinen zum Einzelnen zu vollziehen.
Das Empirische ist bei Kant absolut subjektiv bedingt und dennoch mogelt der Königsberger letztlich das Empirische genau an jenen subjektiven absoluten Gegebenheiten vorbei, ganz wie er die Natur allgemein subjektiv unterwirft – jene Natur, die doch augenfällig völlig frei von jener Subjektivität alles Leben bedingt.
Begriffe bezieht Kant auf das Allgemeine, die Anschauung auf das Einzelne, eine offenbar perfekte Ergänzung des einen zum anderen. Dabei bleibt jedoch ungeklärt, wie die Anschauung das Einzelne reprä-sentieren sollte – in reiner Form ist sie immerhin notwendig-allgemein. Empirische Form, falls sie das Einzelne trifft, ist abhängig von Erfahrung, somit abhängig von apriorischen allgemeinen subjektiven Bedingungen d. M. d. E. einerseits und “rohem Stoff“ der affizierenden Dinge a. s. s. andererseits. Das befriedigt nicht einmal Kant selbst, jedenfalls sichert er das Einzelne bedenkenlos mit einer ganzen Serie quantitativer allgemeiner Kategorien (Einheit, Vielheit, Allheit).
Kant erzwingt das Individuelle über das Gesetzliche, damit entledigt er sich zunächst der für ihn höchst peinlichen Frage, das Einzelne vom Ganzen abzuleiten. Somit hebt er jedoch die eigentliche Bedeutung des Individuellen und Allgemeinen völlig aus den Angeln. Beide ver-schmelzen zum Alles-Allgemeinen-Gesetzlichen – ein in sich gänzlich geschlossenes apriorisches System – eine rein innere ideelle Angele-genheit, die alles bietet, alles kann und letztlich doch leer bleibt: Können ist noch kein hinreichender Grund zum Handeln – d. h. Kant braucht mehr als bloßes Vermögen, er braucht äußere Befehle. Äußerlich steht aber nur zufälliges, völlig unbestimmtes “etwas“ zur Verfügung. Dem-nach muss der Verstand bei Kant in der Lage sein, ziel- und geistloses Äußere als geordnete intelligente Befehle aufzufassen, womit er allerdings sich selbst zuvorkommt. Offiziell erklärt Kant Intelligenz als Ergebnis – tatsächlich aber setzt er sie jenem Ergebnis voraus, da er un bestimmten rohen Stoff quasi als bestimmte äußere Befehle einsetzt.
Der Verstand ist bei Kant in der Lage, sinnlosem Zufall Geist abzuverlangen, den jener Zufall hätte, wäre er sinnvoll.
Das unbestimmte “etwas“ wird geformt durch den Verstand nach äußeren Befehlen, die jenes “etwas“ hätte, wäre es geformt.
Der Verstand nimmt also evident seine eigene Handlung vorweg, indem er unbestimmtes “etwas“ als direkten Befehl akzeptiert, exakt den Akt, den die nachfolgende Verstandes-Handlung erst noch zustande bringen muss. Das kann insgesamt nur bedeuten, dass der angeblich rohe unbestimmte äußere Stoff bereits Ordnung enthält!
Erfahrung ist qualitativ zwangsläufig unabhängig von der Weise wie sie zustande kommt – andernfalls wäre sie dynamisch, womit die Ob-jekte unserer Erscheinungen buchstäblich ihren Gründen, den Dingen an sich selbst, davonlaufen würden. Zudem ergäbe dies, dass neue Dinge an sich selbst über jenen strukturellen Einfluss geschaffen würden.
Wir erleben die Welt lediglich bedingt und daher nicht direkt. Daraus ziehen, über Kant hinaus, Skeptiker generell die Konsequenz, dass wir sie, und alles, ganz anders empfinden würden, wären wir nicht auf unsere Bedingungen, die uns Erfahrung überhaupt ermöglichen, angewiesen.
Alle jene Skeptiker übersehen indes, dass fixe Bedingungen grund-sätzlich im Grenzbereich agieren, der den Rand einer Sache betrifft aber nicht dessen eigentlichen inhaltlichen Kern. Ihr fragwürdiger Einfluss ist allenfalls negativer Natur, vergleichbar mit der Funktion ei-nes Filters. Abhängigkeitsverhältnisse dieser Art beziehen sich auf die äußere Hülle eines jeweils abhängigen Umstands, der eigentliche Inhalt des Bedingten bleibt davon völlig unberührt. Eine echte kreative Bedingung mit positivem Einfluss auf das Abhängige wird notwen-digerweise selbst Teil des Letzteren und verliert sodann zwangsläufig ihren fixen rein logisch-formalen Charakter – eben jenen Charakter, den Kant für seine Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung fordert.
Wenn aber Bedingungen (d. M. d. E.) letztlich reine Grenz- und keine Wesensangelegenheiten sind, spielt der Fakt, dass wir die Umge-bung lediglich bedingt erleben im Grunde überhaupt keine erkenntnis-theoretische Rolle mehr, womit allen Idealisten und Skeptikern mit einem Schlag einiger Boden zu ihren unseligen wie unnötigen, reali-tätsfremden wie gottlosen Spekulationen entzogen wäre! Ohnehin:
Überleben und Erfolg zwingen zu Reaktionen, die der Umgebung angemessen sind. Wie aber sollten wir angemessen reagieren können, bliebe uns, im Sinne Kants, die Sicht durch vorgeschobene notwendige subjektive Bedingungen (d. M. d. E.) zum wahren Wesen der Welt – zu den Dingen an sich selbst – prinzipiell verborgen?
Somit ist einigermaßen gewiss: die Raumfahrt z. B. anhand der Was-serstands-Pegel des Rheins zu berechnen [S. 4] bleibt vorerst Utopie.
Literatur
Kant, I. Kritik der reinen Vernunft, Studienausgabe nach der ersten (1781) und zweiten (1787) Originalausgabe, Felix Meiner Verlag Hamburg 1998, ISBN 3-7873-1319-2
Kant, I. Prolegomena, 1783, 1989 Reclam, Stuttgard, 2005, ISBN 3-15-002468-4
Adickes, E. Kant und das Ding an sich, 1924, Georg Olms Verl. 1977
Aschenbrenner, K. A Companion to Kants Critique of Pure Reason,
University Press of America 1983, Lanham, New York, London
Baumgartner, H. M. Kants „Kritik der reinen Vernunft“, 1985, Verlag
Karl Alber, ISBN 3-495-47564-8
Berkeley, G. A Treatise Concerning the Principles of Human
Knowledge, 1710, – hier zitiert aus: Philosophical Works,
Everyman’s Library 1975, reprinted 1985, ISBN 0-460-11483-2
Brysz, S. Das Ding an sich und die empirische Anschauung in
Kants Philosophie, 1913, Georg Olms Verlag 1981
Buchenau, A . Grundprobleme der Kritik der reinen Vernunft,
Felix Meiner Verlag, 1914
Brunner, A. Kant und die Wirklichkeit des Geisten, Johannes
Berchmans Verlag, 1978
Caimi, M .P. M. Kants Lehre von der Empfindung in der Kritik der
reinen Vernunft, Bouvier Verlag, Bonn 1982, ISBN 3-416-01687-4
Cohen, M. Philosophy Problems, Routledge, London, 1999, second
edition 2002, ISBN 0-415-26129-5
Copi, M./Cohen, C. Introduction to Logic, prentice-hall, 11th ed. 2002,
ISBN 0-13-033735-8
Descartes, R . Meditations on First Philosophy, 1641, translated by John
Cottingham, Cambridge Unversity Press 1986, repr. 1994, ISBN 0-521-33857-3
Fröhlich, W. D. Wörterbuch Psychologie, Deutscher Taschenbuch Ver-
lag, München, 1. Aufl. 1968, 24. Aufl. 2002, ISBN 3-423-32514-3
Gardner, S. Kant and the Critique of Pure Reason, Routledge, 1999
ISBN 0-415-11909-X
Gleitman H./ Fridlund A. J./ Reisberg, D. Psychology, W. W. Norton &
Company, New York · London, 5th edition, 1999, ISBN 0-393-97364-6
Hilgard, E. R./Atkinson, R. C., Introduction to Psychology,
Harcourt, Brace & World, 4th edition, 1967
Höffe, O. Kants Kritik der reinen Vernunft, Verlag C. H. Beck,
München 2003, 4. Auflage 2004, ISBN 3 406 50919 3
Hume, D. A Treatise of Human Nature, 1740
Hume, D. Enquiries, 1748
Kusch, L. Mathematik für Schule und Beruf, 8. Aufl. 1969, Verlag
W. Girardet, Essen
Lacey, A.R. A Dictionary of Philosophy, Routledge, London (first
published 1976) second edition 1986, ISBN 0-7102-1003-5
Lange, H. Kants modus ponens, Verlag Königshausen, 1988
Magee, B. The Philosophy of Schopenhauer, Clarendon Press, Oxford 1983
Prauss, G. Einführung in die Erkenntnistheorie, 1980, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, Darmstadt, 3. Aufl. 1993, ISBN 3-534-07256-1
Prauss, G. Erscheinung bei Kant, Ein Problem der „Kritik der reinen
Vernunft“, Walter de Gruyter & Co. Berlin 1971
Ratke, H. Systematisches Handlexikon zu Kants Kritik der reinen Vernunft ,
Unveränderter Nachdruck 1965 der ersten Aufl. 1929, Felix Meiner Verlag
Röd, W. Der Weg der Philosophie, Band II, Verlag C.H. Beck, Mün-
chen 1996, ISBN 3-406-45931-5
Römpp, G. Kant leicht gemacht, Böhlau Verlag, Köln 2005,
ISBN 3-8252-2707-3
Schnädelbach, H. Erkenntnistheorie zur Einführung, Junius Verlag,
2. korr. Aufl. 2004, ISBN 3-88506-368-9
Störig, H. J. Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Fischer Taschenbuch
Verlag, Frankfurt a. M. 1999, 4. Aufl. 2003, ISBN 3-596-14432-9
Strawson, P. F. Die Grenzen des Sinns, Verlag Anton Hain 1981,
(engl. Original: THE BOUNDS OF SENS, 1966)
Ulfig, A. LEXIKON DER PHILOSOPHISCHEN BEGRIFFE, Fourier
Verlag Wiesbaden, Lizenzausgabe mit Genehmigung d. Meco
Verlags, 1. Aufl. 1997, © Meco Verlag, ISBN 3-925037-88-8
Vaihinger, H. Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft,
2. Auflage 1922, Scientia Verlag 1970
Probleme der „Kritik der reinen Vernunft“, Kant-Tagung Marburg 1981,
Hrsg: B. Tuschling, Walter de Gruyter, Berlin 1984, ISBN 3-11-008939-4
Romane
Dostojewskij, F. M . Schuld und Sühne, 1866, Eduard Kaiser Verlag
(Jahr: ?), zeitgemäß bearbeitet, Buchausstattung Karl Bauer
Surminski, A. Am dunklen Ende des Regenbogens, (1988), Rowohlt
1990, 880-ISBN 3499 12605 2
Religion
Die Bibel , oder die ganze Heilige Schrift, nach der dt. Übersetzung D. Martin
Luthers, Privileg. Würtemb. Bibelanstalt, Stuttgard, Jubiläums-Bibel 1927
Parzany, U. Bitte stolpern! Aussaat Verlag 1971, 8. Auflage 1987
ISBN: 3-7615-3213-X
Lexika, Lehr-, Wörterbücher
Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Band 2, Meiner Verlag 1990, ISBN 3-7873-0983-7
Handwörterbuch Philosophie, © 2003 Vandenhoeck & Ruprecht, UTB, Göttingen, ISBN 3-8252-8208-2
HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE, Band 1: A-C, Lizenzausgabe nur für die Mitglieder der wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt, © 1971 by Schwabe & Co. Basel
Lexikon der Erkenntnistheorie und Metaphysik, Verlag C. H. Beck München 1984, Hrsg: Friedo Ricken, ISBN 3406092888
METZLER PHILOSOPHIE LEXIKON, Begriffe und Definitionen 2. Aufl. 1999, J. B. Metzlersche Verlagsbuchh. Stuttgart, ISBN 3-476-01679-x
Philosophisches Wörterbuch, © 1991 by Alfred Kröner Verlag, 22. Aufl. Stuttgart 1991, ISBN 3-520-01322-3
PHILOSOPHISCHES WÖRTERBUCH, Band 1, A-K, © VEB Verlag Enzyklpädie Leipzig, 1964, 1974, Lizenzausgabe, 12 Aufl. 1976, Gesamtleitung und Redaktion: Manfred Buhr, ISBN 3-920303-35-0
PHILOSOPHISCHES WÖRTERBUCH, Band 2, L-Z, © VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1964, 1974, Lizenzausgabe, 12. Aufl. 1976, Gesamtleitung und Redaktion: Manfred Buhr, ISBN 3-920303-36-9
Schüler-Duden, Die Philosophie, © Bibliographisches Institut, Mannheim 1985, Redaktion: Dr. Rudolf Ohlig, ISBN 3-411-02206-X Wörterbuch der Philosophischen Begriffe, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2005, ISBN 3-7873-1761-9
DIE AKTUELLE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG VON A-Z, © Naumann & Göbel, Geleitwort: Prof. Dr. H. Zabel 1996, ISBN 3-625-10442-3 Die neue deutsche Rechtschreibung, © TANDEM VERLAG, ISBN 3-931923-282
INTERNATIONAL DICTIONARY of ENGLISH, © Cambridge University Press 1995, ISBN 0-521-48421-9
LEXIKON, (Lingen Lexikon in 20 Bänden), Lingen Verlag, vollständig
überarbeitete und erneuerte Ausgabe 1976/77, Köln, Band 2, Band 4
Internetbeiträge
Northoff, G. Neurophilosophie – ein neuer Ansatz in der Philosophie
http://sprache-werner.info/80_X-Neurophilosophie_ein_neuer_Ansatz2033.html
Pöltner, G. Philosophie der Erkenntnis, SS 1995
http://www.1theolexamen.de/vorpr/philo/Erkennt.pdf
Schiemann, G. Ohne Telos und Substanz, Grenzen des Naturwissenschaft-
lichen Kausalverständnisses, Humboldt-Universität zu Berlin
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Scie/ScieSchi.htm
Wikipedia der freien Enzyklopädie: Notwendige und hinreichende
Bedingungen – Wikipedia [Autor: unbekannt]
http://de.wikipedia.org/wiki/Hinreichende_Bedingung
Register
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dank: meinen Eltern
der Universität Siegen (für entliehene Literatur)
und allen zitierten Autoren
Abschlüsse des Autors:
Elektriker: 1976
Fremdsprachenkorrespondent: 1993
Wirtschaftsdolmetscher: 1993
BA degree phil : 2004 (England)
Eventuelle Kritik, Fragen, Anregungen, etc. zum Buch:
E-Mail: g.andreas@t-online.de
(Homepage in Vorbereitung)
An Gerken
eklatant, Herr Kant!
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Quote paper
- An Gerken (Author), 2009, eklatant, Herr Kant!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141294
Publish now - it's free



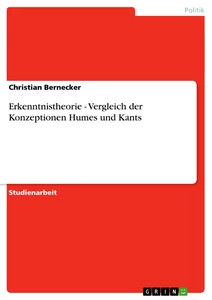



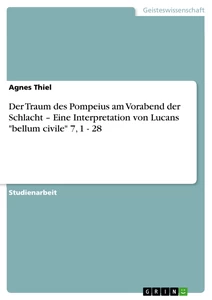




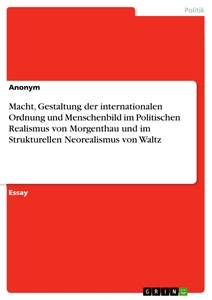
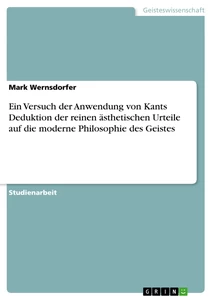








Comments