Excerpt
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Klärung des Familienbegriffs
3. Die Familie im historischen Wandel
3.1 Die traditionale Gesellschaft
3.2 Das traditionelle Modell der bürgerlichen Kleinfamilie
4. Der Wandel der Familie - deomografische Entwicklungen
4.1 Geburtenentwicklung
4.2. Eheschließungen
4.3 Scheidungen
5. Familiale Lebensformen
5.1 Ehepaare
5.2 Nichteheliche Lebensgemeinschaften
5.3 Alleinlebende
5.4 Alleinerziehende
5.5 Transnationale Familien
6. Individualisierung
6.1 Die Individualisierungsthese nach Ulrich Beck
6.2 Die veränderte Rolle der Frau
6.3 Inszenierung des Alltags
6.4 Stabilität der Familie - Ehe, Scheidung und Alternativen
6.5 Bedeutungsrelevanz der Liebe
7. Diskussion und Fazit
8. Literaturverzeichnis
9. Anhang
1. Einleitung
Seit einigen Jahrzehnten ist die Familie starken Wandlungsprozessen unterworfen. Wesentliche Veränderungen zeigen sich in den rückläufigen Eheschließungszahlen, den steigenden Scheidungsziffern und dem dramatischen Geburtenrückgang seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Zudem haben alternative Lebens- und Familienformen, wie nichteheliche Lebensgemeinschaften, an Bedeutung gewonnen.
Die Aussagen über den familialen Wandel sind kontrovers. Während die einen der Auffassung sind, die Familie befinde sich in der Krise und würde sich auflösen, behaupten andere sie sei eine Lebensform mit großer Kontinuität und Stabilität (vgl. Burkart 2008: 14). In der Forschung dominiert dabei der Ansatz der Individualisierung als Erklärung für den Wandel privater Lebensführung.
Ziel dieser Arbeit ist es daher zu beleuchten, ob angesichts der Individualisierungstendenzen von einer Auflösung der Familie die Rede sein kann.
Um einer angemessenen Analyse der Gegenwart von Familien gerecht zu werden, ist es vonnöten vorerst in die Vergangenheit zu blicken, denn wenn in Debatten vom „Wandel“ oder auch von der „Krise“ der Familie die Rede ist, so scheint es doch ein allgemein verbindliches Grundmuster familialen Zusammenlebens zu geben, welches sich allmählich aufzulösen beginnt. Daher soll zunächst ein kurzer Überblick über die einzelnen Epochen gegeben werden, angefangen von der traditionalen Gesellschaft der frühen Neuzeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, über die bürgerliche Kleinfamilie des Industriezeitalters bis hin zur modernen Familie der Gegenwart. Dabei werden die demographischen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte aufgezeigt und die familialen Lebensformen vorgestellt. Darauf hinzuweisen ist, dass sich die Ausführungen ausschließlich auf Deutschland beziehen werden. Daran anschließend wird auf die Individualisierungsthese von Ulrich Beck eingegangen. Es soll gezeigt werden, wie sich der Individualisierungsschub nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Familie ausgewirkt hat. Auch hier gilt, dass die Veränderungen die Bundesrepublik betreffen, auch wenn die Individualisierungstendenzen Beck zufolge in nahezu allen westlichen Industriegesellschaften zu erkennen sind. Es folgt eine abschließende Diskussion der Zielstellung mit Fazit.
2. Klärung des Familienbegriffs
So selbstverständlich wir den Familienbegriff im Alltag auch verwenden, so ist er in der deutschen Familienforschung aufgrund der Pluralität der Familienformen bis heute umstritten. Einige Autoren sprechen von „familialen Lebensformen“ oder auch von der „familialen Lebensgemeinschaft“ (vgl. Lenz 2003: 485).
Allgemeiner Konsens besteht allerdings in der Generationendifferenzierung, d.h. das Eltern- bzw. Mutter- oder Vater-Kind-Verhältnis ist entscheidendes Kriterium von Familie. Somit bilden alleinerziehende Mütter und Väter sowie auch nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern ebenfalls Familiensysteme (vgl. Nave-Herz 1994: 6). Handelt es sich um eine dieser Konstellationen, spricht man von der Kernfamilie, wobei sich die Generationendifferenz auch auf weitere Generationen, wie die Großeltern beziehen kann (Drei-Generationen-Familie).
Bedeutung kommt auch der Elternschaft zu, ist es doch verbreitet, Familie auf die biologische Elternschaft festzulegen. Jedoch zeigt die Familiengründung durch Adoption, in der die Eltern auch in einem Eltern-Kind-Verhältnis stehen, bereits, dass die Zeugung allein nicht konstitutiv ist (vgl. Lenz 2003: 489). Die Elternschaft kann auch rechtlich begründet sein und muss nicht identisch mit der biologischen Elternschaft sein. Wesentlich ist hierbei die staatliche Anerkennung - Mutter oder Vater müssen auch als diese registriert sein.
Neben biologischer und rechtlicher, kommt der sozialen Elternschaft Bedeutung zu. Durch die Geburt eines Kindes entsteht noch keine Familie, sondern erst, wenn zumindest eine Person eine Elter-Position1 für das Kind im Lebensalltag übernimmt. Sie beschreibt in erster Linie die Ausgestaltung der Beziehung zum Kind. Familie ist in dieser Hinsicht also durch die Folge von Generationen gekennzeichnet, die biologisch, sozial und/oder rechtlich miteinander verbunden sind.
Darauf hinzuweisen ist, dass Familie und Haushalt zu unterscheiden ist, da sich Familienbeziehungen auch über Haushaltsgrenzen hinweg erstrecken können. In diesem Sinn hat auch der Begriff der multilokalen Mehrgenerationenfamilie in der Familienforschung an Relevanz gewonnen (vgl. Lenz 2009: 78 f.), in der die verschiedenen Generationen zwar räumlich getrennt voneinander leben, aber weiterhin enge Interaktionsbeziehungen pflegen und durch eine besondere Verbundenheit und Solidarität gekennzeichnet sind.
3. Die Familie im historischen Wandel
3.1 Die traditionale Gesellschaft
Schon in der vorindustriellen Epoche zeigt sich in der Bevölkerung eine Vielfalt an Familienformen, die durch ihre Standesunterschiede gekennzeichnet ist (vgl. Burkart 2008: 116). Neben den Familien des europäischen Adels und den städtisch-bürgerlichen Familien, hauptsächlich Handwerker, Händler und Kaufleute, bildet die bäuerliche Familie die größte Gruppe, weswegen auch der Fokus auf letztgenannter liegt.
Die vorherrschende Lebensform war bis ins 18. Jahrhundert keine Familie im heutigen Sinn, sondern die Sozialform des „Ganzen Hauses“ (vgl. Böhnisch/Lenz 1999: 13). Die Hausgemeinschaft war in erster Linie eine Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft, zu der, neben der eigentlichen Kernfamilie, auch nicht-verwandtschaftlich gebundene Personen, wie Mägde, Knechte, Dienstboten und auch Inwohner zählten. Familienleben und Arbeitswelt bildeten somit einen Komplex. Alle Mitglieder lebten, wohnten und arbeiteten zusammen und trugen somit gemeinsam zur Existenzsicherung bei.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass das „Ganze Haus“ nicht als Großfamilie missverstanden werden darf. Die Vorstellung der Mehrgenerationenfamilie, die in Nord-, Mittel- und Westeuropa als Lebensform vorherrschend gewesen sein soll, wurde von der historischen Familienforschung als Mythos entlarvt (vgl. Rosenbaum 1982: 49, Böhnisch/Lenz 1999: 14, Burkart 2008: 117). Hinzu kommt die für West- und Mitteleuropa typische Kombination von hohem Heiratsalter und geringer Lebenserwartung, so dass drei Generationen in einem Haushalt selten vorkamen.
Die bäuerliche Hausgemeinschaft war neben der Wohn-, Lebens- und Schutzgemeinschaft eine Produktionsgemeinschaft. Vorwiegend wurde für den Eigenverbrauch produziert. Somit wurden alle Mitglieder des Hauses in den Arbeitsprozess integriert. Die Arbeitsteilung war flexibel geschlechtsspezifisch organisiert, wobei auch viele Tätigkeiten gemeinsam bewerkstelligt wurden, vor allem, wenn es sich um eine kleinere soziale Einheit handelte.
Da die traditionelle Familie vorrangig als Wirtschaftsgemeinschaft anzusehen ist, galt es auch primär die Existenz und den Erhalt der Generationenabfolge zu sichern, denn die gesamte Hausgemeinschaft war davon betroffen (vgl. Hill/Kopp 2006: 43). Die Partnerwahl und Ehe war weniger an Liebe, Gefühle und Zuneigung orientiert als vielmehr an ökonomische Bedingungen geknüpft. Grundlage einer Heirat waren materielle Motive: Besitz,Arbeitsfähigkeit und Gesundheit mit dem Ziel, die materielle Absicherung zu gewährleisten. Zudem war das Verhältnis der Eheleute stark patriarchalisch.
Wie das Verhältnis der Ehepartner, so ist auch die Beziehung zu den Kindern durch ihre ökonomische Bedeutung geprägt. Sie dienten als Erben, Arbeitskräfte sowie auch zur Absicherung der Eltern und wurden somit schon in jungen Jahren in den Arbeitsprozess integriert (vgl. Beck-Gernsheim o.J.: 17). Verglichen mit heute wurden in der frühen Neuzeit zwar mehr Kinder geboren, aber dies ist aufgrund der hohen Kindersterblichkeit nicht verwunderlich - war man doch auf die Kinder zur Existenzsicherung angewiesen.2
Die Kindheit als eigenständige Entwicklungsphase, in der den Eltern die Aufgabe der Sozialisation zuteil wird, gab es nicht. Zum einen lag dies an der niedrigen Lebenserwartung (ein Großteil der Kinder starb bereits mit zehn Jahren) und zum anderen blieb den Müttern für Zuwendung kaum Zeit, da sie eine wichtige Arbeitskraft im Wirtschaftsprozess darstellten. Bei der Versorgung der Kinder spielten somit Verwandte, ältere Schwestern sowie auch das Gesinde eine große Rolle.
Die Lebensform in der vorindustriellen Gesellschaft beschränkte sich folglich auf die Familie als Ganzes und nicht auf Einzelpersonen. Der Haushalt war für alle Mitglieder zugänglich, so dass von räumlicher Trennung oder gar Privatsphäre kaum die Rede sein kann. Familiengründung galt als notwendig und nicht als Erfüllung der Ehepartner.
3.2 Das traditionelle Modell der bürgerlichen Kleinfamilie
Der Aufstieg des Bürgertums im späten 18. Jahrhundert markiert den Übergang zur Moderne, in der sich allmählich eine neue Familienform etablierte. Diese Entwicklung wurde, in sozioökonomischer Hinsicht, durch die Trennung von Produktion und Reproduktion begünstigt. Die Familie wird somit „zum Inbegriff des Privaten und diese so neu definierte Gemeinschaft wird auf die Kernfamilie beschränkt“ (Böhnisch/Lenz 1999: 17). Damit einher geht auch die Abgrenzung von nichtverwandtschaftlich gebundenen Personen. Auch wenn weiterhin Hauspersonal existiert, so gehört es nicht mehr zur Familie. Auch direkte Verwandte leben in der Regel nicht mehr bei der Kernfamilie.
Mit der Trennung von Wohnstätte und Arbeitsplatz ändern sich zudem auch die Geschlechterverhältnisse, was mit unterschiedlichen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichen einhergeht. Der Mann als Ernährer und Alleinverdiener der Familie geht der außerhäuslichen Erwerbsarbeit nach, während der Frau die Rolle der Hausfrau und Mutter zugeschrieben wird. Das Leitbild des Frauenlebens ändert sich zunehmend. Herausgelöst aus den produktiven Tätigkeiten ist es nun ihre Pflicht, sich neben dem Haushalt um den familialen Bereich zu kümmern. Sie übernimmt emotionale Aufgaben (vgl. Böhnisch/Lenz 1999: 17, Beck- Gernsheim o.J.: 20), d.h. sie ist für das Wohlergehen und zur Unterstützung des Mannes und die sittliche Erziehung ihrer Kinder zuständig.
Aus der geschlechterspezifischen Rollenteilung geht auch der Autoritätsanspruch des Mannes hervor. Im öffentlichen wie auch im privaten Leben zeigt sich ein klares Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen, zumal die innerhäusliche Arbeit gegenüber der Erwerbsarbeit als unproduktive Reproduktionsarbeit abgewertet wird (vgl. Hill/Kopp 2006: 46). Die besondere Machtstellung des Mannes hingegen scheint durch seine außerhäusliche Erwerbsarbeit und seine berufliche Qualifikation begründet zu sein. Die Frau gerät in diesem Familienmodell in ökonomische Abhängigkeit von ihrem Ehemann.
Die Differenzierung der Geschlechterrollen hatte jedoch auch ideologische Folgen. So wurden den Geschlechtern typische Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Mann zeichnet sich durch Aktivität, Durchsetzung und Verstand aus, was ihn für die produktive Arbeit qualifiziert, während die Frau passiv und emotional ist und somit für die innerhäuslichen Tätigkeiten prädestiniert ist (vgl. Böhnisch/Lenz 1999: 17, Beck-Gernsheim o.J.: 21). Im Bürgertum findet zudem eine Aufwertung von Emotionalität und Intimität statt. Das Zuhause wird zum Ort des Privaten, in dem Wärme, Sicherheit und Harmonie gegeben ist. Dies schlägt sich auch in den Kriterien der Partnerwahl und Heirat nieder. Während in der bäuerlichen Gesellschaft eine zweckorientierte Einstellung zur Ehe herrschte, so erweisen sich nun Liebe und Zuneigung als zentrale ehestiftende Motive (Burkart 2008: 122). Trotz des Liebesideals muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich mehr um eine „vernünftige“ und „tugendhafte“ als um eine romantische Ehe handelte. Daran geknüpft waren allerdings hohe Erwartungen in den zukünftigen Partner. Man erhoffte sich jemanden zu finden, der einen als Persönlichkeit achtet und akzeptiert. Eine emotionale Basis, gegenseitiges Interesse sowie geistige Gemeinsamkeiten sind Grundvoraussetzungen für eine glückliche Ehe.
Überdies hebt das Leitbild der Ehe die Einmaligkeit und Einzigartigkeit des Partners hervor.
Mit dem Übergang zur Moderne ändert sich auch das Verhältnis zu den Kindern. Entscheidend sind nun nicht mehr ökonomische Faktoren, sondern die Familiengründung geht mit der aus Liebe gegründeten Eheschließung selbstverständlich einher, sie ist der eigentliche Sinn und Zweck der Ehe (vgl. Böhnisch/Lenz 1999: 18).
Weiterhin wird die Kindheit als eine eigenständige Lebensphase begriffen, in der die Sozialisation des Kindes zu einer der zentralen Funktionen wird.
Besonderer Aufmerksamkeit kommt der Beziehung zwischen Mutter und Kind zu, ist es doch sie, die für die Erziehung der Kinder zu sittlichen und tugendhaften Menschen verantwortlich ist. Nicht nur, dass der Frau zugeschrieben wird, sie sei besonders geeignet für die Kindererziehung, sie wird von nun an auch wesentlich über die Mutterschaft definiert (vgl. Rosenbaum o.J.: 31 f.).
4. Der Wandel der Familie - deomografische Entwicklungen
In den letzten Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass das Bild der bürgerlichen Kleinfamilie nicht mehr haltbar ist. Es ist nicht zu übersehen, dass sich die Bedeutung von Ehe und Familie im Lebenslauf geändert hat und weiterhin wandelt. Maßgebliche Veränderungen haben die Geburten- und Familienentwicklung beschäftigt. Dazu zählen vor allem der kontinuierliche Geburtenrückgang seit den 1960-er Jahren, der Rückgang der Eheschließungsziffern mit gleichzeitigem Anstieg der Scheidungszahlen.
4.1 Geburtenentwicklung
Seit dem Ende der 1960er Jahre ist ein kontinuierliches Absinken der jährlichen Geburtenzahlen zu konstatieren. Diese Entwicklung zeigt sich fast überall in den westlichen Industrienationen, besonders stark ausgeprägt ist sie allerdings in der Bundesrepublik. Die Fertilitätsrate3 liegt heute in Deutschland im Durchschnitt bei 1,4 - ein äußerst niedriger Wert, der seit über 25 Jahren stabil ist.
Ein Blick auf die Geburtenentwicklung in Ost- und Westdeutschland zeigt, dass der Verlauf in beiden Teilen Deutschlands zunächst in den ersten Nachkriegsjahrzehnten ähnlich ist: ein stetiger Anstieg der Geburtenzahlen, der um 1965 seine stärkste Ausprägung findet (bezeichnet als Babyboom), gefolgt von einem rapiden Geburtenrückgang infolge der Einführung der Pille als Verhütungsmittel, der zwar bis Mitte der 70er Jahre kurzzeitig Halt macht, sich aber dennoch weiter abwärts bewegt. Wie in Abbildung 1 deutlich wird, brachten 1965 100 Frauen in der BRD 250 Kinder zur Welt, 1985 lediglich noch 128; ab 1989 stieg die Zahl leicht auf 144 an und betrug im Jahr 2003 136.
In der DDR zeigt sich ein ähnliches Bild, jedoch mit einigen Abweichungen. Nach dem Babyboom ist auch hier ein Geburtenrückgang zu verzeichnen. Während die Fertilitätsrate 1965 noch bei 2,48 liegt, fällt sie bis 1975 auf 1,45 ab. Allerdings gewinnt die Geburtenrate aufgrund bevölkerungs- und familienpolitischer Maßnahmen in den späten 70er Jahren an Zuwachs. Dieser Zustand währte jedoch nicht lange; ab 1980 sinken die Geburtenzahlen fortdauernd ab, bis sie Anfang der 90er Jahre ihren Tiefstand erreichten. Der Zusammenbruch der DDR und der Prozess der Wiedervereinigung spiegeln sich neben den rückläufigen Eheschließungen und Scheidungszahlen auch in der Geburtenentwicklung wider. Wurden 1989 noch rund 200.000 Kinder zur Welt gebracht, so waren es 1994 nur nach knapp 80.000 (vgl. Geißler 2008: 46). In dem letzten Jahrzehnt hat sich die Fertilitätsrate der neuen Bundesländer (1,4) den der westdeutschen Verhältnisse (1,35) angenähert und sogar minimal überholt (vgl. StBA 2010).
Zudem ist das Alter der Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes stark angestiegen. Auch hier zeigen sich im Verlauf Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern. In den 60er Jahren lag das durchschnittliche Alter der Frauen bei der Geburt ihres ersten ehelich geborenen Kindes in Westdeutschland bei ungefähr 25 Jahren. Wie im Gender Datenreport ersichtlich, stieg das Durchschnittsalter bis zu Beginn der 90er Jahre auf 27,1 Jahre an und lag somit im selben Zeitraum zwei Jahre höher als in Ostdeutschland mit 24,9 Jahren (vgl. Gender Datenreport 2005: 244). In den darauffolgenden Jahren zeigt sich in beiden Teilen Deutschlands ein kontinuierlicher Anstieg. Auffällig dabei ist, dass bis zur Jahrtausendwende eine zunehmende Angleichung Ost- an Westdeutschland stattgefunden hat. Heute liegt das Alter der Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes in Deutschland bei ungefähr 29 Jahren.
Gründe für den Geburtenrückgang liegen zum einen im Funktions- und Strukturwandel der Familie. Anders als in der traditionalen Familienform ist man heute, durch die Übernahme gesellschaftlicher und staatlicher Institutionen, nicht mehr zwangsläufig auf Kinder angewiesen. Auch die zunehmende Erwerbsbeteiligung der Frauen und ihr Wunsch nach einer Berufskarriere, führt dazu, dass der Kinderwunsch immer weiter hinausgeschoben wird. Dies betrifft gerade Frauen mit höherem Bildungsniveau, die sich häufig nur noch für ein Kind entscheiden oder ganz auf eins verzichten. Zudem stellen Kinder einen Kostenfaktor in finanzieller und zeitlicher Hinsicht dar. Gestiegene Ansprüche an die Elternrolle, die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz von Kinderlosigkeit sowie strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber der Familie haben heutzutage Auswirkungen auf das Geburtenverhalten (vgl. Geißler 2008: 48 f.).
4.2. Eheschließungen
Auch die Ehe musste in den vergangenen Jahrzehnten starke Einbußen hinnehmen. Gerade für die jüngeren Erwachsenen im „heiratsfähigen“ Alter scheint die Ehe an Attraktivität verloren zu haben. Der Anteil der Personen, die nicht heiraten in Deutschland steigt fortwährend an. Nach Schätzungen werden ungefähr 30 % der heute lebenden jüngeren Männer und Frauen dauerhaft ledig bleiben (vgl. Geißler 2008: 335).
[...]
1 ‚Elter’ wird als Singularform zur Pluralform ‚Eltern’ verwendet, um der Vielzahl von Familien mit nur einer der beiden Personen (Alleinerziehende) gerecht zu werden (vgl. Lenz 2009: 78)
2 Die Zahl der Haushaltsmitglieder und die der Familienmitglieder variieren je nach Region, nach Stadt und Land sowie nach Haushaltsgröße. Es ist üblich, dass das Elternpaar zwischen zwei und drei Kinder hatte zuzüglich des Gesindes, jedoch gab es auch Gebiete mit Durchschnittswerten von bis zu neun Geburten pro Ehe (vgl. Dülmen 1990: 29 ff.)
3 Die Fertilitätsrate gibt die Anzahl der Lebendgeborenen an, die eine Frau im fortpflanzungsfähigen Alter -gewöhnlich zwischen dem 15. und 45. Lebensjahr - zur Welt bringt. Der Begriff der Geburtenrate, der ebenfalls hier verwendet wird, soll gleiches ausdrücken.
- Quote paper
- Janin Eissing (Author), 2011, Führt die fortschreitende Individualisierung zur Auflösung der Familie? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201349
Publish now - it's free














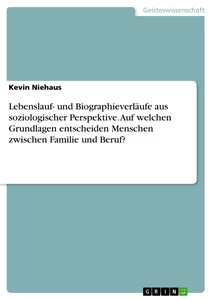





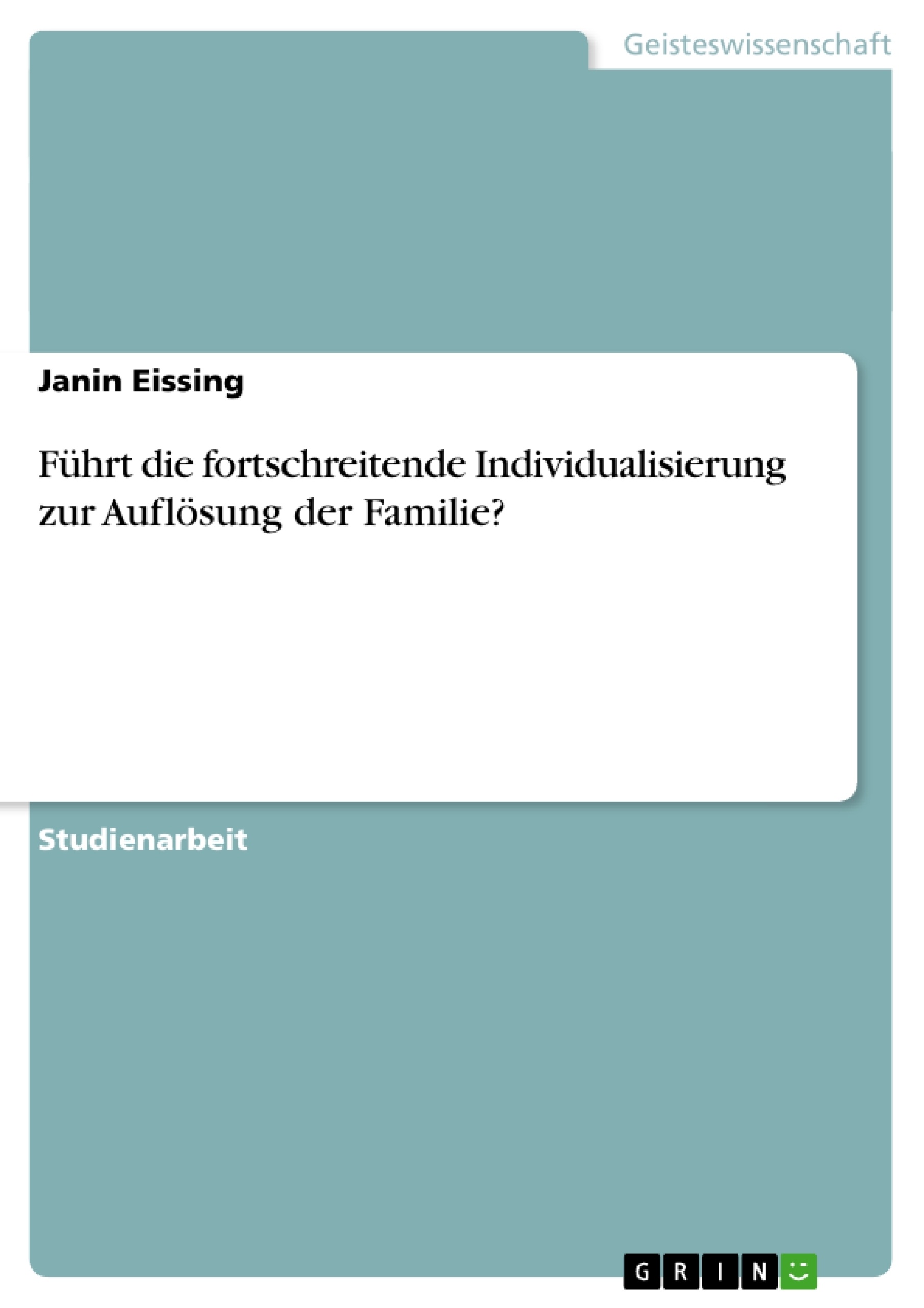

Comments