Excerpt
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Begriffserläuterungen
1.1 Lernbehinderung
1.1.1 Erscheinungsbild und Kriterien der Lernbehinderung
1.1.2 Die Stigma- versus Bezugsgruppentheorie
1.2 Integration
1.2.1 Vorbemerkung
1.2.2 Schule zwischen Segregation und Integration
1.2.3 Bildungspolitische Grundlagen der Integration
1.2.4 Die Dimensionen der Integration
2 Die Situation von lernbehinderten Schülern in Integrationsklassen
2.1 Fragestellungen und Vorgehen
2.2 Auswahl relevanter Studien
2.3 Ergebnisse zur Sozialen Integration
2.4 Ergebnisse zur Leistungsmotivationalen Integration
2.5 Ergebnisse zur Emotionalen Integration
2.6 Ergebnisse zu den Schulleistungen
2.7 Diskussion der Ergebnisse
3 Konsequenzen für die Praxis einer integrationsfähigen Schule
3.1 Integrationsfähigkeit
3.2 Didaktik, Methodik und Rahmenbedingungen
3.3 Förderung der Sozialen Integration
4 Zusammenfassung und Empfehlungen
5 Literaturverzeichnis
6 Internetquellenverzeichnis
Anhang
Einleitung
„Für diese neue Empfehlung mußte die Bildungskommission davon ausgehen, daß behinderte Kinder und Jugendliche bisher in eigens für sie eingerichteten Schulen unterrichtet wurden, weil die Auffassung vorherrschte, daß ihnen mit besonderen Maßnahmen in abgeschirmten Einrichtungen am besten geholfen werden könne. Die Bildungskommission folgt dieser Auffassung nicht […] Damit stellt sie der bisher vorherrschenden schulischen Isolation Behinderter ihre schulische Integration entgegen.“ (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1974, S.10f)
Wie die Referenz zeigt, stammt dieses Zitat keineswegs von einem innovativen Bildungskongress des 21.Jahrhunderts- Gemeinsamer Unterricht für behinderte und nichtbehinderte Schüler[1] wurde schon 1973 in den Leitlinien des Deutschen Bildungsrates empfohlen. Damit ist der Integrationsgedanke nichts Neues. Auch hat die Integrationsforschung schon früh Erkenntnisse über das Lernen in heterogenen Klassen zutage gefördert, und damit die Nach-PISA-Frage vorab beantwortet. Schließlich hat Deutschland 2007 mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention bekräftigt, dass ein integratives Bildungssystem alternativlos ist. Dennoch wird gegenwärtig die Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Behinderung immer wieder angeprangert und insbesondere bei Lernförderschülern stellt die Beschulung in einer Regelklasse eine Ausnahme dar. Vielfach hört man in Gesellschaft, Politik (und auch im Studiengang Rehabilitations- und Integrationspädagogik!): Integration ja, aber nicht bei Lernförderschülern! Integrationspädagogisch ist Deutschland wohl noch immer ein Entwicklungsland. Schüler mit einer so genannten Lernbehinderung stellen die größte Gruppe der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dies bietet Anlass genug, den Fragen nachzugehen, wie integrative Maßnahmen auf diese Kinder wirken, welche Schule und welchen Unterricht diese Kinder benötigen. Meine These diesbezüglich lautet: Die Integration von Lernförderschülern ist möglich und nötig.
Dazu möchte ich zunächst die zentralen Begriffe Lernbehinderung und Integration erläutern. Doch wie wird überhaupt ermittelt, ob ein Schüler tatsächlich in eine Klasse integriert ist? Hierfür bedarf es einer Betrachtung der verschiedenen Dimensionen der Integration. Anschließend ist auf diesen Dimensionen der Stand der Forschung zur Situation von lernbehinderten Schülern in Integrationsklassen darzustellen. Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Untersuchungsbefunde zu sichten, zu vergleichen und aufeinander zu beziehen. So wird eine persönliche Positionierung sowie die Begründung oder Widerlegung der Eingangsthese ermöglicht. Schließlich möchte ich die verbreitete Frage „Wann ist ein Lernförderschüler integrationsfähig?“ umdrehen und Konsequenzen für eine integrationsfähige Schule ableiten.
1 Begriffserläuterungen
1.1 Lernbehinderung
1.1.1 Erscheinungsbild und Kriterien der Lernbehinderung
Erstmals benutzt wurde der Begriff Lernbehinderung in den 60er Jahren von KLAUER[2], der ihn von der amerikanischen Bezeichnung learning disabilities ins Deutsche übertrug. Der Begriff ist als Resultat der veränderten Sichtweise von Behinderung und des damit einhergehenden Strukturwandels im Sonderschulwesen zu sehen. Die Orientierung in der Hilfsschulpädagogik ging weg vom medizinischen Krankheitsmodell hin zu einer dynamischen Konzeption, die neben verschiedenen internen nun auch externe Verursachungsmomente und Bedingungsfaktoren mit berücksichtigte. Allerdings erscheint es mir fraglich, ob mit der neuen Begrifflichkeit eine Abgrenzung zur früheren, negativ besetzten Bezeichnung Hilfsschulbedürftigkeit erreicht werden konnte. Zwar hat sich der Begriff Lernbehinderung in der Fachliteratur sowie in der Amtssprache durchgesetzt, bezüglich einer genauen Definition herrscht jedoch Unklarheit und Unstimmigkeit. Hinzu kommt, dass die Gruppe der Lernbehinderten in sich große Unterschiede aufweist. Die Lernbehinderung lässt sich weder als abgrenzbare Personengruppe noch als Eigenschaft beschreiben, vielmehr sollte man sie als Phänomen oder Erscheinungsbild sehen. Dies führt also nach wie vor zu der Tautologie: „Lernbehindert ist, wer eine Schule für Lernbehinderte besucht“ (BLEIDICK 1980, S. 130; 1998, S. 106). Die Lernbehinderung wird tatsächlich nur im Raum Schule offenbar und muss daher auch immer im Zusammenhang mit den Normen in dieser gesehen werden. Gegen die Unterscheidung nach Behinderungsarten sowie der Defizitorientierung wurden immer mehr Stimmen laut, was 1978 im Warnock-Report zu dem Behinderungsbegriff Special Educational Needs führte. Diese Neuorientierung drückte sich 1994 auch in Deutschland aus: Die Empfehlung der Kultusministerkonferenz (KMK) sprach vom Sonderpädagogischen Förderbedarf. Meines Erachtens kommt die nachträgliche Unterscheidung nach Förderschwerpunkten aber einer Umformulierung der herkömmlichen Behinderungsarten gleich. Auch erlauben die vagen Formulierungen zum Förderschwerpunkt Lernen fast beliebige Auslegung.
In meiner Arbeit möchte ich mich an der Definition der allgemeinen Behinderung von BACH (1977) orientieren. Er klassifiziert nach den drei Dimensionen der Schwere, des Umfangs und der Dauer. Danach ist die Lernbeeinträchtigung als Oberbegriff zu sehen. Während bei einer Lernstörung nicht alle drei Dimensionen erfüllt sind, führt eine Lernbehinderung bei den Kindern dazu, dass sie „schwerwiegend, umfänglich und langdauernd in ihrem Lernen beeinträchtigt sind“. (KANTER 1977, S. 57). Die Dimension Schweregrad umschreibt, dass ein Schüler in einem oder mehreren Bereichen Abweichungen um einen bestimmten Wert unterhalb des Regelbereichs aufweist. Mit der Dimension des Umfangs will man ermitteln, in wie vielen Bereichen Abweichungen von bestimmten Erwartungsnormen (Beeinträchtigungen) vorliegen. Ebenso kann mit dem Umfang aber auch die allgemeine Intelligenz gemeint sein. Schließlich bezieht sich die Dimension der Dauer darauf, ob es einem betroffenen Schüler gelingen kann, vorhandene Rückstände aufzuholen. Ein Lernbehinderter liegt nach BACH mit seinen Leistungen also in mehreren Lernbereichen mehr als ein Fünftel unter dem Regelbereich und es wird ihm voraussichtlich nicht möglich sein, sein Niveau in 2 Jahren der Regelschule anzugleichen.[3] Trotz einiger kritischer Punkte, welche die qualitativen Abgrenzungen, die fließenden Übergänge sowie Grenzziehungen betreffen, halte ich diese Terminologie für nützlich: Zum einen balanciert sie gut aus zwischen der Begriffslosigkeit und dem Durcheinander an Definitionen. Zum anderen hat sie auch Eingang in viele theoretische Konzeptionen gefunden.
Die umrissene Vielschichtigkeit des Begriffs macht deutlich, dass Lernbehinderung multikausal, multifaktoriell und multisymptomatisch ist. Aus diesem Grund spreche ich mich für den ökologischen Ansatz aus. Eine Behinderung darf demnach niemals einseitig einem Schüler zugeschrieben werden, sondern muss unter Einbeziehung aller Mensch-Umwelt-Beziehungen als individuell, flexibel und situationsspezifisch verstanden werden. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Beschulungseffekten bei Kindern, denen eine Lernbehinderung bereits diagnostiziert wurde. Aus diesem Grund verzichte ich auf eine ausführliche Darstellung von möglichen Verursachungsmomenten. Als wichtig erachte ich es hingegen, mich mit den Überlegungen der Stigma- versus Bezugsgruppentheorie bezüglich dem Phänomen Lernbehinderung auseinanderzusetzen. Denn diese theoretischen Hintergründe werden herangezogen, um für eine schulische Aussonderung versus Nicht-Aussonderung oder Integration zu argumentieren.
1.1.2 Die Stigma- versus Bezugsgruppentheorie
Mit der schulischen Segregation und der Kennzeichnung von als lernbehindert eingestuften Schülern geht ein Prozess einher, der als Stigmatisierung bekannt ist. Das bedeutet, dass den Lernbehinderten negative Eigenschaften (wie dumm, faul, frech; suchen Streit) und Rollenerwartungen zugeschrieben werden. Man geht davon aus, dass dies Auswirkungen auf ihr Selbstbild, ihre Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung hat. Es existieren zahlreiche empirische Untersuchungen zum Fremd-, vermuteten Fremd- und Selbstbild lernbehinderter Sonderschüler.[4] Hier möchte ich nun zusammenfassend auf die wichtigsten Untersuchungsergebnisse eingehen. Das Bild, das unterschiedliche Bevölkerungsgruppen von lernbehinderten Sonderschülern haben, ist äußerst negativ. Auch wissen die Lernbehinderten meist von der ablehnenden Haltung und den Etikettierungen in ihrer Umwelt und nehmen eine soziale Distanz zu Hauptschülern wahr. Auch möchte die Mehrzahl der Sonderschüler lieber auf eine Regelschule gehen, weil diese einen besseren Ruf hat. Übernimmt der Schüler die herangetragenen Fremddefinitionen in sein Selbstbild, kommt es zu einem veränderten psychischen Gleichgewichtsniveau und er verhält sich dann so, wie es seine Umwelt von ihm erwartet. Die gesamte Interaktion ist dann an dem Stigma orientiert. Jedoch übernehmen sie nicht automatisch das öffentliche, negative Bild und ihr Selbstwert wird nicht regelhaft dadurch beeinträchtigt. Die Sonderschüler sind demnach bemüht, die Stigmata durch Abschwächungs- und Umbewertungsstrategien zu leugnen oder zu verharmlosen. Die Stigmatheorie geht nun davon aus, dass die Entwicklung des Selbstkonzepts einseitig von Fremddefinitionen abhängig ist. Sie übersieht also, dass die Lernbehinderten auch andere Quellen selbstbezogener Informationen nutzen, bei sozialen Quellen die Referenzperson entscheidend ist und den Drang, das Selbstwertgefühl gegen Bedrohungen zu schützen. „Würden Sonderschüler sich wirklich die Meinungen anderer Leute zu eigen machen und ihre Bewertungen internalisieren, müssten sie sich selbst hassen“ (WOCKEN zit. n. RANDOLL 1991, S. 96). Die Mehrzahl der Sonderschüler bewältigt das Stigma Lernbehinderung defensiv. Dabei verleugnen sie eigene Intelligenz- und Begabungsmängel als Ursache und schreiben die Gründe für ihre Sonderschuleinweisung vor allem der Grundschule zu. Die Kraft, die sie für das Errichten eines positiven Selbstbildes investieren fehlt ihnen allerdings an anderer Stelle für entscheidende Entwicklungsprozesse. Damit ist die Stigmatheorie also geeignet, interindividuelle Prozesse der Stigmatisierung Lernbehinderter zu beschreiben, während intraindividuelle Verarbeitungsmuster unbeachtet bleiben.
Übertragen auf den Schulalltag ergibt sich nun für den Lernbehinderten in der Sonderschule eher die Chance, Sozialkontakte zu meiden, die ungünstig für das Selbstwerterleben sind. Der Schulleistungsschwache in der Regelklasse sieht sich dagegen ständig Gleichaltrigen gegenüber, die bessere Ergebnisse erzielen. Der Vergleich mit ihnen führt zu einem negativeren Selbstbild als bei Lernbehinderten in Sonderschulen, hinzu kommen Stigmatisierungen seitens der Mitschüler und der Druck zur Angleichung der Selbstdefinition an die negativen Fremddefinitionen. An dieser Stelle wird deutlich, dass der sozialen Gruppe, mit der sich der Lernbehinderte vergleicht, eine wesentliche Bedeutung zukommt. Dieser soziale Kontext, in den das Individuum eingebunden ist, wird als Bezugsgruppe bezeichnet. Verschiedene Untersuchungsergebnisse weisen auf eine Gültigkeit bezugsgruppentheoretischer Annahmen (im Bereich schulleistungsrelevanter Selbstkonzeptdimensionen) hin und widersprechen zugleich Stigmatisierungseffekten bei lernbehinderten Sonderschülern. Es ist jedoch wenig darüber bekannt, unter welchen Bedingungen und für welche Selbstkonzept-Bereiche ein Individuum welche Quelle selbstbezogener Information wählt. Man nimmt an, dass im schulischen Bereich Bezugsgruppenvergleiche für alle Schüler eher bedeutsam sind als beispielsweise der intraindividuelle Leistungsvergleich. Auch sind vor allem Schüler mit einem geringen Selbstwertgefühl auf einen sozialen Vergleich angewiesen. Folglich sind besonders Lernbehinderte von der Bezugsgruppe abhängig. Häufig werden als Argument für die Sonderbeschulung Lernbehinderter die positiven Effekte auf ihr Selbstkonzept angeführt. Interessanterweise wird dieses Argument jedoch durch die Ergebnisse relativiert: Im Verlauf der Sonderschulzeit nimmt das Selbstkonzept der eigenen Begabung immer mehr ab. Anscheinend erweitern die Sonderschüler mit zunehmendem Alter ihre Perspektive und vergleichen sich mit der gesamten Altersgruppe und nicht mehr nur mit ihren lernbehinderten Mitschülern. Der Schonraum der Sonderschule wirkt offenbar nur für eine gewisse Zeit.[5]
Was lässt sich aus den Befunden beider Theorien nun für die Beschulung Lernbehinderter ableiten? Es ergibt sich eine widersprüchliche Situation: Die Stigmatheorie kann als Ansatz für eine integrative Beschulung Lernbehinderter benutzt werden, die Bezugsgruppentheorie spricht für die Sonderbeschulung. Meines Erachtens kommen bei Lernbehinderten in jeder Schulform beide Mechanismen, der Stigmatisierungs- und der Bezugsgruppeneffekt, zum tragen. Auch haben die Theorien nur eine begrenzte erkenntnistheoretische Reichweite und müssen durch gesellschaftspolitische, rechtliche und ethische Überlegungen ergänzt werden.
Es heißt, dass sich Sonderschüler trotz objektiver Benachteiligung relativ wohl fühlen
(, solange sie ihre Klasse als Bezugsgruppe wählen,) während sich Schüler in integrativen Klassen unwohler fühlen obwohl sie objektiv bessere schulische Rahmenbedingungen haben. WOCKEN ( zit.n. RANDOLL 1991, S. 113) bezeichnet diese beiden Sachverhalte als „Zufriedenheitsparadox“ beziehungsweise als „Unzufriedenheitsdilemma“. Aber vielleicht ist es ja auch möglich, die objektiven Vorteile und eine subjektive Zufriedenheit der Schüler in integrativen Klassen zu erreichen? Schließlich verdeutlichen obige Ergebnisse, dass das Stigma lernbehindert trotz positiver Bezugsgruppeneffekte latent erhalten bleibt. Damit sehe ich das Argument, lernbehinderte Schüler würden sich dank der Bezugsgruppeneffekte in Sonderschulen wohler fühlen als in Regelschulen, als nicht haltbar an und spreche mich für eine integrative Beschulung aus.
Allein das begrenzte Erklärungsvermögen der Bezugsgruppentheorie reicht zweifellos nicht aus, um eine integrative Klasse zu begründen. Es muss auch überprüft werden, ob es in der Regelklasse zu einer vergleichbaren oder positiveren Leistungsförderung kommt.[6] Als eines der wichtigsten Argumente für die Notwendigkeit des integrativen Unterrichts sieht Eberwein das Imitationslernen als Möglichkeit sozialen Lernens.[7] Auch wird es sicherlich nicht genügen, einen lernbehinderten Schüler einfach in die Regelklasse zu stecken und mit herkömmlicher Unterrichtsmethodik und -didaktik weiter zu beschulen. Vielmehr müssen die Bedingungen, die zu negativen Auswirkungen aufgrund von Bezugsgruppenvergleichen führen, verändert werden. Dies könnte so aussehen, dass die Notengebung als normorientierte Leistungsbewertung durch intraindividuelle Leistungsvergleiche abgelöst wird, statt Leistungsselektion also Berichte und verbale Beurteilungen der individuellen Lernentwicklung zum Einsatz kommen. Nicht jedes Kind muss zur gleichen Zeit und auf dem gleichen Weg das gleiche Ziel erreichen.
Bevor nun weiter der Begriff der Integration verwendet wird, soll dieser zunächst erläutert werden.
1.2 Integration
1.2.1 Vorbemerkung
Schon mehrfach ist der Begriff Integration zur Be- oder Umschreibung der gemeinsamen Beschulung Behinderter und Nichtbehinderter gefallen. Dabei spreche ich nicht nur von einem bloßen Zusammensein von verschiedenen Schülern, sondern von Interaktionen in einer Gruppe, die sich als Gemeinschaft sieht, welcher sich jeder Einzelne zugehörig fühlt. Meiner Meinung nach ist Integration ein dynamischer Prozess, der nie abgeschlossen ist oder zumindest lange andauert. Auch sollte man sich stets vor Augen halten, dass der Bedeutungsinhalt des Begriffes äußerst vielschichtig ist. Denn er wird auch in anderen pädagogischen Zusammenhängen sowie in anderen Wissenschaften gebraucht. Des Weiteren sollte man zwischen der Integration als Zustand und als Prozess sowie der Integration als Ziel und als Weg unterscheiden. Schließlich ist die gesellschaftliche von der schulischen Integration, die zielgleiche von der zieldifferenten Integration, die objektive Integration von dem subjektiven Sich-integriert-Fühlen abzuheben. Problematisch ist die Ziel-Offenheit des Integrationsbegriffs.[8] So existieren in der Theorie und Praxis zahlreiche Integrationsvorstellungen nebeneinander. Trotz eines fehlenden einheitlichen Konzeptes scheint in der Sonderpädagogik die Befürwortung der schulischen Integration zu dominieren.
Nach Sander wäre das (nicht eindeutig definierte) Ziel der Integration erreicht, wenn „…jeder Mensch mit einer körperlichen, geistigen und psychischen Schädigung so weit in alle Lebensbereiche der Gesellschaft integriert sein könnte, wie er persönlich es wollte.“ (EBERWEIN 2008, S. 27). Hier wird deutlich, dass Integration keine Gleichmacherei ist, da der Prozess der Integration bei jedem zu einem anderen Grad der Integriertheit führt- genauso wie auch Menschen ohne Behinderung individuell ganz verschieden in die Gesellschaft integriert sind. Diese Vorstellung impliziert außerdem, dass eine von Politik und Wissenschaft durchgesetzte Änderung der Schulorganisation nicht automatisch dazu führt, dass sich ein Schüler besser integriert fühlt, kurz: Nicht jede als integrativ bezeichnete Konzeption verdient auch diesen Namen.
1.2.2 Schule zwischen Segregation und Integration
Vor allem aber sollte nicht vernachlässigt werden, dass die schulische Integration ein Ergebnis aus langen historischen Prozessen ist. Dies führt zur Betrachtung der Etappen der Exklusion, der Separation, der Kooperation, der Integration und schließlich der Inklusion. Gleichzeitig findet man so Gegenbegriffe zur Integration- eine hilfreiche Strategie, um den Integrationsbegriff zu konkretisieren.
Bis um das Jahr 1800 existierte für Menschen mit Behinderung keinerlei öffentliche Unterstützung. Sie waren von gesellschaftlichen Einrichtungen ausgeschlossen, insbesondere auch vom Bildungswesen exkludiert. Diese vor-heilpädagogische Zeit wird demnach als Stadium der Exklusion bezeichnet. Mit der Aufklärung und ihrer Überzeugung, dass alle Menschen grundsätzlich gleichwertig und bildungsfähig sind, wurde die allgemeine Schulpflicht durchgesetzt. Darauf folgten systematische Versuche zur Ausbildung behinderter junger Menschen, die in Deutschland durch die Erfindung der Hilfsschule (um 1870) zahlenmäßig einen großen Aufschwung nahmen. Für die darin aufgenommenen Menschen erfolgte die Ausbildung separiert, die Zeit der Exklusion wurde durch das Stadium der Separation abgelöst. Dieses überdauert den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik und diente den Nazis als „Sammelbecken“ für Zwangssterilisationen und Euthanasiemorde. Trotz dieses Missbrauchs wurde das separate Sonderschulwesen nach 1945 nicht nur auf- sondern auch ausgebaut. Die Sonderpädagogik kann als Versuch gedeutet werden, der sozialen Segregation behinderte Kinder und Jugendlicher durch eine segregierte Beschulung entgegenzuwirken. In den 60er Jahren entstanden gesellschaftskritische Bewegungen, die Sonderschulen als soziale Diskriminierung erkannten. Als Antwort darauf versprachen Sonderschulvertreter und Schulbehörden, die Separation durch vielfältige Formen der Zusammenarbeit mit Regelschulen abzubauen. Diese Kooperation ist jedoch eher als politisch angenehme Lösung zu sehen, da sich das Wort fortschrittlich anhört, in der Praxis aber weder an Regel- noch an Sonderschulen echtes Interesse besteht und die Kooperation hinsichtlich der versprochenen Separationsminderung weitgehend unwirksam bleibt. Zu den Kritikern, die durch das Stadium der Kooperation nicht auf Dauer beschwichtigt werden konnten, gesellten sich ab Mitte der 70er Jahre in der BRD Bürgerbewegungen aus Eltern behinderter Kinder, die sich erfolgreich gegen Sonderschuleinweisungen wehrten. Das Stadium der Integration hatte begonnen. So gab es 1975 in der Fläming-Grundschule in Berlin erstmal Klassen mit behinderten und nichtbehinderten Kindern. Sie gilt damit als älteste Integrationsschule Deutschlands. Bekannt ist auch die Bodelschwinghschule in Bonn, die 1981 mit ihrer Arbeit begann. Im Jahre 1990 wird Gemeinsamer Unterricht bereits in 80 Grundschulen Nordrhein-Westfalens und auch in anderen Bundesländern praktiziert.[9] Im Gegensatz zur Integration, die als Bottom-Up-Prozess gesehen werden kann, beruht der Begriff der Inklusion auf theoretischen Diskussionen. Einerseits sollen Fehlentwicklungen der Integration aufgedeckt und abgebaut werden, andererseits sollen nun alle Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen einbezogen werden. In der Sonderpädagogik stößt man auf hitzige Debatten, ob der Begriff der Inklusion nun ein neuartiges Konzept oder nur ein neues Wort für Integration darstellt. Anlass bot insbesondere die deutsche Übersetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die den Begriff „inclusion“ im gültigen englischen Originaltext durch den Begriff der Integration ersetzt. Inklusion sehe ich als optimierte und erweiterte Form der Integration. Bezüglich der Inklusion ist für mich besonders auch die ausgeprägte Konnotation der internationalen Wissenschaft wichtig, welcher sich auch die deutsche Sonderpädagogik immer mehr öffnen sollte. Jedoch lassen sich keine konzeptuellen Beweggründe für den Begriffswechsel erkennen. Vielmehr scheint der neue Begriff für Motivation und Wiederbelebung zu sorgen, welche durch die zunehmend als defizitär empfundene Praxis der Integration verloren gegangen ist. So könnte man anstelle von Inklusion auch von einem erneuerten Verständnis der Integration sprechen. In meiner Arbeit verwende ich den Begriff der Integration mit der Bedeutung einer konsequenten Integration.[10]
Seit dem Jahr 1999 werden die integriert geförderten Schüler auch überregional statistisch nachgewiesen. Zwar nimmt die Quote der integrativ unterrichteten Kinder mit Behinderung in Deutschland allmählich zu, im Vergleich zur Quote der in Sonderschulen unterrichteten ist sie aber immer noch viel kleiner. Bundesweit werden etwa 16% aller Schüler mit Förderbedarf integrativ unterrichtet. Ein Ländervergleich zeigt deutliche Unterschiede in den Integrationsquoten auf und weist somit auf regionale Traditionen, verschiedene Feststellung- und Zuweisungsverfahren sowie Kapazitätsgrenzen hin.[11] Auch eine getrennte Auswertung nach Schularten offenbart große Unterschiede: 2008 besuchten von allen Integrationsschülern bundesweit 52.900 (59,5 %) die Grundschule, hingegen nur 15.100 (17,0 %) die Hauptschule und 5.200 (6,0 %) die Integrierte Gesamtschule.[12] Länder wie Italien, Norwegen, Schweden und Portugal zeigen, dass auch Integrationsquoten über 90% möglich sind.[13] Trotz der Unterschiedlichkeit der Schulsysteme der einzelnen Länder lässt sich festhalten, dass Deutschland bezüglich der Integration weit hinter anderen europäischen Ländern zurückliegt. An dieser Stelle wird die Diskrepanz zwischen Integrationsbeteuerungen und dem politischem Willen zu ihrer Durchsetzung offenbar.
Eine besondere Stellung in der Integrationsbewegung haben die Lernbehinderten: In integrativen Maßnahmen sind sie quantitativ deutlich unterrepräsentiert.[14] Als Grund dafür ist zum einen die größere „Nähe“ der Lernbehinderten zu unauffälligen Kindern zu sehen, was eine Unterschätzung ihrer Probleme nach sich zieht. Zum anderen ist es aufgrund ihrer ökonomischen und sozialen Position unwahrscheinlich, dass die Eltern lernbehinderter Schüler als Interessengruppe auftreten, um für die schulische Integration zu kämpfen. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die Bundesländer auf zielgleichem Unterricht beharren.
[...]
[1] Maskuline Formen von Personenbezeichnungen sind im Folgenden generisch zu verstehen. Dies geschieht in vereinfachender und nicht diskriminierender Absicht.
[2] Vgl. KLAUER 1966, zit. n. RANDOLL 1991, S. 28.
[3] Vgl. BACH 1977, S. 9.
[4] Vgl. RANDOLL 1991, S. 83 f.
[5] Vgl. ebd. 1991, S. 104-112/ HAEBERLIN 2003, S.140-141.
[6] Vgl. 2.6.
[7] Vgl. EBERWEIN 1989, S. 11.
[8] Vgl. WALTER 2003, S. 78.
[9] Vgl. DUMKE 1991, S.13.
[10] Vgl. LIESEN 2004, S. 3-26.
[11] Vgl. Anhang A.
[12] Vgl. KMK-STATISTIKEN a) 2010.
[13] Vgl. EUROPEAN AGENCY 2008.
[14] Vgl. Anhang B/ Bleidick 1998, S. 128.
- Quote paper
- M.Ed. Julia Bockisch (Author), 2010, Vom integrationsfähigen Lernförderschuler zur integrationsfähigen Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204339
Publish now - it's free

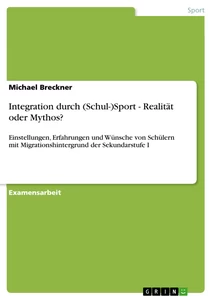


















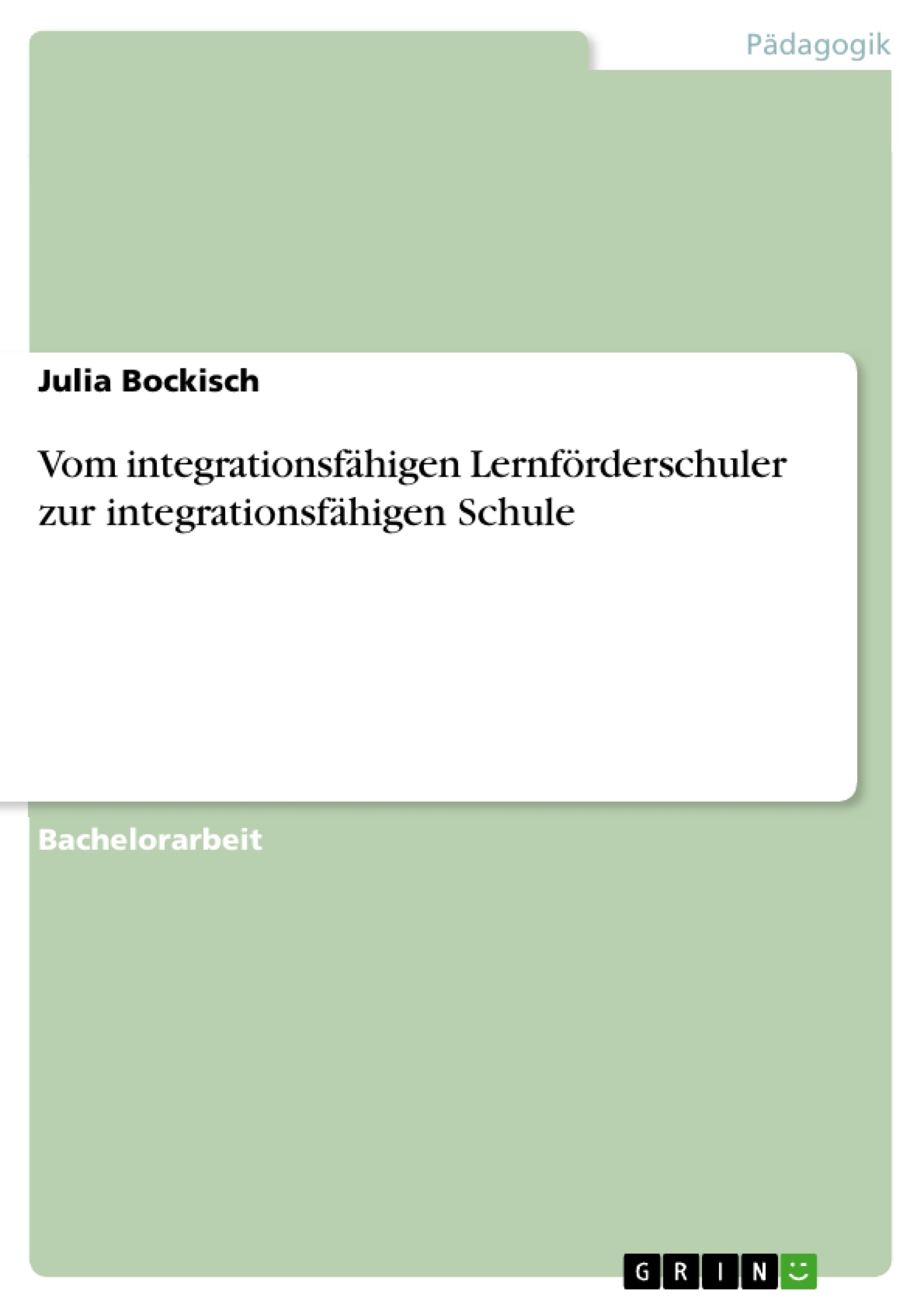

Comments