Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. John Rawls – Eine Theorie der Gerechtigkeit
2.1. Gerechtigkeit und deren Prinzipien
2.2. Die (schwache) Theorie des Guten
2.3. Urzustand und Menschenbild
3. Martha C. Nussbaum – Gerechtigkeit oder das gute Leben
3.1. Die aristotelische Konzeption
3.2. Eine starke vage Theorie des Guten und der Befähigungsansatz
3.3. (Nussbaums) Kritik an Rawls
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 17 Seiten
- Arbeit zitieren
- Lirana Kadiewski (Autor:in), 2015, Gerechtigkeit bei John Rawls und Martha C. Nussbaum. Ein Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302044
Kostenlos Autor werden
✕
Leseprobe aus
17
Seiten

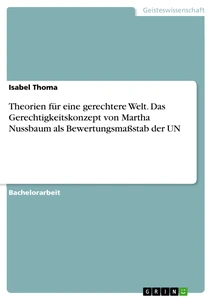


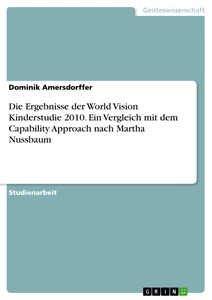
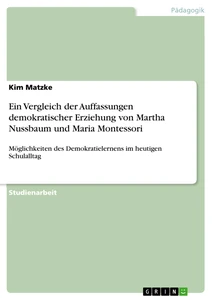


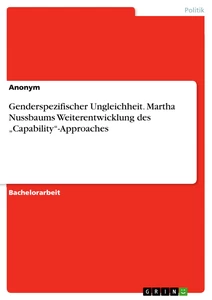


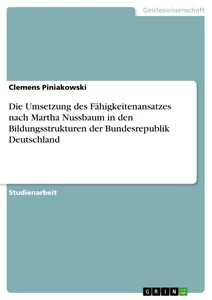
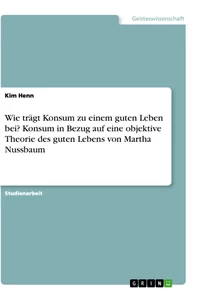
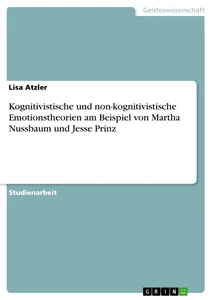


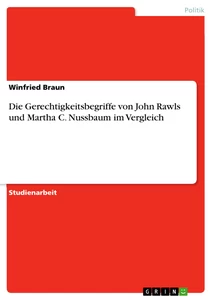

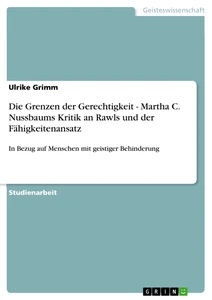

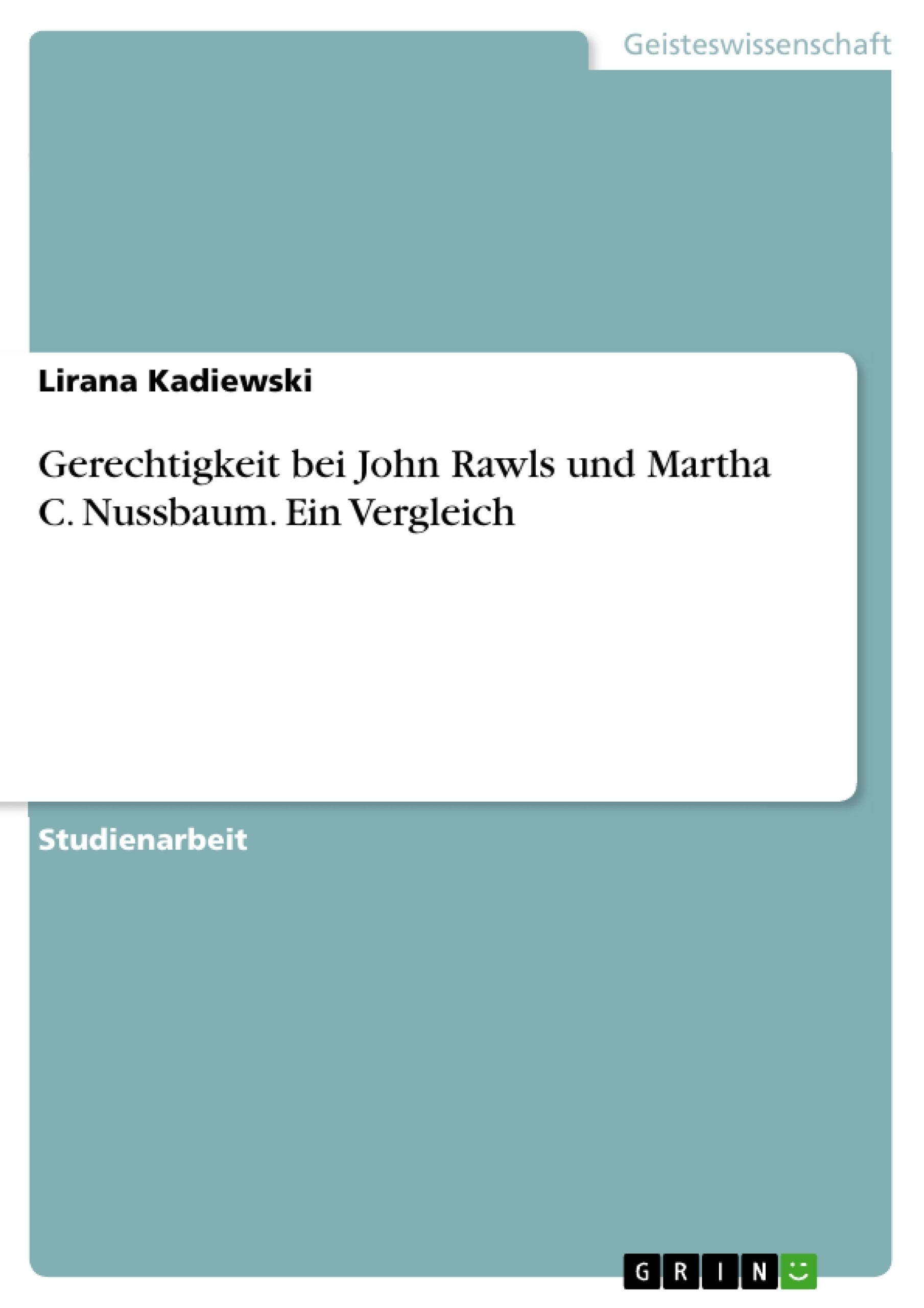

Kommentare