Leseprobe
Inhalt
1 Theologisch-anthropologische Konzepte in Goethes Literatur
2 „Umfangend umfangen“ – Goethes Hymne Ganymed: Ein literarisches Zeugnis zwischen Glaubensbekenntnis und ästhetischer Blasphemie
2.1 Die Korrelation von Form, Inhalt, Thema und Stoff
2.2 Der Weg zur Vereinigung mit dem Vatergott
2.2.1 Inneres und äußeres Frühlings Erwachen – Der leidenschaftliche Auftakt von Goethes Ganymed
2.2.2 Der Wink des göttlichen Vaters aus dem All – Die klimatische Zuspitzung der Hymne
2.2.3 Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen –Der Höhepunkt und das furiose Finale des Gedichts
2.3 Resümee und Nachbetrachtung
3 Dem Streben wird Einhalt geboten – Goethes Spätwerk Mächtiges Überraschen
3.1 Die Korrespondenz von Form, Inhalt und Thema
3.2 „Ein Strom entrauscht“ – Das Totalitätsstreben eines Flussstroms
3.3 Die Metamorphose des Flusses – Eine neue Daseinsform
4 Ganymed und Mächtiges Überraschen im Vergleich – Eine Evidenz für das Scheitern der Sturm und Drang-Ideale?
Literaturverzeichnis
1 Theologisch-anthropologische Konzepte in Goethes Literatur
Wär‘ nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt‘ es nie erblicken;
Läg‘ nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt‘ uns Göttliches entzücken?
– J. W. Goethe: Zahme Xenien III –
Dieser populäre Sinnspruch des Epigrammatikers Goethe weist auf einen Themenkomplex hin, der sich durch eine jedwede Schaffensphase des Dichters überdauernde Omnipräsenz auszeichnet. Sei es e. g. die für den Sturm und Drang mitunter einflussreichste Rebellionshymne Prometheus, der philosophische Diskurs der Wassergeister über die menschliche Seele in dessen Ode Gesang der Geister über den Wassern oder seien es seine klassischen Werke Das Göttliche und Grenzen der Menschheit, deren Titel bereits auf jenes zentrale Sujet der Goethe‘schen Schöpfungen hindeuten. In nahezu all seinen Kunstwerken werden sowohl zeitlose anthropologische als auch theologische Fragen aufgeworfen, welche den Literaten zeitlebens beschäftigt haben. So verwundert es kaum, dass diese Quaestiones auch in seinem Lebenswerk Faust von großer Relevanz sind. Soll aber nun nach Goethe der Mensch edel und gut sein oder doch den Göttern den Rücken kehren und Menschen nach seinem Bilde formen?
Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit zwei Werken des Dichters auseinander, in denen ebendiese Frage nach dem Verhältnis des Menschen zum Göttlichen bedeutsam ist. Die Arbeit verfolgt dabei schwerpunktmäßig die Intention, Goethes Jugendhymne Ganymed en détail formal, inhaltlich sowie sprachlich-stilistisch zu analysieren und interpretieren. Hierbei wird die Immanenz des Textes verlassen und von einer werkübergreifenden Deutungsmethode Gebrauch gemacht, indem sich dem Gedicht geistesgeschichtlich genähert wird. Die wesentlichsten religionsphilosophischen Gedanken, die sich in der Hymne manifestieren, sollen dabei erarbeitet und pointiert herausgestellt werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird dann Ganymed mit Goethes Sonett Mächtiges Überraschen verglichen, welches aus der strengklassizistischen Phase des Künstlers stammt. Auf Grundlage einer Kurzinterpretation dieses Sonetts soll dann erläutert werden, inwieweit das klassische Werk in Hinblick auf Form, Inhalt und Sprache von dem Sturm und Drang-Gedicht divergiert, welche kontrastiven Akzente es setzt und welche partiellen Übereinstimmungen auszumachen sind. In diesem Zusammenhang wird vordringlich die komplementär anmutende Entfaltung der Religionsthematik betrachtet, denn sowohl das artikulierende Ich in Ganymed als auch der Flussstrom in Mächtiges Überraschen sind immer strebend bemüht, sich mit dem Göttlichen zu vereinen – können beide aber schließlich erlöst werden?
Nun sind der Vorworte aber genug gewechselt und im Folgenden lassen sich Taten sehen…
2 „Umfangend umfangen“ – Goethes Hymne Ganymed: Ein literarisches Zeugnis zwischen Glaubensbekenntnis und ästhetischer Blasphemie
2.1 Die Korrelation von Form, Inhalt, Thema und Stoff
Johann Wolfgang von Goethes Hymne Ganymed, die vermutlich im Frühjahr 1774 entstanden ist,[1] kann als ein natur- und liebeslyrisches Werk verstanden werden, welches primär den erotisch und zugleich religiös geprägten Naturenthusiasmus eines menschlichen Subjekts thematisiert. Durch eine liebevolle Hingabebereitschaft zur Natur und dem darin schöpferisch tätigen Gotteswesen findet ebendieses Individuum schließlich Eingang in himmlische Sphären und kann sich dort nach intensivem Streben und Sehnen mit dem Göttlichen vereinen.
Goethes Ganymed scheint zunächst in Hinblick auf seine äußere Tektonik recht frei aufgebaut zu sein: An ein einleitendes Oktett schließen ein Duo, ein Nonett sowie ein weiterer Doppelvers an und letztlich wird das Werk durch ein Dezett beschlossen. Überdies lässt sich auch keine regelmäßige Abfolge von betonten und unbetonten Silben ermitteln; anstelle einer strengen Alternation zu folgen, oszilliert das Metrum überwiegend zwischen Jamben und Trochäen und weist ferner nicht einmal in Bezug auf die Gestaltung der Kadenzen Gleichmäßigkeit auf. Weiterhin ist auch kein festes Reimschema bestimmbar; tatsächlich lässt sich in Ganymed sogar ein gänzlicher Verzicht auf (reine End-)Reime konstatieren.
So formlos also Strophik, Metrum und Reimschema in diesem Gedicht insgesamt auch anmuten, lassen sich dennoch punktuell signifikante Aspekte des äußeren Aufbaus eruieren: Zum einen ist nämlich erkennbar, dass die beiden Duos drei Langstrophen miteinander verbinden, deren Versanzahl der Reihenfolge nach ebenmäßig zunimmt. Zum anderen kann vereinzelt eine der Tradition verhaftete Dichtung ausgemacht werden, so fällt e. g. der Adonische Vers „Frühling, Geliebter!“[2] in seinem metrisch frei organisierten Umfeld auf.
Unter Zugrundelegung dessen kann nicht nur der Titel der Hymne als Reminiszenz an die griechische Antike verstanden werden; auch die formale Gestaltung des Werkes hat epigonalen Charakter, denn sie weist bezeichnende Parallelen zur Dithyramben-Dichtung Pindars auf, die Horaz (mit meinungsbildender Wirkung) in seiner Eigenart hat darzustellen versucht:
Horaz preist in einer seiner Oden (carmen [Hervorhebung im Original] IV, 2) Pindar als einen Dichter, der wie in einem emotionalen Rausch gedichtet und neue Wörter geprägt und ohne sich an Regeln zu halten[,] Verse in freien Rhythmen geschrieben hätte (V. 10f.).[3]
Obgleich diese Beschreibung von Pindars lyrischem Schaffen zu großen Teilen sachlich inkorrekt ist, sind die Jungautoren des Sturm und Drang dennoch bestrebt gewesen, die Schreibweise des „‚horazischen Pindars‘“[4] zu adaptieren und sich vollends von der jahrelang apodiktisch hochgehaltenen Regelpoetik Opitz‘ und der rhetorischen techné, die Kunst von dem Standpunkt der Ratio aus hervorbringt, im Allgemeinen zu lösen.
Im Sturm und Drang wurde Pindar aufgrund von Horaz‘ Charakterisierung als göttlich inspirierter Dichter zum Vorbild erhoben, dem die Dichter dieser Epoche, insbesondere Goethe, in ihren regellosen, freirhythmischen Gedichten nacheiferten […] – Vorbild aber war wohl vor allem Klopstock.[5]
Die Gedichtform der Hymne ist auf diese Weise zum adäquaten Medium des Originalgenies geworden, dessen Werk formal nicht mehr mit den tradierten, vorangegangenen Normen hat konform gehen sollen. Der geniale Sturm und Drang-Dichter verweist mit seinen Hymnen (inhaltlich und formal) auf das eigene Können, die eigene Originalität und allen voran auf die Individualität seiner gottgleichen Schöpfung – die Geburtsstunde eines neuartigen Autoren(selbst)verständnisses, das noch bis heute dominiert.
Folglich kann das in weitgehend freier Rhythmik und Strophik gehaltene Werk Goethes als paradigmatisch für die neuzeitliche Hymne betrachtet werden, welche sich insb. durch eine „rhetorisch aufgeladene Sprache und einen feierlichen Ton“,[6] den genus sublime, auszeichnet. Goethe hat sich demnach nicht nur formal und sprachlich-stilistisch von dem antiken Preisgesang Pindars inspirieren lassen; obendrein zeigen sich bisweilen auch inhaltlich-thematische Parallelen. Bei Ganymed handelt es sich nämlich ebenfalls um ein erregtes, stürmisches und ekstatisch verzücktes Loblied, einerseits zu Ehren der Natur, andererseits wird es – wie auch bei Pindar – auf die kosmische Kraft aus göttlich-erhabenen Sphären angestimmt, dessen ubiquitäres Wesen hier die Goethe‘sche Frühlingslandschaft durchwaltet. Eine solch feierliche und rauschhafte Lyrik voller Emotionalität lässt sich freilich nicht in ein festes äußeres Formkorsett zwängen, das z. B. mit den strikten Normen der Regelpoetik nach Opitz kongruiert.
In Hinblick auf den inneren Aufbau ist festzuhalten, dass sich das Gedicht mit jeder längeren Strophe weiter klimatisch zuspitzt: Im ersten Teil des Werkes (V. 1-10) wird durch Liebesbekundungen des Frühlings die Liebe des artikulierenden Ichs zu ebendiesem entzündet, es beginnt ein Wechselspiel zwischen Lieben und Geliebtwerden. Im zweiten Teil (V. 11-21) konkretisiert sich die Liebesbegegnung zwischen dem Textsubjekt und dem Frühling, wenn sich e. g. dessen Blumen an das Herz der Sprechinstanz drängen. Nach den starken Sehnsüchten und Wünschen des sprechenden Ichs folgt schließlich, angekündigt durch den Gesang einer Nachtigall, im letzten Teil der Hymne (V. 22-31) die überirdische Vereinigung zwischen ihm, der Natur und dem sich darin manifestierenden Vatergott.
Allein unter Zugrundelegung dieser Inhaltsangabe sind – anders als der Titel vermuten lässt – zwischen dem Goethe’schen Gedicht und der Ganymed-Sage kaum Analogiebildungen auszumachen; die griechische Sage scheint für Goethes Ganymed sogar von verschwindend geringer Bedeutung zu sein. De facto gibt es nahezu keinen ex- oder wenigstens impliziten Verweis auf den antiken Mythos, dessen Inhalt wie folgt zusammengefasst werden kann:
Ganymedes, Sohn des Königs Tros, der Troja seinen Namen gab, war der schönste aller Jünglinge. Er wurde daher von den Göttern erwählt, der Mundschenk des Zeus zu sein. Es wird berichtet, dass Zeus, der in lüsterner Begierde nach Ganymedes entbrannt war, sich in Adlerfedern kleidete und ihn von der troischen Ebene forttrug.[7]
Selbst wenn Ganymed in der Rolle des sprechenden Ichs und nicht in der des angesprochenen Dus gesehen wird,[8] wird auch dann nicht der Eindruck erweckt, dass der Dichter sein Werk und den Ganymed-Stoff inhaltlich eng miteinander verwebt. Das artikulierende Ich der Hymne wird bspw. nicht geraubt, sondern drückt sein eigenes Verlangen nach der Vereinigung mit dem Allvater aus. Diese beruht indes auf einem beidseitigen Einverständnis, das allerdings völlig konträr zur griechischen Sage ist. Der Aufstieg in göttliche Sphären wird sogar von dem empfänglichen Ich, das weniger ein Knabe als ein heranreifender junger Mann zu sein scheint, im Liebesglück herbeigesehnt und der Göttervater würde so eine Stilisierung höchsten Maßes erfahren. Das Motiv des liebenden Geliebten, der sich durch einen absoluten Hingabeenthusiasmus auszeichnet, ist jedoch nicht mit dem griechischen Mythos vereinbar.
Des Weiteren ist in Goethes Gedicht auch die erotisch anziehende Schönheit Ganymeds bedeutungslos. Damit das sprechende Ich zum Göttlichen emporsteigen kann, ist nicht die Ästhetik seiner äußerlichen Gestalt, also die Oberflächlichkeit, entscheidend, stattdessen (im Sinne der Affektkultur des Sturm und Drang) ist es die Intensität seiner tiefsten inneren Gefühle und Empfindungen.
Benno von Wiese konstatiert schließlich treffend das zentrale analogiebildende Mythologem: „Das Gemeinsame zwischen dem glühenden Bekenntnisgedicht Goethes und dem Mythos von Ganymed ist [inhaltlich] nur durch ein einziges Leitmotiv gegeben: den Übergang einer menschlichen Person aus der irdischen in die überirdische Sphäre.“[9]
Demzufolge ist es unabdingbar, sich davor zu hüten, Goethes Frankfurter Hymne ohne Weiteres aufgrund des Titels der lyrischen Form des Rollengedichts zuzuordnen, bei der die Überschrift des Textes in der Regel auf dessen (antiken) Sprecher verweist. Das in Ganymed kreierte Ich scheint sich hingegen eher mit dieser griechischen Sagengestalt zu identifizieren; es allerdings mit ihr gleichzusetzen, ist gerade für Goethes Spätfassung der Hymne eine kaum begründbare Interpretationshypothese. Vielmehr könnte es sich bei dem (scheinbar maskulinen) Textsubjekt z. B. um einen Wanderer[10] handeln, welcher die Liebe zwischen Zeus und Ganymed, der bezeichnenderweise als Hirtenknabe ein inniges Verhältnis zur Natur pflegt, als Metapher für seine eigene Liebe zur frühlingshaften Natur wählt. Letztlich bleibt die Identität des artikulierenden Ichs aber eine semantische Offenheit, welche es nicht gestattet, das Verständnis der Redesituation in Ganymed dezidiert festzulegen.
2.2 Der Weg zur Vereinigung mit dem Vatergott
2.2.1 Inneres und äußeres Frühlings Erwachen – Der leidenschaftliche Auftakt von Goethes Ganymed
Die erste Strophe der Hymne besitzt einleitenden Charakter, da sie vor allem in die Grundstimmung des Werkes sowie in dessen Raum- und Zeitsemantik einführt: Es wird deutlich, dass es sich um Tagesanbruch handelt, als sich die allegorische Gestalt des Frühlings voller leidenschaftlicher Liebe dem Textsubjekt nähert. Im gleißenden Morgenlicht erfährt die Sprechinstanz, welche sich offenbar in der freien Natur aufhält, „rings[umher]“ (V.2) Liebesbekundungen von ebendieser ätherisch-sylphidenhaften Entität. Das sprechende Ich ist von den Liebesbezeugungen des Frühlings kognitiv und emotional derart überwältigt, dass es sich dessen einnehmender Wirkung nicht entziehen kann. Es ruft sogleich enthusiasmiert und hochgestimmt heraus: „Wie im Morgenglanze/Du rings mich anglühst,/Frühling, Geliebter!“ (V. 1-3). Dieser elliptische resp. absolute Vergleich demonstriert, dass der ergriffene Sprecher für das ihm widerfahrende exzeptionelle Erlebnis kein adäquates tertium comparationis bzw. keine passende similitudo zu finden vermag.
Ferner ist die Wahl des (hier synästhetisch geprägten) Verbs „anglühen“ signifikant, da es in diesem Zusammenhang primär mit sinnlicher Zärtlichkeit konnotiert ist. Obschon das Lexem zwar an dieser Stelle weitgehend die gleichen semantischen Merkmale wie „anstrahlen“ (bzw. „blenden“) aufweist, ist es durch seine akustisch-ästhetischen Reize, welche allen voran durch den Hauchlaut entfaltet werden, wesentlich geeigneter, um die erotischen Nuancen der einleitenden Verse auf die Leserin und den Leser[11] zu kommunizieren. Außerdem ist das Verb hier transitiv verwendet, sodass bereits mittels Valenz die enge Verbundenheit zwischen der frühlingshaften Natur und dem menschlichen Ich anklingt. Überdies fällt auf, dass der denotative Kern des Wortes „glühen“ in diesem Kontext nicht ausschließlich mit den zusätzlichen emotionalen Bedeutungsaspekten „Wärme“, „Erotik“, „Liebe“ und „Leidenschaft“ überlagert ist:
Die alte Glutmetapher für Liebe wird so reine Aktivität, erotische Energie, gerichtet. „Mich an glühst“ [Hervorhebung im Original], das stammt aus der Sprachzauberwerkstatt von Friedrich Gottlob Klopstock (1724-1803). Aber diese gerichtete Energie kommt aus allen Richtungen („rings“), was keine Gestalt je könnte, außer dem Gott, nusquam ubique [Hervorhebung im Original] – überall und nirgends sagen die Römer im Paradox von ihm.[12]
Die Wortwahl Goethes bringt somit nicht nur das sinnliche Begehren des Frühlings zum Ausdruck, sondern ist auch auf einer implizit religiösen Bedeutungsebene zu verstehen. Diese beiden semantischen Komponenten werden im Folgenden noch wesentlich schärfer konturiert: Überwältigt von der entflammten Liebe des Frühlings spricht das artikulierende Ich ebendiesen augenblicklich an. Die gehobene Apostrophe: „Frühling, Geliebter!“ (V. 3), welche „in der Tradition des Päans“[13] steht, wird dabei formal besonders herausgestellt, denn sie ist nicht in freien Rhythmen gehalten, sondern traditionell im „rhythmisch kraftvollen ‚Adoneus‘“.[14] Des Weiteren zeichnet sich diese Ansprache durch eine signifikante Wortstellung aus, da die obendrein auch metrisch betonte Nachstellung „Geliebter“ (ebd.) durch Serialisierung eine deutliche Emphase erhält, welche bei der Formulierung „geliebter Frühling“ nicht derart zu Wirkung hätte gelangen können. Mit der sich in diesem Anruf deutlich abzeichnenden Liebesthematik, welcher nochmals qua Interpunktion Nachdruck verliehen wird, korrespondiert auch der dominierende Gebrauch von weiblichen resp. klingenden Kadenzen, welche neben dem verwendeten hellen Vokalismus als zusätzliche Harmoniemarker im einführenden Oktett fungieren und die sinnliche Form der Mystik fassbarer machen.
Im Weiteren werden dem anthropomorphisierten Frühling die Prädikate „[ewig]“ (V. 6), „[h]eilig (V. 7) sowie „[unendlich]“ (V. 8) zugeschrieben, die zweifelsohne einem sakralen Vokabular entspringen und nicht nur als Hyperbeln den sich allmählich herausbildenden Naturenthusiasmus des ergriffenen Sprechers untermalen. Die gewählten Lexeme codieren hermeneutisch die raumzeitlichen Eigenschaften der vergöttlichten Frühlingslandschaft, denn die Sprechinstanz empfindet sie als ewig andauernd und grenzenlos weit. Folglich wird erkennbar, dass das Textsubjekt in seiner sich überschlagenden Stimmung sowohl die Liebesglut der Natur per se als auch die der dahinter stehenden kosmisch-schöpferischen Energie wahrnimmt, welche die sich ihm darbietende Frühlingsszenerie im Bilde der creatio continua durchwirkt: „Mit tausendfacher Liebeswonne/Sich an mein Herz drängt/Deiner ewigen Wärme/Heilig Gefühl,/Unendliche Schöne!“ (V. 4-8).
Dass sich innerhalb dieser Klimax die Leitmotive „Liebe“ und „Religion“ vereinen und dem sprechenden Ich durch den Frühling göttliche Liebe entgegengebracht wird, spiegelt sich außerdem formal wider. Nicht nur der Vers, welcher die Liebesthematik zentral herausstellt, ist in seiner metrischen Organisation einem Versmaß antiker Herkunft entlehnt; auch die chorjambische Gestaltung des Verses, in dem sich die Religionsthematik der ersten Strophe wohl am deutlichsten dartut, ist auf die antike Verslehre zurückzuführen: „Heilig Gefühl“ (V. 7).
Ferner ist es bezeichnend, dass die gewählten Ausdrücke auch einem pietistischen Wortschatz entstammen könnten. Diese religiöse Strömung plädiert für einen gelebten Glauben, d. h. für ein „praktisches Tatchristentum“[15] aus dem innersten Gemüt heraus. Religion wird zum Gefühls- und Herzensbegriff – gerade in Ganymed zeigt sich sogar die „Übertragung religiöser Inbrust auf neue Erlebnisbereiche“,[16] nämlich auf den der großen und erhabenen Natur, die sich hier aber eher als natura naturans zeigt und weniger im christlichen Sinn als natura naturata. Die dichterische Sprache in Ganymed wird auf diese Weise zum Medium des vorrangig religiös geprägten Gefühls- und Empfindungskultes, des mysterium fascinosum.
Es liegt allerdings fern, Goethes Hymne in die Traditionslinie des Pietismus einzureihen und dieses literarische Werk als Exemplum für das Gedankengut ebenjener Reformbewegung zu sehen. Im Gegenteil: Ganymed könnte den hostilen Angriff der Pietisten auf die sich in der sog. „Geniezeit“ besonders herausbildende Kunstautonomie thematisieren, denn aus deren Sicht habe sich die Kunst insb. dem heteronormativen Prinzip der Religion zu unterwerfen. Eine solche Kritik an der „restriktive[n] Wirkung des Pietismus“[17] im musischen Bereich könnte aus Webers Deutung der Goethe-Hymne gefolgert werden, gemäß dieser Ganymed primär als Appell zu verstehen sei, die Ästhetik vor religiöser Absorption zu bewahren:
[…] Ganymed [ist] in der ersten Strophe gleichsam zwischen Ästhetik und Spiritualität hin- und hergerissen, entscheidet sich letztlich aber dafür, die ästhetische Erfahrung für die religiöse Hingabe an einen imaginierten Gott aufzuopfern. […] Als Konsequenz reduziert sich in der zweiten Strophe das ästhetische Erlebnis der Natur auf eine mystische Identifizierung mit Gott.[18]
Jedoch ist fraglich, ob der Naturenthusiasmus des artikulierenden Ichs tatsächlich zu Beginn rein ästhetisch motiviert ist. Die Art und Weise, wie die Sprechinstanz die Schöpfung vergeistigt, erlaubt es nämlich, auch den für die (Natur-)Mystik bedeutenden „Morgenglanze“ (V. 1) noch zur Religions-Isotopie des Textes zu zählen, schließlich tritt (die Liebe) Gott(es) doch durch die morgendlichen Lichtstrahlen partiell und metaphorisch in Erscheinung; hier sei bspw. allein an Thomas von Aquins „Licht-Metaphysik“, an diverse Bibelstellen (z. B. Jesaja 9,1ff.) oder den Lichtkult der Kabbala erinnert. Außerdem ist die glanzvolle Herrlichkeit in vielen Religionen ein Gottesattribut. Das Sem „Religion“ findet sich demzufolge bereits erstmals im Eröffnungsvers der Hymne und belegt, dass die Sprechinstanz von Anfang an ein heilig glühendes Herz im Sinne tiefer Religiosität zu besitzen scheint. Demnach kann kein „genuin ästhetische[r] Ursprung“[19] des zum Vorschein tretenden Naturenthusiasmus ausgemacht werden, welchen sich der Sprecher fortan sehnlichst zurückwünscht.
Nichtsdestotrotz konterkariert darüber hinaus die Manifestation weiterer geistiger Strömungen in Ganymed ein (radikal-)pietistisches Verständnis der Hymne. Zum einen wird nämlich die als ketzerisch eingestufte Naturanschauung animistischer Art erkennbar, denn nicht nur der Mensch, sondern auch die – mit den damaligen wissenschaftlichen Mitteln noch nicht besonders erforschbare – Natur ist beseelt gedacht. Über die Seele sind sonach Natur und Mensch miteinander verbunden; eine Einheit zwischen Mensch und Gott bedarf nicht mehr ausschließlich des Umgangs mit der Bibel im Raum der Kirche, sondern ist auch durch die anima mundi möglich, in der jenes göttliche Pneuma offenbar wird.[20]
In dem Motiv der Vergöttlichung der Natur wird zum anderen eine weitere religionsphilosophische Inspirationsquelle fassbar, die nicht mit der pietistischen Lehre (der Herrnhuter) konform geht, nämlich der Pantheismus-Gedanke nach Spinoza[21] und dem als Häretiker verbrannten Dominikanermönch Bruno. Das spinozische Diktum „deus sive natura“ plädiert entgegen biblischer Darstellung für die Immanenz Gottes.[22] Das Göttliche sei hiernach ubiquitär und allen mannigfaltigen Erscheinungen, z. B. in der Natur, inhärent.[23] Diese Lehre bildet den Hintergrund des Theophanie-Motivs, denn der göttliche Geist zeigt sich der Sprechinstanz in der Materie, genauer gesagt in der (schaffenden) Natur, wodurch letztlich auch das wieder zusammengefügt wird, was Descartes et al. in ihrem Dualismus getrennt haben. Diese sich in Ganymed dartuende pantheistische Anschauung würde e. g. von Schopenhauer als blasphemisch, gar als (Sub-)Form des Atheismus, kritisiert werden, wenngleich sie weder Gott als Prinzip der Welt negiert noch gegen das mosaische Bildnisverbot (Ex 20, 1-6) verstößt. Sie verneint aber einerseits die Transzendenz Gottes und somit ein Charakteristikum der christlichen Gottesvorstellung; andererseits ist in dieser hermetisch-panentheistischen Naturreligiosität Gott nicht durch ontologische Autarkie, insb. in Hinblick auf seine drei Hypostasen, charakterisiert. Demzufolge wird ein animistisch-pantheistisches Naturbild in Ganymed mit der hermetischen Lehre von der Alleinheit („hen kai pan“) verschränkt. Diese Naturanschauung, welche grundsätzlich kaum mit dem Pietismus und dem Christentum allgemein zu amalgamieren ist, kann durchaus als paradigmatisch für den (durch Rousseau angeregten) Natur-Topos vieler Stürmer und Dränger gewertet werden.[24]
Des Weiteren ist es signifikant, dass das sprechende Ich eine passive Haltung einnimmt, während der Frühling doch so deutlich von einer starken Liebesglut erfasst zu sein scheint, wie bspw. der hyperbolische Ausdruck „[tausendfache] Liebeswonne“ (V. 4) suggeriert. Alle Liebesbeweise bewegen sich dem Textsubjekt entgegen; das lyrische Du hat hier die semantische Rolle des Agens inne, das sprechende Ich die des Patiens. Die wenigen Verben der ersten Strophe, welche von den zahlreichen Substantiven in den Hintergrund gedrängt werden, bringen de facto keinerlei Eigendynamik des Sprechers zum Ausdruck. Stattdessen scheint er nur jede Einzelheit einer zum Leben erwachenden Frühlingslandschaft wahrzunehmen und ästhetisiert sowie stilisiert in diesem Zuge die sich ihm darbietende Natur, welche sogleich voller Bewunderung mit „Unendliche Schöne!“ (V. 8) angerufen wird.[25] Das artikulierende Ich bestaunt hier (analog zu Pseudo-Longinos)[26] das von göttlicher Hand geschaffene „Naturschöne“. Dabei dient die gepriesene Natur nicht nur als Spiegel der menschlichen Seele, sondern auch als Reflexion der Kalokagathie Gottes.
Überdies wird durch den Einsatz sprachlich-stilistischer Mittel der Gemütszustand des Sprechers unterstrichen. Lexikalisch fällt nämlich sowohl ein Ausdrucks- als auch ein Inhaltsverband einzelner Lexeme auf. Während der Wortfamilie „Liebe“ nur die Ausdrücke „Liebeswonne“ (V. 4) und „Geliebter“ (V. 3) zugehörig sind, bilden weitere Szenographien die überaus positiv konnotierte und zugleich hierarchiehöchste Isotopieebene des Textes. Die Begriffe „Geliebter“ (ebd.), „Liebeswonne“ (V. 4), „Gefühl“ (V. 7) und die (Liebes-)Symbole „Herz“ (V. 5) sowie „Frühling“ (V. 3), aber auch der metaphorische Ausdruck „Wärme“ (V. 6), welcher allen voran die Zuneigung des Frühlings untermalt, konstituieren das Klassem „Liebe“. So wird nicht nur inhaltlich, sondern auch lexikalisch durch eine bezeichnende Sem-Iterativität die tragende Bedeutung der Liebesthematik in Goethes Werk ersichtlich.
Additional ist hervorzuheben, dass die Enjambements sowie die durch Inversion geprägte Syntax ergänzend illustrieren, dass die euphorische, berauschte und beglückte Sprechinstanz nicht in der Lage ist, ihre vielen positiven Emotionen gedanklich klar zu bändigen und die Sprache des Herzens in Worte zu kleiden, z. B.: „Mit tausendfacher Liebeswonne/Sich an mein Herz drängt“ (V. 4f.) – gleiches gilt für das Zwängen des Gefühlsüberschwangs in ein festes äußeres Formkorsett nach Opitz’schem Vorbild. Die ekstatische Verzückung des emotional überschwänglichen Sprechers angesichts seiner Naturerfahrung spiegeln neben dem Hakenstil ferner auch die verwendeten Kurzverse, die metrische Atemlosigkeit sowie der gehetzte Rhythmus wider. Auf diese Weise wird hier, insb. auch durch den Usus des Präsens, beabsichtigt, Mündlichkeit, Unmittelbarkeit, Spontanität, Echtheit und Authentizität zu suggerieren, um Ganymed als ein Zeugnis sog. „Erlebnislyrik“ mit einer einfachen, „natürlichen“ Sprache aus dem subjektiven Erleben heraus darzustellen. Dies wird jedoch durch die implizit ordnende und von einer bestimmten Intention geleitete Künstlerhand konterkariert, die primär durch Form und Sprache der Hymne manifest wird.
In der zweiten Strophe, dem ersten der beiden Duos, gesellt sich zur Optik nun synästhetisch die Haptik,[27] denn das sprechende Ich äußert in einer Exklamation sein drängendes Bedürfnis, sich mit dem Frühling (auch körperlich) zu vereinen: „Daß [sic!] ich dich fassen möcht‘/In diesen Arm!“ (V. 9f.). Es sind anscheinend die vielen positiven Impressionen von der intensiv erlebten Zeit der aufblühenden Natur, welche die Sprechinstanz ihre Liebe zum stark idealisierten Frühling erwidern lassen. Als hätte Eros auf das Textsubjekt eingewirkt, entbrennt das starke Begehren und Verlangen des Sprechers nach einer innigen Umarmung mit dem Frühling. Dieses wird einerseits mittels Interpunktion nachdrücklich geltend gemacht; andererseits intensiviert auch die Apokope „möcht‘“ (V. 9)[28] die Ungeduld des verzückten Ichs, das es nicht einmal mehr schafft, alle Laute vollständig zu artikulieren.
Die Überfülle der hymnisch gefeierten Gottesnatur ist für die menschlich begrenzte Sprechinstanz allerdings nicht fassbar. Die Verwendung des Konjunktivs zeigt, dass der Sprecher nicht aktiv sein kann, da die heilige Kraft, welche für ihn im Frühling deutlich spürbar ist, (noch) unfassbar erscheint – ein weiteres religiöses Ingredienz. So kann dieser „kupitive Optativ“ im Tonfall der Resignation aufgefasst werden, wenn er tatsächlich angesichts des Erhabenen „die menschliche Begrenztheit an[deutet]: Nur mitfühlen wird dem lyrischen Subjekt zugestanden, aktives Handeln in der Liebesbegegnung bleibt der Natur vorbehalten“.[29] Dieses Unvermögen spiegelt ergänzend die elliptische Syntax wider, welcher es gleich dem Sprecher an Vollkommenheit mangelt.[30] Zusätzlich bringt der weitgehende Verzicht auf ausdrucksstarke Adjektive die Unmöglichkeit der genauen Deskription Gottes zum Ausdruck.
[...]
[1] Vgl. Müller, Joachim: Neue Goethe-Studien. Halle (Saale) 1969, S. 51. Müller diskutiert eingehend, welche Jahre als Entstehungszeit für Goethes Hymnen Ganymed und Prometheus in Betracht kommen könnten. Für Ganymed plausibilisiert er schließlich das (Früh-)Jahr 1774.
[2] Goethe, Johann Wolfgang: Ganymed. In: Karl Eibl (Hrsg.): Johann Wolfgang Goethe. Sämtliche Gedichte. Mit einem Nachwort von Karl Eibl. 2. Aufl. Frankfurt/M./Leipzig 2014, S. 236f. Fortan wird auf Grundlage dieser Ausgabe im Haupttext zitiert.
[3] Felsner, Kristin/Helbig, Holger/Manz, Therese: Arbeitsbuch Lyrik. Berlin 2009, S. 110.
[4] Ebd.
[5] Ebd.
[6] Strobel, Jochen: Gedichtanalyse. Eine Einführung. Berlin 2015, S. 137.
[7] Ranke-Graves, Robert von: Griechische Mythologie. Quellen und Deutung. Autorisierte deutsche Übersetzung von Hugo Seinfeld unter Mitwirkung von Boris v. Borresholm. Reinbek bei Hamburg 1960, S. 101f.
[8] Weber diskutiert in seinem Aufsatz, wie die Redesituation der Hymne aufgefasst werden könnte. Er zieht es einerseits in Erwägung, auch Zeus als monologischen Sprecher zu betrachten, andererseits könne es sich aber auch um eine Wechselrede zwischen Ganymed und dem Göttervater handeln (vgl. Weber, Christian: Goethes Ganymed und der Sündenfall der Ästhetik. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 81 (2007) 3, S. 317-345, hier S. 320-324.). Beide Deutungen treffen jedoch eher auf die Frühfassung von Ganymed zu als auf die in dieser Hausarbeit bearbeitete Spätfassung. Weitere interpretatorische Anregungen, wie der Titel des Gedichts noch verstanden werden könnte, finden sich außerdem bei Moennighoff, Burkhard: Goethes Gedichttitel. Berlin/New York 2000, S. 82.
[9] Wiese, Benno von: Umfangend umfangen. In: Marcel Reich-Ranicki (Hrsg.): Johann Wolfgang Goethe. Herrlich wie am ersten Tag. 125 Gedichte und ihre Interpretationen. Frankfurt/M./Leipzig 2009, S. 76-78, hier S. 76. Kemper versteht das Gedicht hingegen vor dem Hintergrund des Herder’schen Konzepts einer Mythopoesie, gemäß diesem einer alten Sage ein neuer (poetischer) Sinn verliehen wird. Dem könnte z. B. die hermetische Prägung des Ganymed-Motivs in Goethes Hymne entsprechen (vgl. Kemper, Hans-Georg: Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit. Bd. 6/II: Sturm und Drang: Genie-Religion. Tübingen 2002, S. 198.). Kempers ausführliche Interpretation von Ganymed, die auf der Philosophie Herders beruht, findet sich bei ders.: Herders Konzeption einer Mythopoesie und Goethes Ganymed. In: Moritz Baßler/Christoph Brecht/Dirk Niefanger (Hrsg.): Von der Natur zur Kunst zurück. Neue Beiträge zur Goethe-Forschung. Gotthart Wunberg zum 65. Geburtstag. Tübingen 1997, S. 39-77.
[10] Goethe selbst ist bezeichnenderweise im Darmstädter Kreis als „Der Wanderer“ bekannt gewesen, da er eine Affinität zur (freien) Natur gehegt und sich gerne in dieser aufgehalten hat. Dies spiegelt sich in zahlreichen Werken des Autors wider, welcher nicht nur das Wandern, sondern auch die Natur(idylle) zu zentralen Motiven seiner literarischen Zeugnisse macht (e. g. Wandrers Sturmlied, Der Wandrer u. v. m.). Selbstverständlich kann und soll diese biographische Anmerkung aber gemäß der literaturwissenschaftlichen Maxime „Der Autor ist tot“ nicht als Argument für obigen Deutungsvorschlag gewertet werden.
[11] Im Folgenden wird aus stilistischen Gründen der geschlechtergerechten Sprache entbehrt und für das bessere Leseverständnis lediglich noch die männliche Form verwendet.
[12] Hillmann, Heinz: Deutsche Lyrik II. Liebeslyrik von der Anakreontik zur Romantik. In: ders./Peter Hühn (Hrsg.): Europäische Lyrik seit der Antike. 14 Vorlesungen. Hamburg 2005, S. 171-196, hier S. 172.
[13] Hofmann, Michael/Edelmann, Thomas: Lyrik vom Barock bis zur Goethezeit. Interpretation von Michael Hofmann und Thomas Edelmann. München 2002, S. 95.
[14] Lamping, Dieter et al.: [Artikel] Ode. In: dies. (Hrsg.): Handbuch der literarischen Gattungen. Stuttgart 2009, S. 549-558, hier S. 553.
[15] Schrader, Hans-Jürgen: Die Literatur des Pietismus – Pietistische Impulse zur Literaturgeschichte. Ein Überblick. In: Martin Brecht/Klaus Deppermann/Ulrich Gäbler/Hartmut Lehmann (Hrsg.): Geschichte des Pietismus. Im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus. Bd. 4: Glaubenswelt und Lebenswelten. Göttingen 2004, S. 386-403, hier S. 386.
[16] Ebd., S. 390.
[17] Ebd., S. 392.
[18] Weber, Sündenfall der Ästhetik, S. 332.
[19] Weber, Sündenfall der Ästhetik, S. 332.
[20] Vgl. Kemper, Sturm und Drang, S. 49f.
[21] Zu den Schwierigkeiten des Oxymorons „Pantheismus“ sowie zu der pantheistischen Deutung von Spinozas Lehre vgl. Schröder, Winfried: Deus sive natura. Über Spionzas so genannten Pantheismus. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 57 (2009) 3, S. 471-480.
[22] In dieser Hinsicht ist, wie Spinoza in seinem tractatus theologico-politicus hervorhebt, die Bibel zuweilen inkonsistent. Wenngleich der biblische Gott stellenweise immanente Züge und Erscheinungsformen besitzt (z. B. als brennender Dornbusch in Ex 3,2), ist er überwiegend (wie für den Theismus üblich) in seiner Substanz verschieden von der Welt, d. h. durch Transzendenz gekennzeichnet.
[23] Für Spinoza gibt es nur eine (selbstverursachte) Substanz, nämlich Gott, welchen der Philosoph in seiner revisionären Metaphysik mit der schaffenden Natur gleichsetzt. Die Substanz besitze nach Spinoza „[Attribute]“ (Spinoza, Baruch de: Die Ethik nach geometrischer Methode dargestellt. In: Otto Beansch/Artur Buchenau (Hrsg.): Baruch de Spinoza. Sämtliche Werke in sieben Bänden. Bd. 1. Hamburg 1976, S. 11.), allen voran sei sie „ewig“ (im zeitlichen Sinn) sowie „unendlich“ (im räumlichen Sinn) (vgl. ebd., S. 188). Diese Attribute gestalten sich wiederum in zahllose „Affektionen“ (ebd., S. 3) bzw. Daseinsformen, sog. „Modi“, aus. Für den radikalen Monisten Spinoza ist demnach jeder physikalische Gegenstand nur ein Modus des Ausdehnungsattributs der Substanz und jeder psychische Akt nur ein Modus des Denkattributs der Substanz.
[24] Dies lässt sich genauer wie folgt erklären: „[…] [D]as gesamte hermetische Weltbild [war] mit seiner traditionell großen Bedeutung der ‚Schau‘ und Imagination […] eine besonders poesie-affine Weltanschauung […], und sie gewann für die Stürmer und Dränger durch ihr prätendiertes Alter als ‚Ursprungsmythe‘, durch die panentheistischen Implikationen, das sensualistische Naturverständnis und die Selbsterlösungsvorstellungen in der ‚betrachtenden‘ Vergegenwärtigung und Aneignung der Natur an Attraktivität hinzu. In den Objektivationen der Natur – der ‚natura naturata‘ – zugleich das Göttlich-Geistig-Schöpferische zu erleben und an ihm […] teilzuhaben, das war ein Weg zur Selbstvergottung […]. […] [I]ndem Ganymed im Erlebnis der Natur seine ‚Himmelfahrt‘ erstrebt, wird in der Anspielung auf jene Himmelfahrt der zentralen Erlöserfigur des Christentums deutlich, wie sehr sie hier durch den – im Medium der Poesie vollzogenen – Prozeß [sic!] der Selbsterlösung im ‚Buch der Natur‘ ersetzt worden ist – ein weiterer Beleg dafür, wie durch die […] Usurpationen religiöser ‚Inspiration‘ der frühneuzeitliche Säkularisierungsprozeß [!] im Bereich der Literaturgeschichte zu einem Höhepunkt gelangt, in dem sich die Literatur mit der Selbstheilung endgültig ihre Unabhängigkeit von der christlichen Religion erwirbt […]“ (Kemper, Sturm und Drang, S. 59f.).
[25] „Unendliche Schöne“ ist syntaktisch höchst ambig, denn es ist sowohl eine Beiordnung zu „Heilig Gefühl“ (V. 7) als auch zu „Deiner ewigen Wärme/Heilig Gefühl“ (V. 6f.) möglich (vgl. Lugowski, Clemens: Goethe: Ganymed. In: Jost Schillemeit (Hrsg.): Deutsche Lyrik von Weckherlin bis Benn. Bd. 1. Frankfurt/M./Hamburg 1965, S. 47-64, hier S. 62.). In der vorliegenden Hausarbeit wird die Phrase als Anrede interpretiert, wodurch insb. die neuplatonische Eros-Theorie zur Geltung kommt, dieser zufolge es die (blendende) Schönheit und Ästhetik der Natur ist, welche den Sprecher zur (Gegen-)Liebe bewegt (vgl. Kemper, Sturm und Drang, S. 272).
[26] Vgl. ebd., S. 410.
[27] Bezeichnenderweise ist es Herder, welcher dem Tasten in seiner Sinneshierarchie die allergrößte Bedeutung beimisst.
[28] Da Metaplasmen Oralität suggerieren, ist ihre Verwendung in der Hymne ebenso in der Funktion zu sehen, Ganymed den Anschein zu verleihen, ein „erlebnislyrisches“ Werk zu sein.
[29] Sowinski, Bernhard/Schuster, Dagmar: Gedichte der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang. Interpretationen. München 1992, S. 93.
[30] Weber ist in seiner Interpretation bestrebt, in diesen Versen eine Kritik an der abendländischen Geistes- und Kulturgeschichte offenzulegen. Das Oktroyieren von Ideologien (z. B. unkeusche Sittlichkeit) habe nämlich dazu geführt, dass viele Menschen kein körperliches Selbstverständnis haben ausbilden können, wodurch schließlich eine Ich-Entfremdung, gar eine Ich-Dissoziation, bedingt worden sei: „Durch das Demonstrativpronomen und das Ausrufezeichen wird ausdrücklich die fragmentierte Erfahrung […] [der] Körperlichkeit betont; Ganymed betrachtet ‚diesen Arm‘, als ob er ihn zufällig gefunden habe […]. Offenbar fehlt ein Körper, welcher Herz und Hand miteinander verbindet […]. Wenn […] die leibliche Mitte praktisch ausfällt, fehlt Ganymed die Grundvoraussetzung, um Empfindungen ein- sowie personale Erfahrungen auszubilden, die erst einen ganzen Menschen konstituieren. Diese Mangelerscheinung erklärt die merkwürdige Über-Abstrahierung und Über-Ästhetisierung […]“ (Weber, Sündenfall der Ästhetik, S. 327f.).
- Arbeit zitieren
- Dustin Runkel (Autor:in), 2017, Theologie und Anthropologie in Johann Wolfgang von Goethes lyrischem Früh- und Spätwerk, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373059
Kostenlos Autor werden


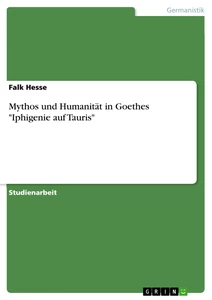

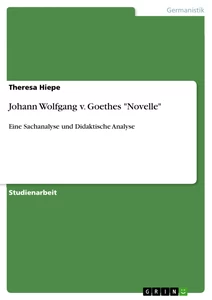
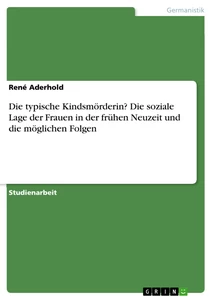




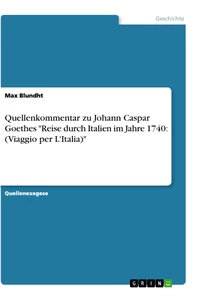




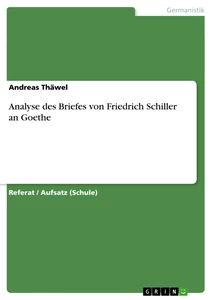




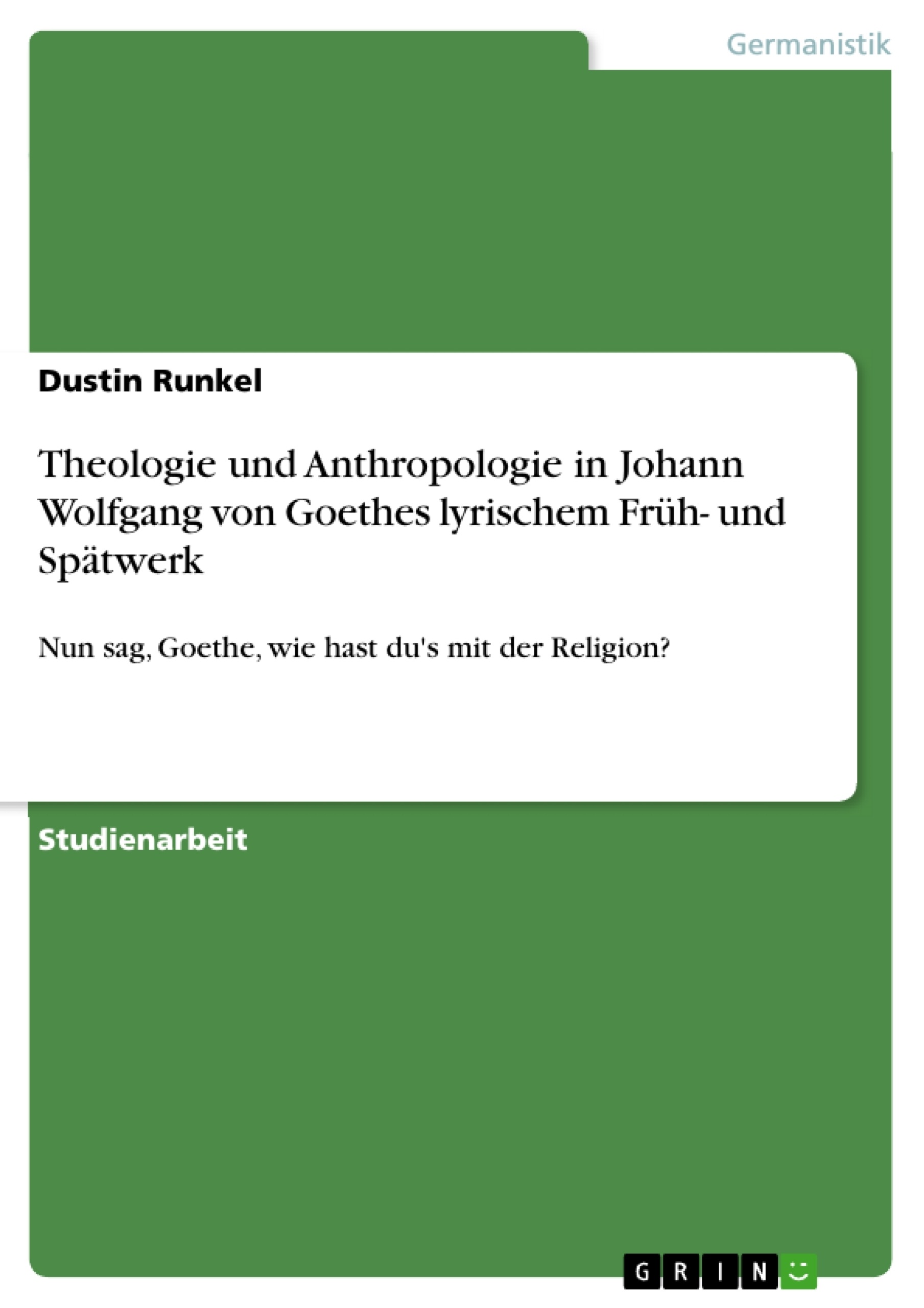

Kommentare