Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Zielsetzung
1.3. Gang der Argumentation
2. Nachhaltigkeit
2.1. Definition des Begriffs Nachhaltigkeit
2.2. Ursprung des Begriffs Nachhaltigkeit
2.3. Meilensteine der nachhaltigen Entwicklung
2.3.1. Die Grenzen des Wachstums
2.3.2. Unsere gemeinsame Zukunft
2.3.3. Der Rio-Prozess 1992
2.3.4. Die Agenda 21
2.3.5. Die Weltklimakonferenz Paris 2015
2.4. Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
2.4.1. Ökologische Nachhaltigkeit
2.4.2. Ökonomische Nachhaltigkeit
2.4.3. Soziale Nachhaltigkeit
2.5. Modelle der Nachhaltigkeit
2.5.1.Das Drei-Säulen-Modell
2.5.2.Das Nachhaltigkeitsdreieck
2.5.3.Das Schnittmengen-Modell
3. Kritische Analyse des Begriffs Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung
3.1. Die Verwendung des Begriffs in Gesellschaft und Wissenschaft
3.2. Kritik an den Modellen der Nachhaltigkeit
3.3. Kritik an nationalen Nachhaltigkeitsstrategien
4. Nachhaltigkeit und Tourismus
4.1. Definition des Begriffs Tourismus
4.2. Auswirkungen des Tourismus
4.2.1. Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt
4.2.2. Auswirkungen des Tourismus auf die Wirtschaft
4.2.3. Auswirkungen des Tourismus auf die Gesellschaft
4.3. Herausforderungen des Tourismus in Bezug auf Nachhaltigkeit
5. Nachhaltigkeitsstrategien ¬ Die Region Mostviertel-Mitte und das Pielachtal
5.1. Die Nachhaltigkeitsstrategie
5.2. Die Region Mostviertel-Mitte und das Pielachtal
5.3. Strategie und Umsetzung
5.4. Kritisches Resümee der Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie
5.5. Ausblick in die Zukunft ¬ Mostviertel-Mitte und das Pielachtal 2020
6. Zusammenfassung
7. Ausblick
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Gregor Huter (Autor:in), 2017, Nachhaltigkeit im Tourismus in Österreich. Der Begriff "Nachhaltigkeit" und die Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien in österreichischen Destinationen am Beispiel der Region Pielachtal, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376054
Kostenlos Autor werden
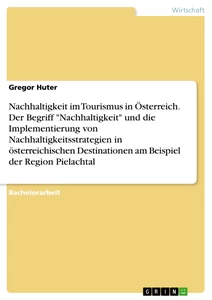
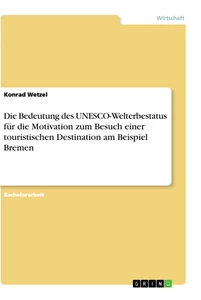
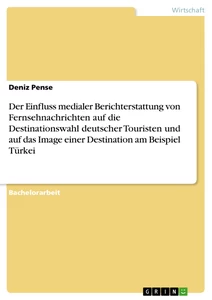
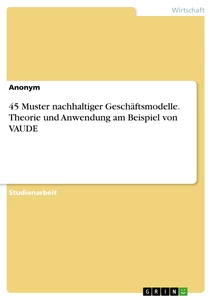
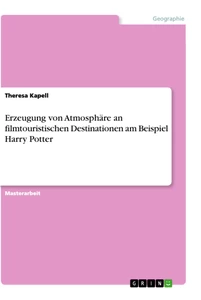
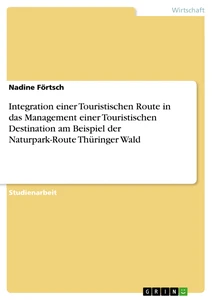
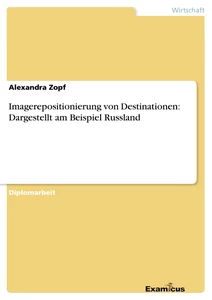
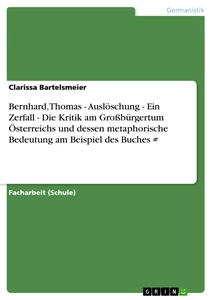
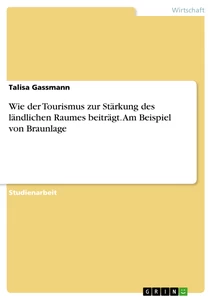
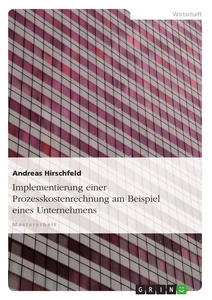
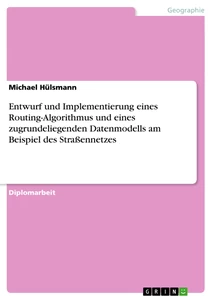


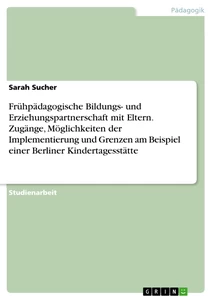

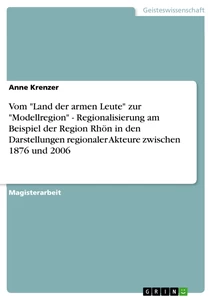

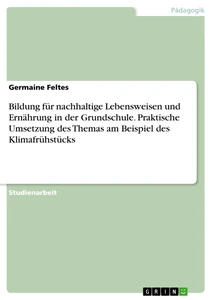
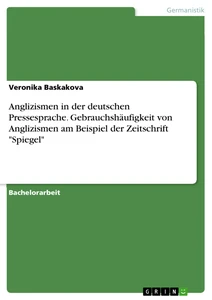

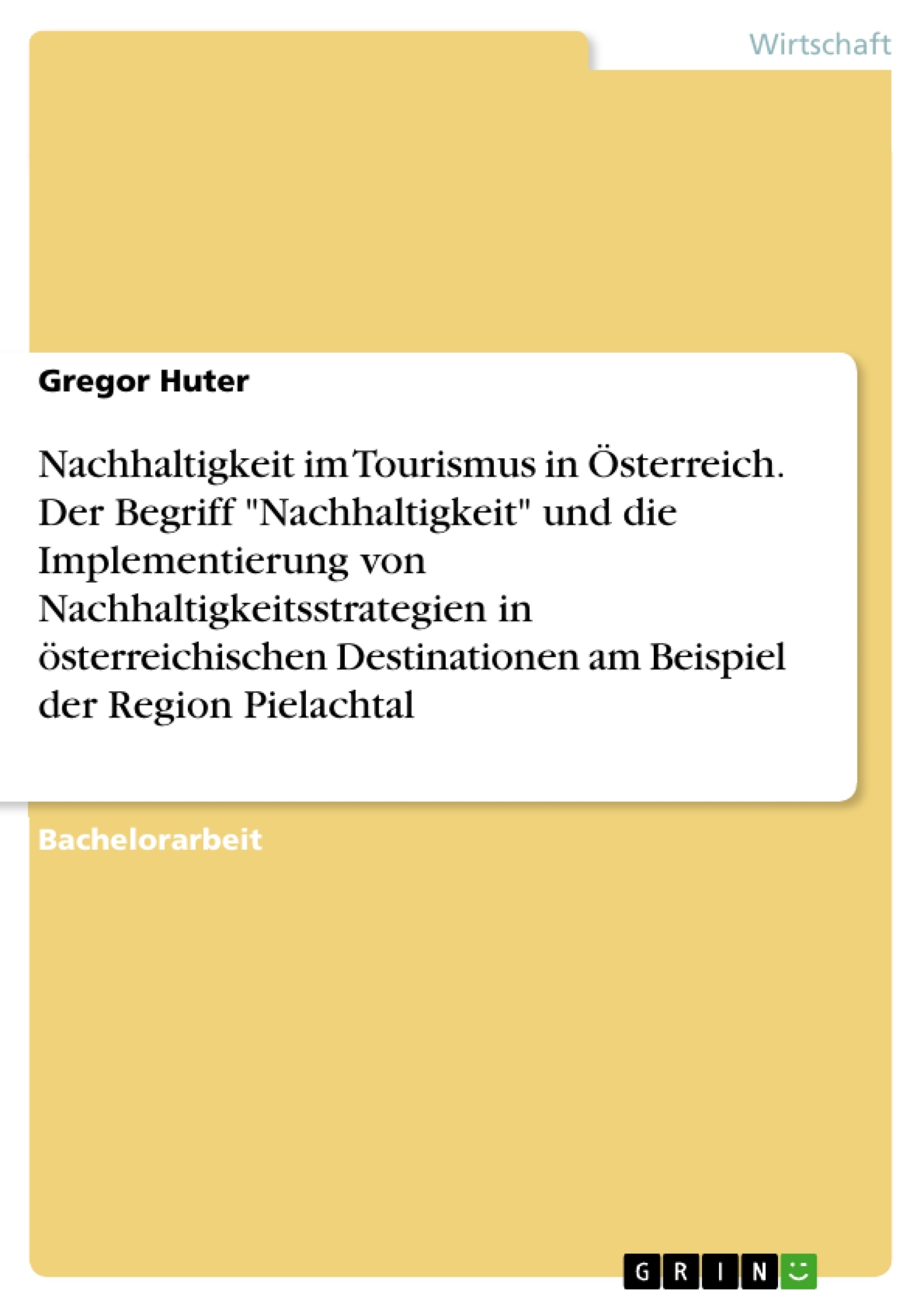

Kommentare