Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Hinführung
2 Theorie und Methodik
2.1 Vorgehen
2.2 Begriffsklärung
3 Politikbegriff des Kängurus
4 Formen politischen Protestes
4.1 „Man muss die beschäftigt halten.“ - passiver Widerstand
4.2 „Hitler ist besser wie der Kapittalismus“ – korrigierte Graffiti
4.3 „Die dritte Regel des Boxclubs lautet: Wer einen Nazi sieht, muss ihn boxen.“
4.4 „Wollt ihr den totalen Arbeitsplatz?“ - Anti-Terror-Anschläge
5 Fazit
6 Quellen- und Literaturverzeichnis
6.1 Quellen
6.2 Literatur
Ende der Leseprobe aus 20 Seiten
- Arbeit zitieren
- Birte Katrin Jensen (Autor:in), 2017, Sprachlicher Widerstand im öffentlichen Raum als satirisches Mittel in Marc-Uwe Klings Känguru-Trilogie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418738
Kostenlos Autor werden
✕
Leseprobe aus
20
Seiten


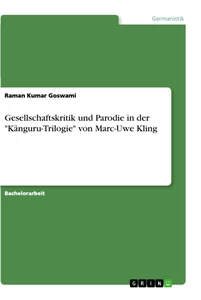




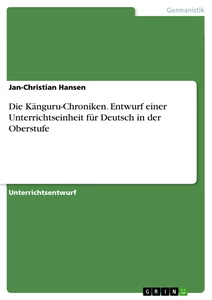


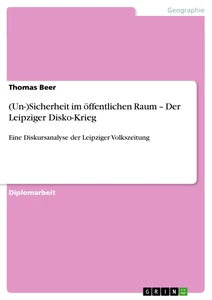

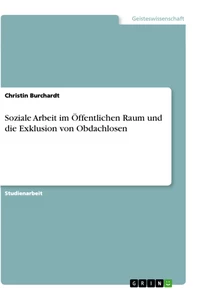
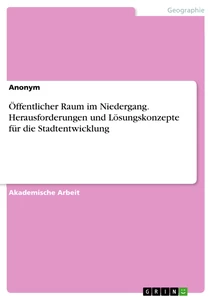
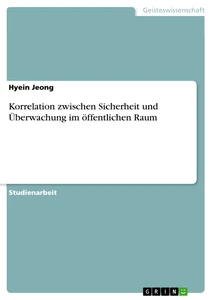
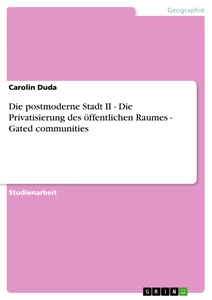
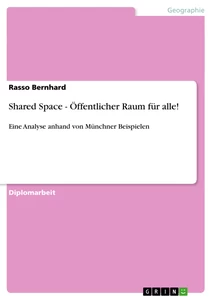
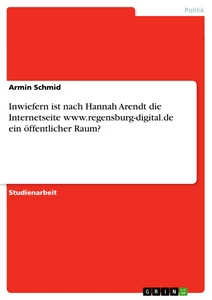
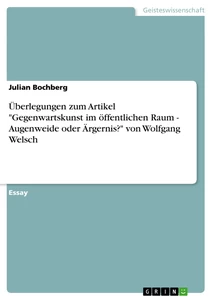
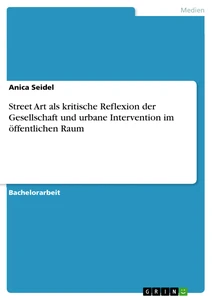
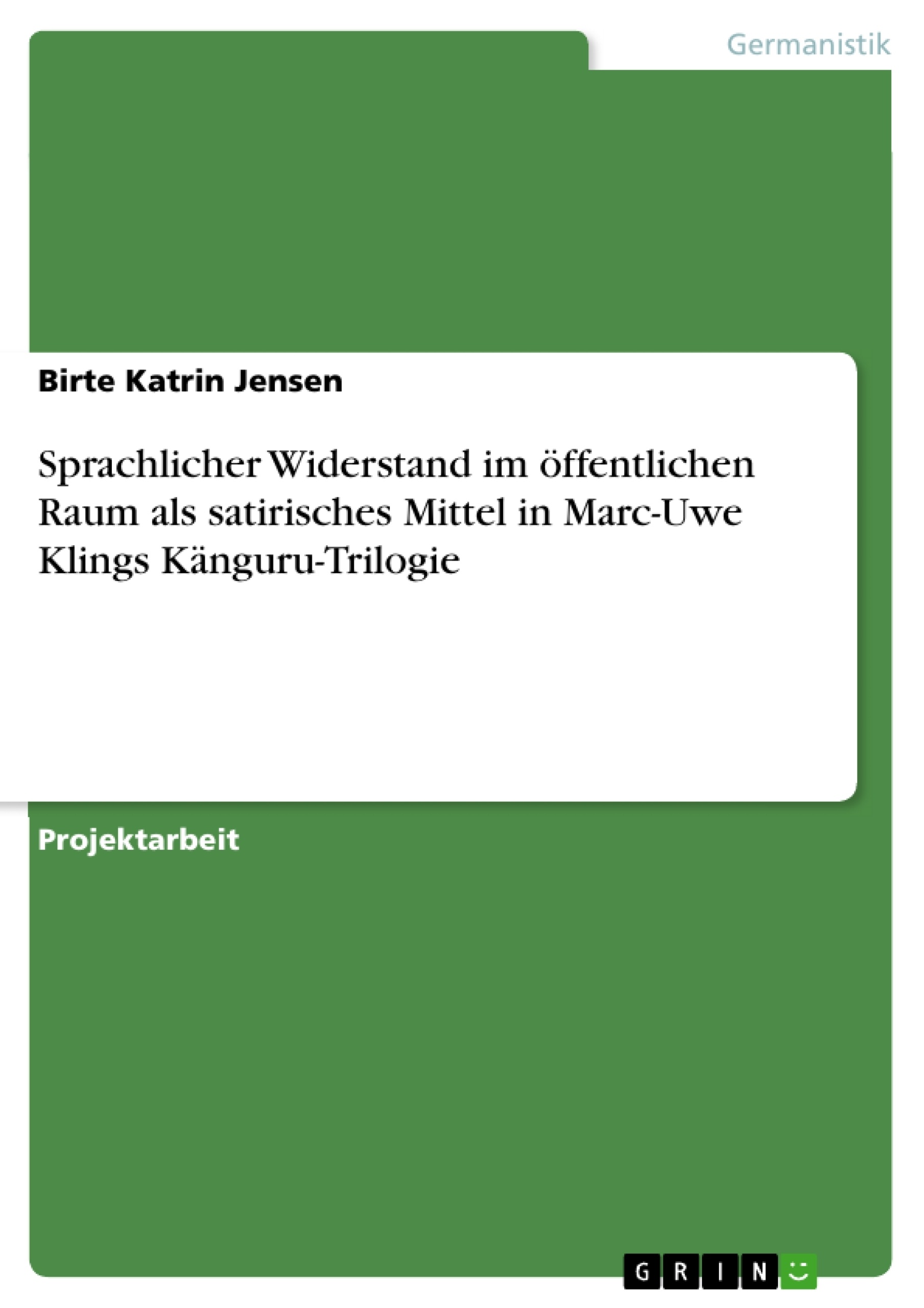

Kommentare