Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Position Polens in der Europäischen Union
2.1 Die Ersten Jahre in der EU
2.2 Das Abkommen vom Transformationsprozess
3. Die Theorie des Neofunktionalismus in den Internationalen Beziehungen
3.1 Grundannahmen des Neofunktionalismus
3.2 Kritik und Erweiterung der Neofunktionalistischen Theorie
4. Anwendung der Neofunktionalistischen Theorie auf die europäische Integration Polens
4.1 Die erste Phase
4.2 Die zweite Phase
5. Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 15 Seiten
- Arbeit zitieren
- Carla Landsbeck (Autor:in), 2019, Die Entwicklung Polens in der EU. Eine Bewertung aus neofunktionalistischer Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494322
Kostenlos Autor werden
✕
Leseprobe aus
15
Seiten
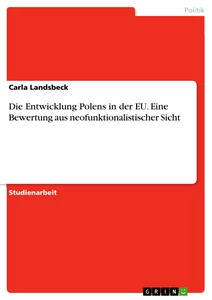
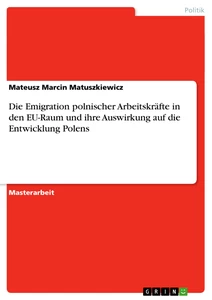
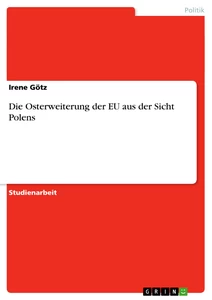
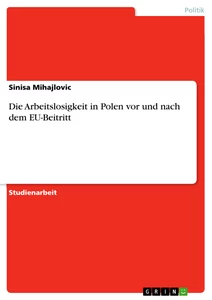
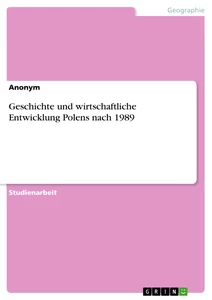
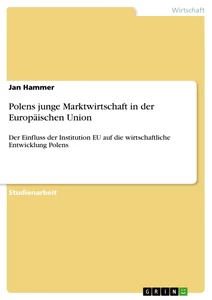
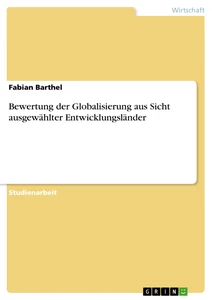
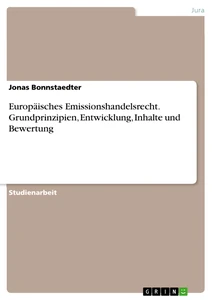
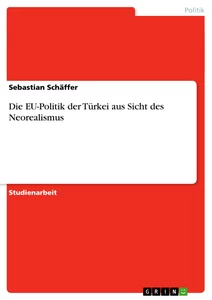
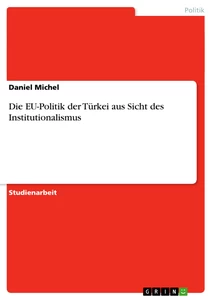
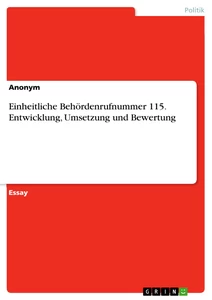
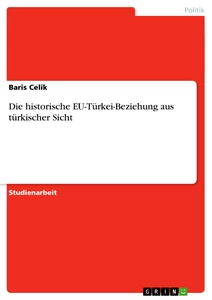
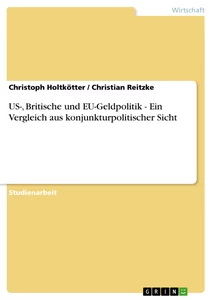
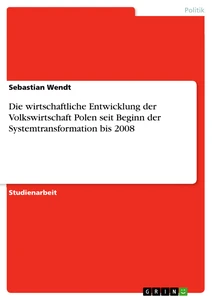
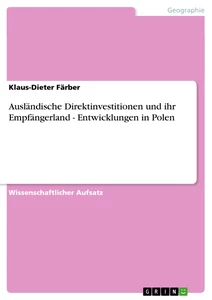
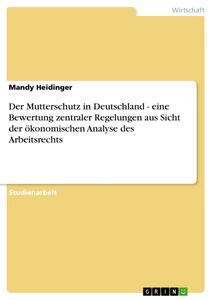
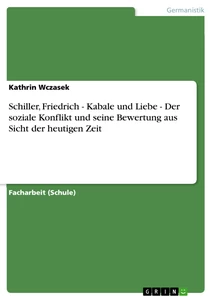
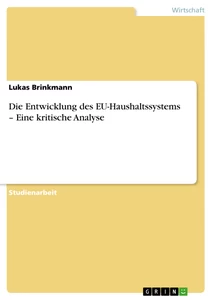

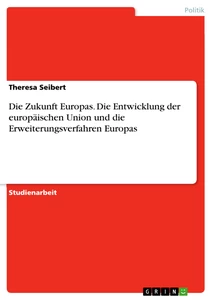
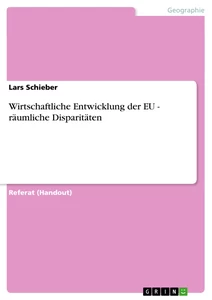
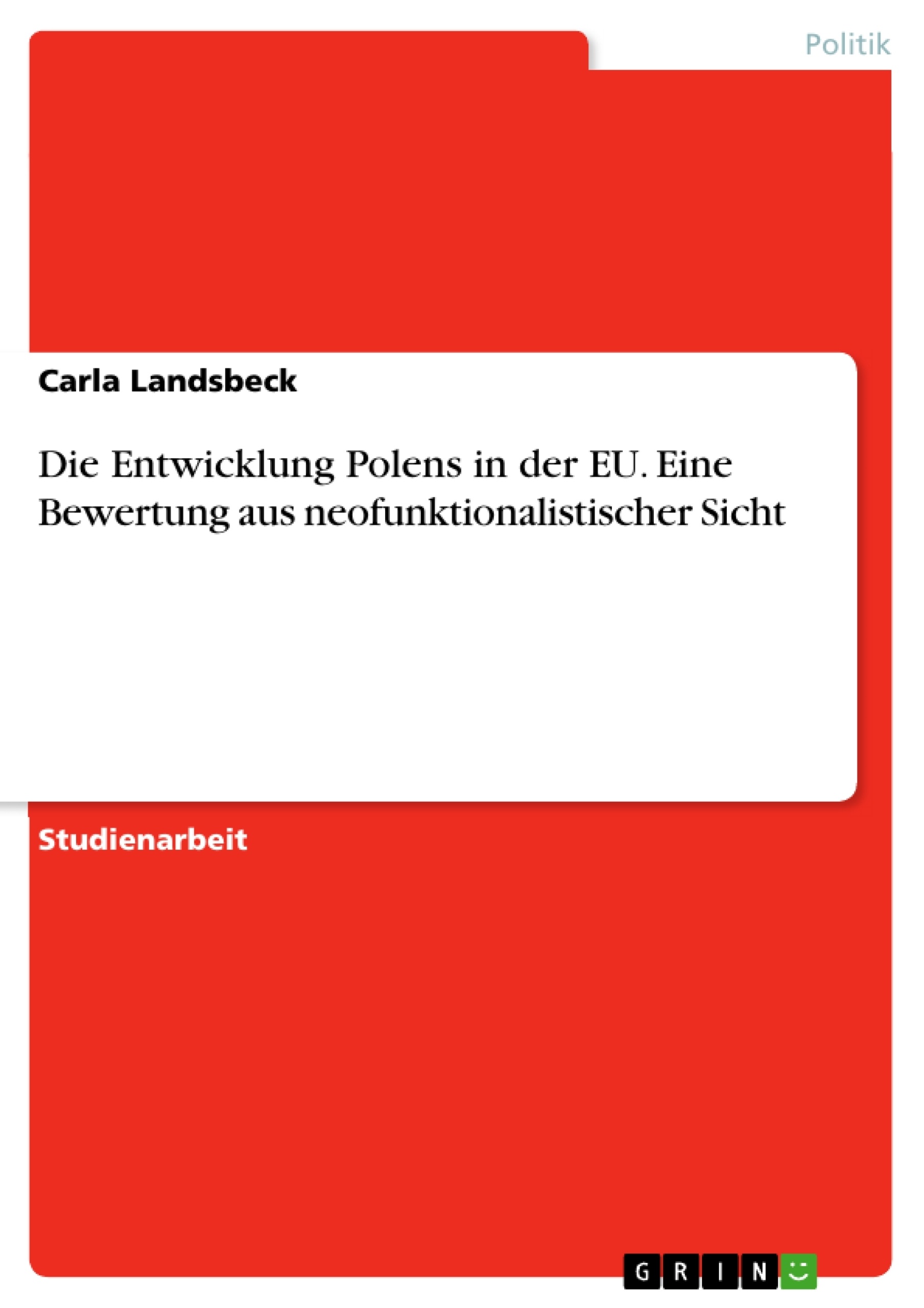

Kommentare