Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Webers Religionssoziologie - Konfuzianismus und Taoismus
2.1 Äußere Ähnlichkeit und innere Differenz – Der Vergleich von Protestantismus und Konfuzianismus
2.2 Konfuzianische Ethik und die Patrimonialbürokratie – Webers drei Gründe für das Scheitern des modernen Kapitalismus in China
2.3 Kritische Rezeption der Konfuzianismusstudie
3. Webers Werk im Kontext des East Asian Miracle
3.1 Prüfungswesen und die Bedeutung von Bildung für die wirtschaftliche Entwicklung Ostasiens
3.2 Die Relevanz von familiären Werten
4. Fazit
I. Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 19 Seiten
- Arbeit zitieren
- Vincent Winterhager (Autor:in), 2017, Max Webers Religionssoziologie im Kontext des East Asian Miracle, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494398
Kostenlos Autor werden
✕
Leseprobe aus
19
Seiten
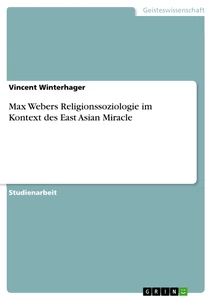
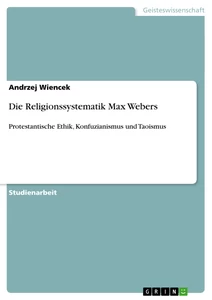
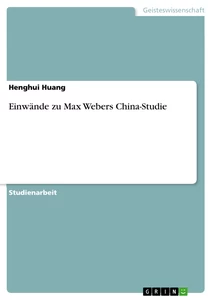
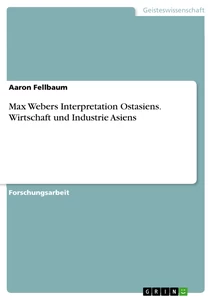
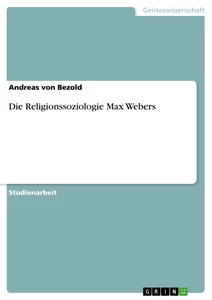
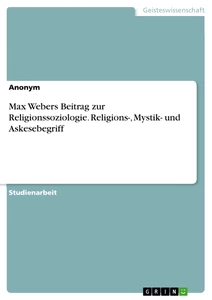
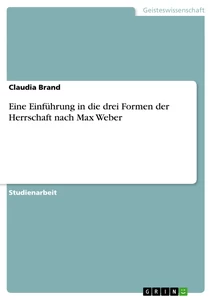

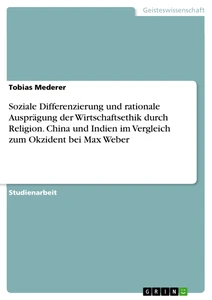
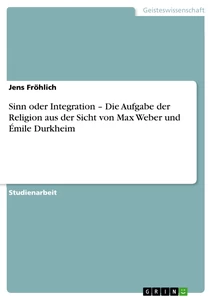
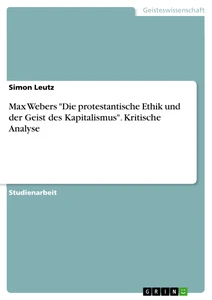
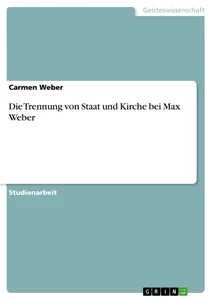


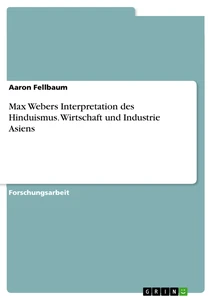
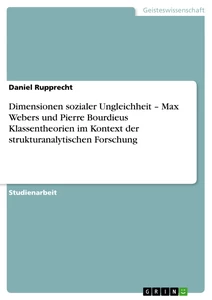
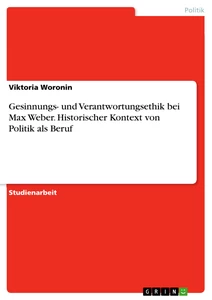
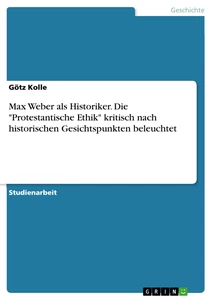
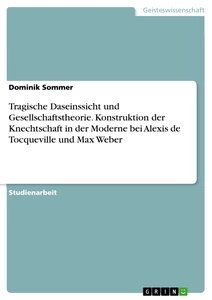

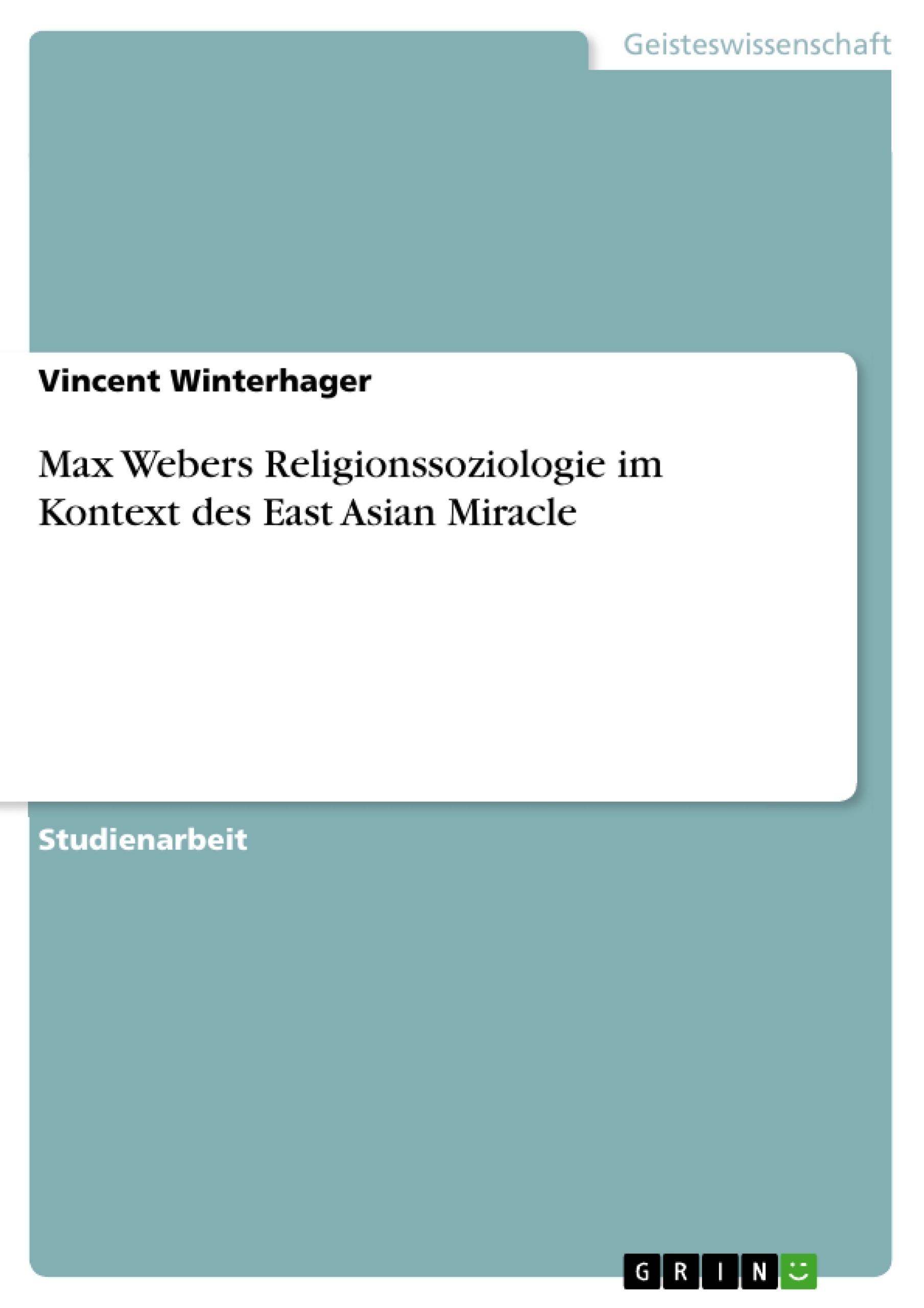

Kommentare