Leseprobe
Inhalt
I. Einleitung
I.1 Motive (C. Volkert und M. Leesch)
I.2 Aufgabenstellung und Arbeitsplan (C. Volkert und M. Leesch)
I.3 Informationsquellen (C. Volkert und M. Leesch)
II. Eigene Erfahrungen mit Bindungsauffälligkeiten
II.1 Erfahrungen mit behinderten Jugendlichen (C. Volkert)
II.2 Erfahrungen mit Müttern und ihren Kindern während einer Mutter-Kind-Erholungskur (C. Volkert)
II.3 Erfahrungen mit Heimkindern (M. Leesch)
III. Darstellung und Analyse der Bindungsstörungen
III.1 Phänomenologie der Bindungsstörungen
1.1 Definition und Operationalisierung bindungsrelevanter Begriffe (M. Leesch)
1.2 Klassifikationen in diagnostischen Manualen (C. Volkert)
1.3 Typologie der Bindungsstörungen (C. Volkert)
1.3.1 Keine Anzeichen von Bindungsverhalten
1.3.2 Undifferenziertes Bindungsverhalten
1.3.3 Gehemmtes Bindungsverhalten
1.3.4 Aggressives Bindungsverhalten
1.3.5 Bindungsverhalten mit Rollenumkehrung
1.3.6 Psychosomatische Symptomatik
1.4 Bindungsstörungen in verschiedenen Entwicklungs- stufen anhand von Beispielen (M. Leesch)
1.4.1 Exzessives Klammern im Kleinkindalter
1.4.2 Schulangst im Schulalter
1.4.3 Suchtsymptomatik in der Adoleszenz
1.4.4 Depressive Symptomatik bei Erwachsenen
III.2 Ursachen der Bindungsstörungen
2.1 Zusammenhang zwischen Bindung und Bindungsstörung (M. Leesch)
2.2 Bindungstheoretische Konzepte
2.2.1 Ergebnisse der Deprivationsforschung (M. Leesch)
2.2.2 Konzept der Feinfühligkeit (M. Leesch)
2.2.3 Konzept der Bindungsrepräsentanzen (M. Leesch)
2.2.4 Gesellschaftshistorische Hintergründe der Bindungstheorie (M. Leesch)
2.2.5 Erkenntnistheoretische Einordnung und Bewertung der Bindungstheorie (M. Leesch)
2.3 Ursachen der Bindungsstörungen nach Brisch (C. Volkert)
III.3 Reaktionen auf Bindungsstörungen
3.1 Herkömmliche Reaktionen auf Bindungsstörungen (C. Volkert und M. Leesch)
3.2 Bindungstherapie
3.2.1 Theoretische Grundlagen (M. Leesch)
3.2.2 Praktische Implikationen (C. Volkert)
3.2.2.1 Therapie von Erwachsenen
3.2.2.2 Therapie von Kindern
3.2.2.3 Praktische Beispiele
IV. Inhalte und Ergebnisse der Resilienzforschung
IV.1 Definition des Resilienzbegriffs (M. Leesch)
IV.2 Themen und Methodik der Resilienzforschung (M. Leesch)
IV.3 Ergebnisse der Resilienzforschung (C. Volkert)
IV.4 Kritische Diskussion der Resilienzforschung (M. Leesch)
V. Praktische Implikationen der Resilienzforschung
V.1 Bedeutung der Resilienzforschung für bindungsgestörte Kinder (C. Volkert)
V.2 Bedeutung der Resilienzforschung für das eigene Leben mit Kind (C. Volkert)
V.3 Bedeutung der Resilienzforschung für die Sozialpädagogik (M. Leesch)
V.4 Grenzen des Resilienzkonzepts (M. Leesch)
VI. Zusammenfassung (C. Volkert und M. Leesch)
Anhang
Literatur
I. Einleitung
I.1 Motive
In der vorliegenden Arbeit wollen wir uns mit den Erkenntnissen der Resilienzforschung, der Forschung nach den Schutz- bzw. Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung auseinandersetzen. Hauptaufgabe ist es dabei zu prüfen, ob die Ergebnisse dieser Forschungsrichtung einen positiven Einfluss auf den Umgang mit bindungsgestörten Kindern haben könnte, bzw. ob die Frage nach den „Ursprüngen der seelischen Gesundheit“ (GÖPPEL 1997) hilfreich bei der Arbeit mit seelisch kranken bzw. auffälligen Kindern ist.
Der Begriff Bindungsstörung ergibt sich aus der Bindungstheorie und Bindungsforschung, mit der wir in unseren Praktika unabhängig voneinander vertraut wurden. Das Interesse an der Bindungstheorie ergab sich zum einen aus der Beobachtung der Beziehungen und Interaktionen zwischen Müttern und ihren Kindern in einem Mutter-Kind-Erholungsheim, zum anderen aus der Beobachtung von Kindern in Trennungssituationen in einem Kinderheim.
Die bindungstheoretische Perspektive war dabei eine willkommene Ergänzung zur uns schon vertrauten psychoanalytischen und der von den jeweiligen Anleitern praktizierten systemischen familienorientierten Perspektive.
Ein weiterer Zugang zur Bindungstheorie ergab sich aus der Lektüre zahlreicher Bücher über die Säuglingsforschung und die seelische Entwicklung in der frühen Kindheit aus Anlass der Geburt unseres Sohnes. Der warf ungewollt Fragen auf, deren Beantwortung uns durch die Beschäftigung mit der Bindungsforschung er leichtert wurde. Das Beobachten unseres Kindes und die Freude an seiner Ent wicklung in Verbindung mit unserem Studium und den Beobachtungen in den Heimen ermöglichte uns eine intensive theoretische und praktische Erfahrung in einem.
Ein weiteres Motiv waren die Erfahrungen aus unserem Projektseminar („Sucht und Psychotherapie“). Dieses haben wir z.T. wie eine Selbsterfahrungsgruppe gestaltet und dabei eigene Bindungserfahrungen zum Gegenstand der Diskussion gemacht. Zum anderen war es ein Ziel, die Ursachen für Suchterkrankungen zu erforschen, wobei wir Sucht immer auch als eine seelische Erkrankung betrachte ten. Dabei sind wir meist psychoanalytisch orientiert herangegangen - auch hier ist die Bindungstheorie eine willkommene Ergänzung. Kurz: es gab auch ein Inte resse, Sucht aus bindungstheoretischer Perspektive zu beleuchten. Deshalb be schreiben wir in den Beispielen für Bindungsstörungen auch eines, das sich auf Sucht bezieht.
Zum Schluß möchten wir aber auch den gesellschaftlichen Aspekt der Bindungs theorie hervorheben, denn eine Theorie der Entwicklung des Kindes ohne den Bezug zur Entwicklung der Gesellschaft taugt nicht für die soziale Arbeit. Zwar würde eine eingehende Auseinandersetzung mit der gesellschaftspolitischen Re levanz der Bindungstheorie den Rahmen dieser Arbeit sprengen, aber etwas sei dennoch dazu gesagt:
Eine entscheidende These der Bindungsforschung ist die, dass eine sichere Bin dung des Kleinkindes an seine Mutter (oder an eine andere wichtige Bezugsper son) die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankung in der späteren Entwick lung senkt (vgl. BRISCH 1999, S.77). Nur eine sichere Bindung ermöglicht ein freies Explorationsverhalten und das spätere Eingehen neuer dauerhafter Bezie hungen. Der Mutter als „secure base“ wird eine große Bedeutung zugeschrieben.
Diese und andere Aussagen sind nur wenig mit unserer neuen Gesellschaftsordnung, dem Global-Kapitalismus, vereinbar. Hier wird der „flexible Mensch“ (SENNET 2000) gefordert, einer, der Bindungen schnell eingehen, aber auch schnell wieder aufgeben kann, der nicht an einen bestimmten Ort („secure base“) gebunden ist. Gefordert ist der „Marketing-Charakter“, der „weder zu sich selbst noch zu anderen eine tiefe Bindung hat“ (FROMM 1989a, S.375), der sich als Ware erlebt, die es zu verkaufen gilt. Bindungen werden zunehmend als Fesseln betrachtet, weshalb der neue „Turbo-Kapitalismus“ (LUTTWAK, zit. in MARTIN/SCHUMANN 1998, S.250) entfesselt erscheint.
Flexibel (mit der Gefahr heimatlos zu sein), ungebunden (mit der Gefahr der Bin dungs- und Haltlosigkeit), entfesselt (mit der Gefahr der Enthemmung), sich als Ding fühlen, - wenn man sich die Anforderungen an den modernen Menschen ansieht, erkennt man Bindungsqualitäten, die die Wahrscheinlichkeit des Auftre tens psychischer Erkrankung erhöhen, sie erinnern an Bindungsstörungen. Es be steht demnach die Gefahr, dass unsere Gesellschaft kranke Individuen hervor bringt.
Die Bindungstheorie muss also der von unserer Gesellschaft geforderten und ge förderten Entwicklung von bindungslosen Individuen kritisch gegenüberstehen.
Ein weiterer Vorzug der Bindungstheorie ist ihre Offenheit gegenüber anderen Forschungs- und Theorieansätzen: zum einen ist sie eine wichtige Ergänzung der psychoanalytischen retrospektiven Betrachtung der kind lichen Entwicklung, zum anderen nutzt sie Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung, der Säuglingsfor schung und neuerdings auch der Hirnforschung (z.B. SCHORE 2001), sie ist kein starres Theoriegebäude (d.h. es gibt nur sehr wenige feste Grundannahmen), son dern entwickelt sich nicht zuletzt durch die ständig neuen Erkenntnisse aus den Längsschnittstudien permanent weiter.
I.2 Aufgabenstellung und Arbeitsplan
Wie schon beschrieben, ist es unsere Hauptaufgabe, die Relevanz der Resilienzforschung für die soziale Arbeit mit bindungsgestörten Kindern zu prüfen. Die Frage ist also, wodurch Bindungsentwicklung im Allgemeinen und gestörte im Besonderen beeinflusst wird und inwieweit diese Erkenntnis den Handlungsspielraum der Sozialpädagogen, Eltern und Therapeuten erweitert.
Bei der Gliederung unserer Arbeit gehen wir folgendermaßen vor: Zunächst re flektieren wir unsere eigenen Erfahrungen mit bindungsauffälligen Kinder wäh rend unserer Praktika, in denen wir mit der Terminologie und den Inhalten von Bindungstheorie und Resilienzforschung noch nicht sehr vertraut waren. Dazu beschreiben wir unsere Begegnungen mit einzelnen Kindern und Jugendlichen unter dem Gesichtspunkt von Bindung und Beziehung.
Im nächsten Teil wenden wir uns der Darstellung und Analyse der Bindungsstö rungen, wie sie von BRISCH klassifiziert worden sind, zu. Nach der Definition von bindungsrelevanten Begriffen und der Überprüfung der klassischen diagnosti schen Literatur, beschreiben wir die einzelnen Erscheinungsformen von Bin dungsstörungen und führen dazu praktische Beispiele in verschiedenen Entwick lungsstufen an.
Um die Ursachen dieser Störungen zusammenzustellen, gehen wir neben den spezifischen von BRISCH genannten Ursachen (wobei wir die schon genannten praktischen Beispiele wieder aufgreifen) auch auf die Erkenntnisse der Deprivationsund der Bindungsforschung ein. Dabei erläutern wir eingehend die für die Ursachenforschung relevanten bindungstheoretischen Konzepte und unterziehen die Bindungstheorie einer erkenntnistheoretischen Einordnung.
Bei der Erkundung der möglichen Reaktionen auf Bindungsstörungen erläutern wir zum einen die herkömmlichen Reaktionen, also die Maßnahmen der Heilpä dagogik, Heimerziehung etc. in der Arbeit mit beziehungs- bzw. verhaltensgestör ten Kindern anhand der Ergebnisse eines Gesprächs mit zwei Heilpädagoginnen, zum anderen fassen wir die von BRISCH speziell für den Aspekt der Bindungsstö rungen entwickelte Bindungstherapie unter Einbeziehung der Beispiele zusam men.
Im darauffolgenden Abschnitt beschäftigen wir uns mit den Inhalten und Ergeb nissen der Resilienzforschung. Dabei ist es uns zunächst wichtig, den Begriff der Resilienz, so gut es geht, zu umreißen, denn auf eine genaue Definition konnten sich die Forscher bisher nicht einigen. Gleichzeitig zeigt diese Auseinanderset zung mit dem Begriff schon wesentliche Schwierigkeiten bei der Bewertung und Eingrenzung von Resilienz.
Daraufhin wenden wir uns den großen Studien der Resilienzforschung zu. Erst schildern wir ihre Erkenntnisinteressen und ihre Vorgehensweise um dann die umfangreichen Ergebnisse zusammenzutragen und kritisch zu diskutieren. Hierbei ist anzumerken, dass es zur Erforschung von Resilienz explizit nur wenige Studien gibt. Wir behandeln daher eher eine Auswahl aus Studien zur Bindungs-, Risiko- bzw. Vulnerabilitäts- und Protektionsforschung. Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir selbstverständlich nicht.
Die Auseinandersetzung mit diesen Studien ist wichtig, um nun ihre praktische Bedeutung prüfen zu können. Dabei halten wir uns zunächst an die eingangs for mulierte Aufgabenstellung und diskutieren die Bedeutung für bindungsgestörte Kinder. Danach setzen wir uns mit den möglichen Auswirkungen des Resilienz konzepts auf unser eigenes Leben mit unserem Kind auseinander, was schließlich ein entscheidender Beweggrund für die Beschäftigung mit dem Thema war.
Bevor wir dann das gesamte Resilienzkonzept noch einmal kritisch diskutieren, gehen wir auf die Einflüsse desselben auf unser Berufsfeld, die Sozialpädagogik, ein.
I.3 Informationsquellen
Unsere Erkenntnisquellen für die vorliegende Arbeit sind zum einen die prakti schen Erfahrungen aus den Praktika und die tägliche Beobachtung unseres Soh nes. Diese und auch die Gespräche mit zahlreichen Fachleuten ermöglichten uns den praktischen Bezug zu unserem Thema. Hier sind die Gespräche mit unseren Praxisanleitern zu nennen, die uns das Thema Bindung und Resilienz erst nahe brachten, weiterhin führten wir ein ausführliches Gespräch zum Umgang mit bin dungsgestörten Kindern mit zwei Heilpädagoginnen und nicht zuletzt war auch die fachliche Unterstützung unseres Erstgutachters eine wichtige Informations quelle.
Zum anderen nutzten wir umfangreiche Literatur über Bindungs-, Deprivations und Resilienzforschung. Dabei spielten sowohl Bücher und Zeitschriftenbeiträge als auch Internetveröffentlichungen eine Rolle. Für den Bereich Bindungsfor schung sind neben den Klassikern von BOWLBY die neueren Beiträge von BRISCH
(1999) und DORNES (1997, 2000) zu nennen, für den Bereich der Resilienzforschung wären das GÖPPEL (1997) sowie OPP, FINGERLE, FREYTAG (1999).
II. Eigene Erfahrungen mit Bindungsauffälligkeiten
Wie bereits in der Einleitung beschrieben, sind es unter anderem unsere eigenen Praxiserfahrungen, die uns zum Thema Bindungsstörungen hinführten. In diesem Kapitel möchten wir nun konkrete Begegnungen schildern, die uns für das Vor handensein von Bindungsverhaltensweisen sensibilisierten. Dabei beziehen wir uns auf unsere Praktika in den Berufsfeldern Behindertenarbeit, Beratung von Müttern und ihren Kindern und Arbeit mit Heimkindern. Während der gesamten Beschä ftigung mit unserem Thema hatten wir diese Beispiele immer vor Augen.
II.1 Erfahrungen mit behinderten Jugendlichen (C.Volkert)
Nach meinem Abitur arbeitete ich als Praktikantin für ein Jahr in einer Einric h tung des Diakoniewerkes, in der in mehreren Gruppen Kinder, Jugendliche, Er wachsene und Senioren mit unterschiedlichen Behinderungen lebten. Ich wurde einer Gruppe mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 13 bis 30 Jahren zugeteilt, die alle als schwerstbehindert galten. Die Gruppe bestand aus acht Personen. Auch wenn mir damals die Begriffe Bindung, Bindungstheorie und Bindungsstörung nicht geläufig waren, beobachtete ich die Jugendlichen in ihren Interaktionen, ihrem Verhalten zu den Erziehern, zu ihren Eltern und auch unter einander innerhalb der Gruppe. Von einigen dieser jungen Menschen möchte ich nun berichten.
Beginnen werde ich mit S., einem dreizehnjährigen Jungen mit Down-Syndrom und schweren cerebralen Beeinträchtigungen. Meine Beziehung zu S. begann mit großen Auseinandersetzungen. Ich sollte mit S. spazieren gehen; keine leichte Aufgabe, da S. öfter beim Spazieren wütend wurde, sich dann auf das linke Ohr schlug, sich ins Handgelenk biss und sich dann schreiend auf die Erde warf und liegend weitertobte. Manchmal suchte er sich auch die Hauptverkehrsstraße aus, was dann mit großem Stress verbunden war, da man S. während eines solchen Wutanfalles nur sehr schwer wieder auf die Beine bekam, d.h. man musste ihm auf die Füße treten, ihn hochziehen, einen Arm nach hinten in den Polizeigriff biegen und vor sich herschieben, bis er aus der Gefahrenzone heraus war. Ich hat te eines Tages die Aufgabe, S. zum therapeutischen Reiten zu bringen. Der Reit stall war etwa 400 Meter vom Heim entfernt. Wir hatten kaum einen Schritt aus dem Heimgelände getan, da fing S. an zu meckern und sich aufs Ohr zu ha uen. Ich redete leise auf ihn ein, um ihn zu beruhigen, doch S. lief nur widerstrebend und lamentierend weiter. Auf der ersten Straße, die wir zu überqueren hatten, warf S. sich, wie oben beschrieben, hin. Da diese Straße wenig befahren war, versuchte ich zunächst, ihn mit beruhigenden Worten zum Aufstehen zu bewegen, was S. jedoch veranlasste, sich noch mehr zu schlagen und noch lauter zu schreien. Als dann auch noch ein Auto auftauchte, wurde ich etwas panisch und ich zerrte S. auf den Gehweg, wo er sich sofort wieder hinwarf. Ich wiederholte die ganze Proze dur und brachte S. damit ungefähr zehn Meter weiter in Richtung Reitstall. Die Reitstunde hatte inzwischen begonnen, S. schrie weiter. Ich fühlte mich hilflos und merkte, wie mir die Tränen kamen. Ich sagte zu S.: „S., ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Wenn Du weiter hier liegen willst, bitte, ich setz mich dort auf den Stein.“ Ich setzte mich also in etwa 10 Meter Entfernung hin und versuchte, mich zu beruhigen. Nach ca. zwei Minuten stand S. vor mir, scha u te mir ins Gesicht, nahm meine Hand und gab einen ermunternden Laut von sich (sprechen konnte er nicht). Ich stand auf und wir gingen zum Reitstall. Ich weiß nicht, was mit S. geschehen war, doch von diesem Zeitpunkt an, war etwas Ver trautes zwischen uns, und ich hatte nie mehr solche Probleme mit ihm. Wegen dieser entstandenen guten Beziehung wurde ich für dieses Jahr S.s Bezugsperson. Das bedeutete, dass ich zweimal je Woche eine Einzelbeschäftigung mit ihm un ternahm, seinen Geburtstag vorbereitete, mit ihm ein Zimmer während des Urla u bes in Oberbayern teilte und für die Akten die Beobachtungsbögen führte. In die sem Bezugsverhältnis hatte S. etwas sehr Vereinnahmendes. War ich in der Grup pe, wich er kaum von meiner Seite, gingen wir mit der Gruppe spazieren, lief er nur mit mir ( ansonsten fing er an zu toben). Wenn mein Dienst zu Ende war und ich gehen wollte, fing er an zu toben, und ich konnte ihn noch lange schreien hö ren. Kam ich in den Dienst, lief er mir strahlend und lallend („ra-ra-ra“) entgegen und umarmte mich. Als ich die Gruppe einmal besuchte, als mein Dienst schon über ein halbes Jahr vorüber war, begrüßte mich S. immer noch freudestrahlend. Vor mir hatte S. eine Bezugsperson, eine etwa 40-jährige Frau, an der er sehr hing, die aber die Gruppe verließ. Nach meinem Weggang suchte S. sich wieder eine Bezugsperson, eine junge Frau, die auch schon während meiner Arbeitszeit in der Gruppe war. Sein Verhältnis zu ihr war noch viel enger und klammernder als zu mir.
Über S.s Kindheit ist mir nur soviel bekannt, als dass er sehr auf seine Mutter fi xiert war. Der letzte Kontakt zu seinen Eltern lag zum Zeitpunkt meines Prakti kums schon Jahre zurück. Seine Neigung, sich unter den Mitarbeitern immer wie der eine feste weibliche Bezugsperson zu suchen, war seit seinem Eintritt ins Heim zu beobachten.
Ein anderer junger Mann, P., 20, hatte sehr guten Kontakt zu seinen Eltern, vor allem zu seiner Mutter. P. war Spastiker mit stark verkrümmter Wirbelsäule, er war auf den Rollstuhl angewiesen, konnte ohne Hilfe nur liegen, sich aber nicht fortbewegen. Auf dem Bauch liegend konnte er mit seinen stark verkrümmten Händen einen leichten Ball anstoßen. Er hatte große Probleme zu schlucken und konnte nur Brei essen. Trotz der körperlichen Einschränkungen war er ein sehr aufgeweckter junger Mann, der aufmerksam beobachtete und einen markanten Humor hatte. Einmal saß P. in seinem Rollstuhl vor mir, schaute immer wieder zur Wand hinter mir und lachte. Als ich mich umdrehte, saß da eine fette schwar ze Spinne, und ich erschrak so sehr, dass ich einen kleinen Schrei ausstieß. Dies veranlasste P., lauthals loszulachen. P. konnte nicht sprechen, mimisch jedoch ein Ja und Nein ausdrücken.
Seine Mutter holte ihn alle drei Wochenenden nach Hause und war immer sehr besorgt um ihn. Sie hätte ihm am liebsten alles abgenommen. War P. am Wo chenende zu Hause, dauerte es ein paar Tage, bis er sich wieder eingelebt hatte. Er quengelte dann viel, war unausgeglichen und wollte nicht mehr mithelfen. Trotz seiner schweren Beeinträchtigungen konnte P. beim Waschen, beim Anziehen oder beim Essen mitmachen, so dass es einfacher und schneller ging. Beim Essen z.B. hing viel davon ab, dass P. ruhig blieb und gut schluckte. Nach einem Wo chenende zu Hause hustete er grundsätzlich, fing an zu weinen, jammerte und verschluckte sich und zog das Essen in die Länge. Ich hatte damals immer den Eindruck, dass er das, was er am Wochenende von seiner Mutter gewöhnt war, nämlich dass sie ihm ständig zugewandt war, sich mit ihm beschäftigte, ihm alles abnahm, ihm jeden Wunsch von den Augen ablas, auch von uns haben wollte. Doch das konnten und wollten wir ihm nicht bie ten, einerseits war er nicht der einzige in der Gruppe, andererseits war es pädagogisch unser Ziel, seine Ressour cen auszuschöpfen und ihn so weit wie möglich aktiv am Gruppenleben zu betei ligen.
Für P. war es immer eine große Freude, seine Mutter zu sehen, es war aber auch augenscheinlich, dass er, sobald sie den Raum betrat, zu einem jammernden, vö l lig unselbständigen Menschen wurde, der ganz auf seiner Mutter angewiesen sein wollte, vielleicht auch sollte. Die Trennung nach dem Wochenende war auch immer mit Jammern verbunden und es dauerte mindestens zwei Tage, bis P. sich wieder in der Gruppe akklimatisiert hatte.
Ein Erlebnis ganz besonderer Art war das Zusammentreffen von T. mit ihrer Mut ter. T. war eine junge Frau, 27, mit Katzenschreisyndrom und cerebralen Be einträchtigungen. T. saß oft seitlich auf den Knien an der Wand und bewegte ih ren Oberkörper und Kopf, dicht an die Wand gedrängt, hin und her. Begleitet wurde dies durch einen immer gleichbleibenden Laut, dem nur die Bewegung ihres Körpers verschiedene Nuancen verlieh. T. konnte sehr aggressiv sein. Sie kratzte und zwickte dann, biss sich selbst ins Handgelenk und schlug sich mit der Faust auf den Kopf. T. hatte immer einen Fussel in der Hand, ein kleines Stück Stoff, das sie nur unter größtem Protest weglegte. T. war sehr launisch. Einer in nigen Umarmung folgte oft ein kräftige Kneifen. T.s Stimmung war nicht abzuse hen, außer wenn ihre Mutter kam. T.s Mutter holte T. alle 4-5 Monate übers Wo chenende ab. Wenn man T. dies ankündigte, konnte man merken, dass sie ange spannt war, klingelte es dann an der Tür, machte sie sich ganz steif und hatte Zu ckungen am ganzen Körper. Ging die Tür auf und ihre Mutter stand vor ihr und begrüßte sie mit ihrer tiefen Stimme, kam ein Schluchzer tief aus T.s Kehle, sie drehte den Kopf wild hin und her, schmiss sich auf die Knie, beugte ihren Ober körper auf und ab, stand auf, schwenkte ihren Fussel in der Luft herum und stürzte lachend auf ihre Mutter zu, um sie zu umarmen. Nach Aussagen ihrer Mutter war T. am Wochenende immer gut gelaunt und sehr verschmust. Kam T. vom Wochenende wieder, saß sie noch ca. 30 Minuten an der Wohnungstür, nachdem ihre Mutter gegangen war und rieb sich daran.
Bei meinem letzten Beispiel möchte ich eine Eltern-Kind- Beziehung beschreiben, die ich schon damals als sehr innig und echt empfunden habe. A. war 16, Spasti ker im Rollstuhl, Epileptiker (beinahe anfallsfrei) und geistig behindert. A. war der Sonnenschein der Gruppe. Ein fröhlicher und frecher junger Mann, der viel lachte und alles kommentieren musste mit den wenigen Lauten, die ihm zur Ver fügung standen. Fiel zum Beispiel etwas zu Boden, war prompt ein „a plumsala“ zu hören, ging irgendwer zum Zimmer hinaus, rief A. fröhlich „ziisss“.
A. war Einzelkind und wurde von seinen Eltern alle 14 Tage am Wochenende abgeholt. Zur Begrüßung lachte er laut und übersäte sie mit Küssen. Beim Ab schied war er immer ein bisschen traurig, was sich darin äußerte, dass A. für eine Weile ausgesprochen ruhig war. Seine Eltern unternahmen viel mit A. und gingen liebevoll und locker mit ihm um. An A.s sechzehntem Geburtstag ließ sein Vater ihn an der Zigarette ziehen und einen Schluck Bier trinken. A.s Kommentar: „hmmm uialaa“.
A. war einer der wenigen, der von sich aus aktiv Kontakt zu seinen Mitbewohnern aufnahm, z.B. mit „killekille“ und Kopfkraulen. Auch neuen Mitarbeitern gege n über war er sehr aufgeschlossen. Dennoch waren seine Präferenzen gegenüber ihm vertrauten Menschen sehr deutlich. Das zeigte sich unter anderem daran, dass er nur seiner Bezugsperson einen Kuss gab.
Die Erfahrungen, die ich mit diesen schwer geistig behinderten Menschen machte, ermöglichten mir Empfindungen, die von hilflos bis begeistert reichten. Anfangs fühlte ich mich hilflos, weil mir nicht recht klar war, wie ich mit diesen jungen Leuten, die nicht sprechen konnten und von denen ich nicht wusste, wie viel und was überhaupt sie verstehen können, in Kontakt treten sollte. Ich war hoffnungs voll, als ich merkte, dass sie reagierten, wenn ich sie ansprach und ihrerseits auf mich zukamen, indem sie mich anlächelten, mir etwas zum Spielen in die Hand drückten oder sich beim Singen neben mich setzten. Mir machte es Freude, mit ihnen einzeln etwas zu unternehmen, ich genoss das Zusammensein, war aber auch enttäuscht, wenn der- oder diejenige sich danach schnell wieder etwas ande rem zuwandte. Bei Episoden, wie der mit S. fühlte ich Verzweiflung in mir ange sichts der unüberwindbar scheinenden Schwierigkeit und große Freude darüber, dass sich daraus etwas entwickelte, was unsere Beziehung vertiefte.
Mitunter fiel es mir schwer, mit meinen Sympathien für bestimmte Bewohner, aber auch mit meinen Abneigungen gegen bestimmte Verhaltensweisen, z.B. das unaufhörliche Gequengel von P. oder das schmerzhafte Kneifen von T. umzuge hen. Ich merkte dann, wie ich wütend wurde und auch unangemessen reagierte. Im Laufe der Zeit versuchte ich, diese Verhaltensweisen nicht isoliert zu sehen, sondern eingebunden in die Persönlichkeit des- oder derjenigen, in die vorliege n de Situation und die durch die geistige Behinderung reduzierten Verhaltensalter nativen. Diese Betrachtungsweise verhinderte nicht, dass ich wütend wurde, machte mir aber die Bandbreite meiner eigenen Verhaltensalternativen deutlich.
Die Eltern-Kind-Beziehungen interessierten und berührten mich sehr. Ich emp fand Freude über das Verhältnis zwischen A. und seinen Eltern, war immer wie- der erstaunt über die ekstatische Freude von T. beim Anblick ihrer Mutter und meist etwas genervt bei der „Betüddelung“ von P. durch seine Mutter. Diese Empfindungen ließen mich über mein eigenes Verhältnis zu meinen Eltern nachdenken und darüber, wie unsere Beziehung auf andere wirken mochte und darüber hinaus eine Wunschvorstellung entwickeln, wie die Beziehung zwischen mir und meinem (damals noch ungeborenen) Kind sein sollte.
II.2 Erfahrungen mit Müttern und ihren Kindern während einer MutterKind-Erholungskur (C. Volkert)
Im Rahmen meines Studiums der Sozialarbeit/-pädagogik absolvierte ich mein zweites Praktikum in einer Mutter-Kind-Kurklinik. In der Regel reisten dort Müt ter mit ihren Kindern für drei Wochen an, um sich zu erholen. Neben der medizi nischen Behandlung und der Physiotherapie gab es für die Frauen auch sozialpä dagogische und therapeutische Angebote, wie z.B. Einzelgespräche, themenzent rierte Gruppengespräche und Kreativangebote. Für die Kinder gab es Gruppen, in denen sie von 8.00 - ca. 16.00 Uhr betreut werden konnten. Meine folge nden Ausführungen entstammen eigenen Beobachtungen, Erzählungen der Mütter oder der Erzieherinnen. Sie dienen keinesfalls als Grundlagen für eine Diagnose, son dern eher als Beispiele für das Verhalten von Müttern und ihren Kindern, was im Hinblick auf die Bindungstheorie und ihre Auswirkungen von Interesse ist.
Frau P.
In einem Aufnahmegespräch, in dem zu Beginn der Kur die Ziele der Patientin besprochen werden, saß mir Frau P. gegenüber. Sie machte auf mich einen sehr nervösen Eindruck. Sie hatte ihren kleinen Sohn, etwa sieben Monate alt, auf ih rem Schoß. Während des Gesprächs sprach sie sehr schnell und sprang von einem Thema zum nächsten. Es war ihr nicht möglich, Wünsche zu formulieren oder Ziele für sich zu bestimmen. Sie äußerte zwar Interessen, zog auch in Erwägung, dieses und jenes auszuprobieren, verwarf dies aber Augenblicke später. Ihr eigent licher Grund für diese Kur seien die Schwierigkeiten mit ihrem älteren Sohn, dem ADHS diagnostiziert worden war. Frau P. war beim Sprechen sehr hektisch und gestikulierte wild, was ihren kleinen Sohn zunehmend unruhiger machte. Frau P. versuchte ihn zu beruhigen, indem sie ihn an die Brust anlegte. Während des Stil lens sprach sie jedoch unverändert hektisch weiter, so dass ihr Sohn von der Brust abließ und weinte. Wir mussten dann das Gespräch vorzeitig beenden.
Frau P. weigerte sich, ihren Sohn in die Kindergruppe zu geben. Für die Dauer ihrer medizinischen Anwendungen wurde er von einer Mitarbeiterin einzelbetreut. Die Übergaben waren immer sehr hektisch. Die Mutter redete ununterbrochen auf ihr Kind ein, bestätigte ihm, dass sie bald wieder da sei, während ihr Sohn mit starrem Blick dasaß und sich still verhielt. Er blieb auch still, wenn seine Mutter weg war, solange man ihn in seinem Kinderwagen sitzen ließ. Dieser Wagen muss für ihn eine sehr große Sicherheit bedeutet haben, denn schon der kleinste Ver such ihn herauszuheben, führte dazu, dass der Kleine anfing zu schreien. Dies war nicht nur bei Fremden zu beobachten, sondern auch bei seiner Mutter.
Frau M.
Frau M. reiste mit zwei Söhnen an, von denen der jüngere kleinwüchsig und bei nahe vollständig gehörlos war. Frau M. erzählte schon bei der Anreise bei jeder Gelegenheit von der Behinderung ihres Sohnes. Ihr Sohn sprach Gebärde und Frau M. hatte zur Einführung in die Gebärdensprache Videokassetten dabei, die sie vorführen wollte. Frau M. hatte genau geplant, was sie alles auf der Kur ma chen wollte und begann sogleich damit, alles einzufordern. Frau M. sprach sehr schnell, suchte sofort Kontakt zu den Mitarbeitern, die sie alle in kürzester Zeit beim Namen kannte und versuchte, diese für ihre Zwecke in Anspruch zu ne h men. Sie geriet in einen regelrechten Termintaumel, in den sie ihre Söhne mit ein bezog, was dazu führte, dass besonders der jüngere Sohn unruhig war und nicht von ihrer Seite wich.
In Gesprächen ergab sich, dass Frau M. die Behinderung ihres Sohnes nicht recht verarbeitet hatte und sich aus schlechtem Gewissen sehr engagierte, damit er alles
bekam, was möglich war. Durch diese Kraftakte ging sie sehr an ihre Grenzen, überforderte sich und ihre Familie. Im Laufe der Kur gelang es Frau M. mit Hilfe der Psychologin, sich ihre Zeit so einzuteilen, dass sie genug Ruhe hatte, die für sie richtigen Angebote nutzen und sich darüber hinaus genug Zeit für ihre Kinder nehmen konnte. Die Kinder waren, nach anfänglicher Gegenwehr der Mutter, bei de in derselben Kindergruppe und schienen sich dort wohlzufühlen. Als Frau M. das merkte, fiel es ihr leichter, ruhiger zu werden und sich um sich selbst zu kümmern, was wiederum ihren Kinder half, die Zeit der Kur zu genießen.
Frau L.
Frau L. betonte im Aufnahmegespräch nachdrücklich, dass sie nicht wegen sich, sondern wegen ihrer Kinder zur Kur gekommen sei. Frau L. beantwortete alle meine Fragen sorgfältig, reagierte jedoch auf jede Anregung, jeden Vorschlag, der ihrer Erholung und ihren Interessen dienlich war, mit Ablehnung. Ihrem älteren Sohn (8) war ADHS diagnostiziert worden und er bekam Ritalin. Ihr jüngerer Sohn machte ihr große Sorgen, weil sie an ihm auch einige Anzeichen für ADHS entdeckt hatte. Ihr Ziel war, ihre Kinder beim Kinder- und Jugendpsychotherapeu ten vorzustellen und viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Davon ließ sie sich auch nicht abbringen. Frau L. nahm außer den medizinischen Verordnungen und der Kinderberatung nichts in Anspruch und hatte die Kinder auch nur während dieser Zeit in den Kindergruppen. Die restliche Zeit verbrachte sie mit ihren Kindern.
Bei den Begegnungen mit den unterschiedlichen Frauen und vor allem in den Gesprächen beschäftigten mich vor allem zwei Aspekte, mein Anspruch, mich professionell zu verhalten einerseits und meine Gefühle und Empfindungen im Aufeinandertreffen mit den unterschiedlichen Frauen andererseits.
Das Bestreben danach, meine Aufgaben, wie eben z.B. das Führen von Anfangs gesprächen, gewissenhaft und auch professionell durchzuführen, veranlassten mich u.a. dazu, mich auf meine Gespräche gut vorzubereiten, mir sinnvoll er scheinende Gesprächstechniken zu üben, mich im Gespräch mit meiner eigenen
Meinung zurückzuhalten und zu versuchen, genau zuzuhören, um Stimmungswechsel, Unstimmigkeiten etc. wahrzunehmen. Außerdem reflektierte ich jedes Gespräch mit meiner Anleiterin und auch mit meiner Supervisorin.
Während ich in den Gesprächen versuchte, meine Vorstellungen umzusetzen, merkte ich jedoch, dass meine Gefühle gegenüber der Frau, gegenüber dem Gehörten in den Vordergrund meines Denkens gerückt waren, dass ich wertete und urteilte und es mir schwer fiel, mich mit meiner Meinung zurückzuhalten. Dies traf genauso bei sämtlichen anderen Interaktionen mit den Frauen zu. So fühlte ich mich durch die Art von Frau M., mich für sich einzuspannen, völlig überfa h ren. Ich wurde wütend auf mich, weil ich damit nicht adäquat umgehen konnte und mich dabei ertappte, ihr aus dem Weg gehen zu wollen.
Von Frau L. fühlte ich mich abgewiesen. Die Hartnäckigkeit, mit der sie an ihren Vorstellungen festhielt und ihre von mir empfundene Kühle interpretierte ich als eine Absage an meine Bemühungen, ihr zu helfen, als eine Ablehnung meiner Person.
Frau P.s hektische Art ließ auch bei mir Unruhe aufkommen und ich spürte Ungeduld und mit ihr den Wunsch, dieser Frau doch mal zu sagen, dass es bei ihrer hektischen Art kein Wunder sei, wenn ihre Kinder auffällig sind.
Manchmal erschreckten mich diese Gedanken sehr, aber durch die Gespräche mit meiner Anleiterin wurde mir klar, dass solche Gefühle nicht ungewöhnlich sind. Bei den Gesprächen und anderen Interaktionen zwischen den Frauen und mir ging es nicht selten um persönliche Themen, weshalb sich auch eine persönliche Art von Beziehung entwickelte. Der Umstand, dass diese Beziehungen keine privaten, sondern professionelle zwischen Sozialpädagogin und Patientinnen wa ren, machte es für mich erforderlich, meine eigenen Gefühle zu reflektieren und verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen. Es ging mir dabei nicht vordergründig darum, ob meine Gefühle bzw. Einschätzungen richtig sein könnten oder nur Pro jektionen sind, die allein mit mir zu tun haben, sondern darum, was es für eine Wirkung haben könnte, wenn ich sie unreflektiert äußern würde.
Ich stellte mir also die Frage, was es zur Folge gehabt hätte, wenn ich das Verha l ten von Frau L. als persönliche Beleidigung aufgefasst, ich Frau P. meine Mei nung ins Gesicht gesagt oder wenn ich Frau M. aus dem Weg gegangen wäre.
Für alle drei Fälle fand ich die Antwort, dass einer eben im Aufbau befindlichen Beziehung von meiner Seite ein Bruch zugefügt worden wäre, der höchstwahrscheinlich die Chance zunichte gemacht hätte, eine Basis für eine vertrauensvolle professionelle Beziehung zu schaffen, auf der es dann möglich und vielleicht auch hilfreich sein könnte, die eigenen reflektierten Eindrücke zu äußern.
II.3 Erfahrungen mit Heimkindern (M. Leesch)
Während meines 4 1/2- monatigen Praktikums in einem Kinderheim begegneten auch mir viele Kinder mit einem mir zu jener Zeit nicht ganz nachvollziehbarem Verhalten. Ich konnte die ganze Bandbreite von Bindungsverhalten mir gegenüber erleben - von enthemmt bis klammernd. Jedoch wagte ich in dieser Zeit keine genauere Einstufung, zumal mir die Grenzen zwischen dem breiten Spektrum der ganz normalen Verhaltensmöglichkeiten und den psychopathologischen Fällen fließend erschienen. So beschränke ich mich hier auf die sehr auffälligen Beispie le:
A.
Bei einem unserer ersten Rundgänge im Kinderheim (ich kannte bisher niema n den), kam A. auf mich und meinen Praxisanleiter zu. Sie war sehr schlank und für ihr Alter (13) normal groß, ihre Augen waren weit aufgerissen, ihre Haare unge kämmt. Ohne uns zu begrüßen und mich erkennbar als Fremden wahrzunehmen, sagte sie, dass ihr die Vagina (sie verwandte den kindlicheren Ausdruck „M u schi“) wehtue. Es war keine Provokation in ihrem Gesichtsausdruck, aber sie sah gerade und auf Erwiderung wartend in mein Gesicht. Ich war einigermaßen irri tiert, da griff mein Anleiter ein und verwies sie an ihre Erzieherin. A. fiel mir
noch oft durch diese distanzlos wirkenden „Beziehungsangebote“ auf, sie merkte sich keine Namen, fand aber Ersatz: Mich nannte sie „Skelett“. Wie sich im Ver laufe meines Praktikums zeigte, hatte A. keine Freunde, spielte fast ausschließlich allein und interessierte sich besonders für biologische Themen wie Anatomie, womit sie bei den Gleichaltrigen auf Ablehnung stieß. Dieses Interesse ging u.a. so weit, dass sie einmal ein lebendiges Meerschweinchen „zerlegte“, nur um, wie sie später sagte, zu sehen, wie es von innen aufgebaut ist. Ein weiteres auffälliges Symptom war, dass sie nachts nur sitzend mit angezogenen Knien und einem über den Kopf gezogenen T-Shirt schlafen konnte. Ihr Verhalten anderen gegenüber würde ich also folgendermaßen beschreiben: Zu jüngeren und gleichaltrigen Kin dern verhielt sie sich beinahe gar nicht, sie isolierte sich, nahm am Gruppendasein im Heim nicht teil; zu Erwachsenen verhielt sie sich einerseits enthemmt, kannte keine Schwellenangst, andererseits waren die Fragen, die sie stellte nur indirekt bindungsrelevant.
Wie dem Jugendamt bekannt war, lag in A.s Entwicklung die Erfahrung mit sexu ellem Missbrauch durch den Vater vor. Die Mutter, die ich einmal während einer Helferkonferenz erlebte, war Alkoholikerin. Zur erwähnten Konferenz erschien sie nüchtern, aber mir fiel auf, dass alle Bemerkungen ihrerseits, die in Richtung Beziehung zu ihrer Tochter zielten, sehr formal waren, d.h. ich konnte wenig emotionale Beteiligung spüren. Ich vermute, dass A. nie eine sichere Bindung zu jemandem entwickeln konnte. Ihre verbale Distanzlosigkeit, die im Kontrast zu ihrer extremen physischen Distanzhaltung steht, ihre ausgesprochen rationalisti sche Art zu kommunizieren, der (in ihrem Alter) offenbar lebensverneinende Um gang mit Tieren (symbolisch ist auch, dass sie für Tiere, die die meisten ihres Al ters als niedlich empfinden, viel weniger Interesse zeigte als für Insekten wie Spinnen, Skorpione etc.) und ihre Vermeidung von Kontakten zu Gleichaltrigen weisen auf eine Störung ihrer Beziehungsfähigkeit hin.
Ich war mir nicht sicher, ob die Unterbringung in der heilpädagogisch betreuten Wohngruppe des Kinderheims allein zu einer Besserung ihres Zustands führen würde. Gerade die Missbrauchserfahrung ohne Vorhandensein einer verlässlichen, vertrauenswürdigen Bezugsperson legen die Vermutung einer Traumatisierung nahe, so dass mir eine psychotherapeutische Behandlung angebracht erschien.
P.
In der heilpädagogisch orientierten Wohngruppe erlebte ich P., einen kleinen sie benjährigen Jungen. Er hatte ein freundliches Gesicht mit etwas verdrehten Au gen, so dass selten ein Blickkontakt entstand, offenbar litt er an einem Augenfe h ler, denn dicke Brillengläser erschwerten das sich In-die-Augen-Sehen noch mehr.
P. war sehr unruhig, konnte kaum einmal still stehen oder sitzen (ein Arzt dia g nostizierte ADHS). Nachdem ich ihm vorgestellt wurde - die Erzieher freuten sich über meine Aushilfe in dieser Gruppe, denn sie sahen ruhige Zeiten kommen, wenn ich mich allein um P. kümmerte - musterte er mich nur kurz, doch ab die sem Zeitpunkt bezeichnete er mich als seinen besten Freund. Er nahm mich bei nahe überall mit hin, rannte zum Parkplatz, wenn ich mit dem Auto ankam, öffne te mir die Tür, hofierte mich quasi. Wenn ich ging, war ihm der Abschied jedes Mal schwer, manchmal stellte er sich sogar vor das Auto, so dass ich nicht losfa h ren konnte. Während unserer langen Spaziergänge - ich ließ ihn meist den Weg bestimmen und merkte, wie die Kreise um das Kinderheim immer weiter wurden erzählte er viel von sich, nur nichts aus seiner Vergangenheit oder Familie, jedoch war er an meiner Familie sehr interessiert. Oft nahm er meine Hand, hielt sie ganz fest. Auch im Kinderwohnhaus drückte er sich häufig fest an mich und verkündete den anderen Kindern, die mich oft zum Spielen einluden, dass ich ihm gehöre, obwohl niemand explizit sagte, dass ich mich tatsächlich speziell um ihn küm mern sollte. Wenn meine Grenzen erreicht waren (ich hatte vielleicht etwas ande res zu tun oder wollte auch mal allein sein), konnte er das nur schwer akzeptieren; das Ende meines Praktikums wollte er nicht wahrhaben, fragte immer, wann ich wiederkäme. Ich erlebte P. als klammernd. Auch er hatte fast keine Freunde (bis auf mich) und spielte, wenn ich nicht da war, allein.
F.
Ein drittes Beispiel ist F.. Er war zur Zeit meines Praktikums 15 Jahre alt, wohnte seit acht Jahren im Kinderheim und ging auf eine Förderschule für Lernbehinder te. Dort hatte er große Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und Beziehungen aufzubauen, war aggressiv, so dass er schon des öfteren vom Unterricht suspen diert werden musste. Man vermutete bei ihm einen Gehirnschaden (Befund lag zu der Zeit noch nicht vor), der zur Einschätzung der geistigen Behinderung hätte führen können. Zur Zeit der Kontaktaufnahme zu mir war er wegen der Schul probleme vom Unterricht für zwei Wochen suspendiert. In dieser Zeit musste für ihn eine Beschäftigung im Haus gefunden werden. Auch kam heraus, dass er von der Schule aus ein berufsorientierendes Praktikum (1 Tag pro Woche, 6-8 Stun den) durchführen musste. Der Schule, die diese Praktika organisierte, war es nicht möglich, für F. eine Stelle zu finden, da kein Arbeitgeber ihn auf Grund seiner Besonderheiten beschäftigen konnte/wollte.
Ich beobachtete, dass F. in der Zeit seiner Suspendierung hier im Haus von einer Beschäftigung zur anderen taumelte: Es gab niemanden, der für ihn da sein konn te, die Wirtschaftskraft seiner Wohngruppe schaffte es nicht, ihn mehr als eine halbe Stunde an eine Tätigkeit (Aufräumen, Wäschewaschen etc.) zu binden. Er ging den Hausmeistern helfen, deren Aufträge ihn überforderten, er half, den Zie genstall auszumisten und brach nach wenigen Minuten ab, kam zu mir, wollte reden und spielen, aber hatte nach 20 Minuten plötzlich einen „Termin“. Ich sprach ihn auf sein Praktikum und seine Untersuchungen an, doch er hatte von beidem keine rechte Vorstellung. Es entstand bei mir die Idee, dass er sein Prakti kum im Heim absolvieren könnte. Schließlich rückte er mit dem Wunsch heraus, bei mir ein Praktikum zu machen. Ich erklärte ihm, welche Anforderungen mein Beruf stellt und dass ich glaube, dass er dies nicht schaffen kann, dass ich vor al lem selbst nur Praktikant bin. Ich bot ihm einen weiteren Gesprächstermin am nächsten Tag um 11 Uhr an. Zwische ndurch kam er noch einmal und wünschte, dass ich mit ihm etwas baue. Ich nahm seinen Wunsch zur Kenntnis und verwies ihn nochmals auf den Gesprächstermin. Er kam noch oft an diesem Tag.
Vor einiger Zeit unternahm ich mit ihm eine Fahrradtour, bei der wir uns ein we nig anfreundeten, jeder erzählte aus seinem Leben, vielleicht ist da bei ihm der Eindruck entstanden, ich könne bauen oder basteln (der Eindruck war richtig).
Diese Öffnung beiderseits bewirkte, dass er nun des öfteren mit sogenannten Be ziehungsangeboten („Wie geht´s?“, mehrere Begrüßungen mit Händedruck am gleichen Tag, Frage nach Zigaretten, wie lange ich hier bliebe, was ich vorhätte etc.) an mich herantrat. Die Berührung war für ihn wichtig (Händedruck, Schul terklopfen). Die ungewöhnlich häufige Kontaktaufnahme ohne praktischen Grund empfand ich als penetrant, reagierte aber nicht abweisend, auch nicht unterstüt zend. An diesen Handlungen entdeckte ich seine unbedingte Lust, Beziehungen aufzunehmen, die aber keinen anderen Hintergrund hatte, als eben Beziehung auf zunehmen. Er mochte mich eventuell deshalb, weil ich keine Anforderungen an ihn stellte wie die anderen Bezugspersonen. Ich vermutete daher, dass es ihm beim Praktikumsproblem primär um mich - weniger ums Bauen - ging. Er reali sierte nicht, dass die meisten Beziehungen über eine Aufgabe/Tätigkeit aufgebaut werden sollen.
Was das Praktikum anging, bemühten wir (mein Praxisanleiter und ich) uns dann um eine Stelle in einer Behindertenwerkstatt, wobei wir mit dem Problem kämpf ten, dass diese normalerweise keine Einrichtung der Jugendhilfe, sondern des BSHG, also für Jugendliche ab 18 Jahren ist. (Ein Beispiel dafür, dass es in dieser Gesellschaft schwierig ist, passende Möglichkeiten für die so unterschiedlichen Bedürfnisse sozial Benachteiligter zu finden, bzw. dass diese Schwierigkeiten soziale Benachteiligung erst ausmachen.) Bis dieses Praktikum beginnen konnte, haben wir verabredet, dass ich am schulfreien Tag mit F. „etwas bauen“ werde. Dabei sollte behutsam für F. klar werden, dass er durch diese Tätigkeit Beziehung zu mir leben kann. Weiterhin hielten wir es für sinnvoll, dass er mit uns Termine für Gespräche vereinbarte, die er einhalten konnte und musste, d.h. wir akzeptier ten Gespräche außerhalb der Termine nur bei schwerwiegenden Problemen.
Nach zwei Tagen stellte sich heraus, dass er nun auch Probleme mit den Mitglie dern und Erziehern der Wohngruppe (i.F.: WG) hat, die sich aggressiv äußerten. Dies hat in ihm den Wunsch ausgelöst, in eine andere WG zu gehen oder sogar draußen zu schlafen. Die Wut auf alle anderen zeigte sich auch darin, dass er, als er unseren Raum betrat, diesmal nicht die Hand gab, sogar auf einen Gruß ver zichtete. Er sprach diffuse Vorwürfe aus und wollte das Gespräch nach unserem Nachfragen abbrechen, weil er eigentlich zum Einrichtungsleiter gehen wollte. An dieser Stelle hätte ich ihn nicht aufgehalten, ihm nur das Angebot gemacht, wieder hierher zu kommen. Mein Praxisanleiter fürchtete jedoch auf Grund der längeren Bekanntschaft mit F. seine unberechenbaren Anfälle, da er sich eventuell vom Leiter abgewiesen fühlen könnte. Im Gespräch wurde dann versucht, die Situation zu klären, praktische Möglichkeiten abzuwägen etc. mit dem Ergebnis, dass er doch wieder in seine WG zurück müsse, weil nirgends sonst Platz war. Das musste er meines Erachtens dann wirklich als Abweisung verstehen.
Zwei Wochen später besuchten wir mit ihm die Behindertenwerkstatt, die Aufgaben dort entsprachen seinen Bedürfnissen. Es gab dort viele Menschen mit auffälligeren Besonderheiten. F. würde dort zum ersten Male erleben, dass es Menschen gibt, die auch oder noch mehr Schwierigkeiten haben, Anforderungen zu entsprechen. Das Praktikum sollte aber erst nach einem Monat beginnen, so dass noch Zeit für die Beschäftigung mit mir blieb.
Einen Tag nach dem Besuch in der Behindertenwerkstatt rief die Schule von F. an, dass er randaliere, die Lehrerin angreife, dass wir ihn abholen sollen. Als wir dort ankamen, hatte er sich schon etwas beruhigt, wollte aber noch nicht mitkom men, weil er die Le hrerin noch schlagen wolle. Er gilt dort als sehr aggressiv, die Atmosphäre war, als sollten wir einen Schwerverbrecher abholen. Auf mich wirk te F. aber nicht aggressiv, und ich war bei keiner aggressiven Handlung dabei. Wir redeten ruhig mit ihm, dem ich keine Drohung so richtig abnehmen konnte. Er wirkte mit seiner hohen Stimme und seiner etwas fülligen Gestalt auf mich eher tollpatschig. Der Konflikt zwischen seiner Lehrerin und ihm ging wahr scheinlich von einer Anforderung aus, die er als Provokation empfand. Überhaupt reagierte er an diesem Tag äußerst sensibel. Wieder im Kinderheim angekommen, hatte er gleich den nächsten Konflikt mit einer Erzieherin aus seiner WG; er hatte sich wieder provoziert gefühlt.
Wir hatten ihm noch vor der Schule eine (von ihm gewünschte) Zigarette gege ben, weil ihn das etwas beruhigte. Wir wussten, dass er häufig rauchte, so wie viele andere unter 16 Jahren hier. Wir haben diese Zigarette „Friedenspfeife“ ge nannt, um sie zu symbolisieren, sie als Ausnahme zu kennzeichnen. Er kam aber an diesem Tag noch öfter und bat um Zigaretten, schließlich gab es ja immer wie- der Grund sich zu beruhigen. Doch ich gab ihm keine mehr, weil ich wieder er kannte, dass die Zigarette bei ihm im Allgemeinen (bei mir im Besonderen) wie der eine Krücke zur Kontaktaufnahme bildete: Gebe ich ihm keine, fühlt er sich selbst abgelehnt. Gleichzeitig bot ich ihm aber das Gespräch an. Dieses Angebot nahm er an, schweifte aber sehr schnell ab und fragte immer wieder nach einer Zigarette. Ich fragte ihn, ob er malen könne und gab ihm Papier. Auf diese Weise konnte er bei mir sein. Als er keine Lust mehr hatte (nach etwa 10 Minuten), frag te er, ob er jetzt gehen könne. Ich sagte ihm, dass er ja gehen könne, wann er will, denn er sei schließlich freiwillig hier. Damit konnte er nichts anfangen. Dann fragte er wieder nach einer Zigarette und ich erklärte ihm noch einmal, dass ich es nicht billige, wenn man so früh mit dem Rauchen beginnt und dass ich den Ein druck habe, er komme wie ein Hund zum Herrchen, um nach Futter zu betteln, dass ich aber wünschte, dass es nicht das Futter (die Zigaretten) sei, was uns ver bindet, sondern das Einander- Zuhören. Er schien es verstanden zu haben, fragte nach einer halben Stunde aber wieder nach einer Zigarette - er wusste anders kei nen Kontakt aufzunehmen.
Dann kam der erste Tag, den ich für ihn reserviert hatte, da sein Praktikum noch nicht begonnen hatte. Wir nahmen uns vor, etwas zu bauen, aber nur etwas nützli ches. Es gab die Möglichkeit, für den Komposthaufen eine Einfassung anzuferti gen. Dafür war es aber zunächst nötig, den Haufen aufzuschütten. Das war natür lich nicht die Arbeit, die sich F. vorgestellt hatte. Ich machte ihm deutlich, dass dies die einzige Möglichkeit sei, an diesem Tage etwas mit mir zu unternehmen. Schließlich ließ er sich darauf ein, wollte aber ständig Raucherpausen einlegen. Ich ignorierte seine Forderungen und arbeitete weiter, auch ihm blieb nichts wei ter übrig. Nach der Mittagspause erschien er nicht wie verabredet wieder. Seine Erzieherin hatte ihm gesagt, er solle zunächst seine Hausaufgaben erledigen. Er war offenbar nicht in der Lage, ihr zu sagen, dass heute sein Praktikumstag ist, und außerdem hatte er keine Lust mehr zu arbeiten. Ich verdeutlichte ihm noch einmal die Situation und konnte ihn doch noch zur Beendigung der Arbeit ermun tern. Am Ende konnten wir einen schönen Komposthaufen präsentieren - F. war stolz. Er fragte gleich nach dem nächsten Praktikumstag, doch ich wies ihn darauf hin, dass er dann ja schon in der Behindertenwerktstatt sei.
Dazu kam es vorerst aber doch nicht, denn er musste wegen einer Medikamentenumstellung (er bekam starke Beruhigungsmittel) ins Krankenhaus. Dort war er mehrere Wochen, es wurden auch umfangreiche Untersuchungen gemacht, von denen es abhing, was weiter mit ihm geschehen sollte.
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus stand für die Erzieher von F.s WG fest, dass sie auf seine spezifischen Bedürfnisse nicht mehr eingehen könnten. F. war in ein Alter gekommen, in dem ihm die Unterschiede zwischen ihm und sei nen Bezugspersonen immer mehr bewusst wurden. Die Anforderungen in der Schule gingen über F.s Grenzen hinaus. Kurz: Es musste eine andere Einrichtung gefunden werden. Das einzige Argument gegen einen Einrichtungswechsel war die Tatsache, dass F. schon sehr oft die Bezugspersonen und Häuser wechseln musste.
Die hier geschilderten Begegnungen waren für mich zwar nicht die ersten aber die intensivsten mit verhaltensauffälligen Kindern. In den ersten beiden Beispielen war ich noch etwas hilflos im Umgang mit ihnen, im Beispiel von F. stellte ich mir dann schon Prinzipien auf, die allerdings nicht durch ein spezielles sozialpä dagogisches Handlungskonzept fundiert waren. Alles drehte sich um den Konflikt zwischen Nähe und Distanz, Bedürfnis und Anforderung von außen.
Bei mir persönlich blieb oft ein Gefühl der Enttäuschung zurück. Zwar wusste ich einiges über die Beziehungsfähigkeit der Kinder, aber das Wissen darum allein verhinderte dieses Gefühl nicht. Die Enttäuschung lag darin, dass meine Sicht auf einmal entstandene Beziehungen sich von der Sicht der Kinder unterschied. Be sonders bei den Jugendlichen glaubte ich oft, durch ein paar Gespräche und Un ternehmungen die Basis für eine vertrauensvolle Beziehung geschaffen zu haben mir wurde aber nicht vertraut, nicht anvertraut. Diese Enttäuschung gestand ich mir zwar ein, aber ich wusste keine praktischen Konsequenzen daraus zu ziehen. Eine Möglichkeit, Enttäuschungen aus dem Wege zu gehen, ist, die Erwartungen an eine solche Beziehung nicht zu hoch anzusetzen, doch genau diese „Strategie“ wollte ich nicht verfolgen, denn sie ist oft die Strategie der Kinder: nichts von der
Bezugsperson erwarten. Der Unterschied zwischen mir und den meisten der Heimkinder ist die Erfahrung bzw. Nicht-Erfahrung verläßlicher vertrauensvoller Beziehungen in der frühen Kindheit, aber diese Erfahrung ist die Ursache für die Fähigkeit, vertrauensvolle Beziehungen einzugehen.
So, wie die Kinder sich schon ihres Anders-Seins gewahr wurden, musste ich mir meines Anders-Seins bewußt werden. Und dies ist auch meine Einsicht aus diesen praktischen Erfahrungen: Es kommt nicht darauf an, der Enttäuschung, die immer ersteinmal entsteht, aus dem Wege zu gehen, sondern den anderen in seinem Anders-Sein zu erkennen und zu verstehen. Es ging und geht mir also darum, eine Möglichkeit des Erkennens und Verstehens zu finden.
Nachdem das mir vertraute psychoanalytisch orientierte Konzept zwar half, Ursa chen und Zusammenhänge der einzelnen Störungen zu vermuten, bot das mir von meinem Anleiter nahegebrachte Konzept der Bindungstheorie endlich auch einen Ausblick auf spezielle, an den Bedürfnissen des Einzelnen ausgerichtete Reakti onsmöglichkeiten. Das konkrete Erleben eigener Unsicherheit im Umgang mit bestimmten Menschen beflügelte mich, das Konzept der Bindungsstörungen ein gehend zu studieren.
III. Darstellung und Analyse der Bindungsstörungen
III.1 Phänomenologie der Bindungsstörungen
1.1 Definition und Operationalisierung bindungsrelevanter Begriffe
Bindung
Ausgangspunkt für die Theorie der Bindung ist die angeborene Neigung des menschlichen Kleinkindes, die Nähe einer vertrauten Person zu suchen. Be sonders wenn es sich müde, krank, unsicher oder allein fühlt, aktiviert es beob achtbare Bindungsverhaltensweisen wie Lächeln, Schreien, Anklammern und Nachfolgen, um die Nähe zur vertrauten Person wiederherzustellen (vgl. DORNES 1999, S. 221).
Bindungsverhaltensweisen richten sich im Laufe des ersten halben Lebens jahres immer mehr auf eine oder mehrere Hauptbezugsperson(-en).
„Das diesen Verhaltensweisen schließlich zugrundeliegende Gefühl der Bindung oder Gebundenheit ist ein (...) gefühlsmäßiges Band, daß sich im Laufe der interaktiven und kommunikativen Erfahrung, die der Säugling mit seinen Betreuungspersonen macht, ausbildet“ (DORNES 1999, S. 221).
Bindungsqualität und ihre Messung
Mit einem Jahr lässt sich eine bestimmte Qualität der Bindung des Säuglings an seine Bezugspersonen feststellen. Es gibt vier Hauptkategorien der Bin- dungsqualität: Typ A „unsicher vermeidend gebunden“, Typ B „sicher ge- bunden“, Typ C „unsicher-ambivalent gebunden“ und Typ D „desorgani- siert/desorientiert gebunden“ (vgl. DORNES 1999, S. 225 f., ENDRES UND HAUSER 2000, S. 11, BRISCH 1999, S. 46 ff.). BRISCH verweist darauf, dass „die ursprüng lichen Muster der Bindungsqualitäten (...) spezifische Adaptionsmuster im Rah- men durchschnittlich normaler Mutter-Kind-Beziehungen sind“ (BRISCH 1999, S. 77), d.h. sie weisen noch nicht auf psychische Störungen hin. Klassifizierbar wer den diese Qualitäten nach der sog. Fremden-Situation (vgl. DORNES 1999, S.222 ff.). Diese Prozedur besteht aus 8 Episoden, in denen das Kind u.a. mit der Tren nung und Wiederkehr der Mutter konfrontiert wird. Das beobachtbare Verhalten des Kindes wird genau aufgezeichnet und kann dann einer der Qualitäten zuge ordnet werden.
Eine zweite Methode ist für Kinder im Vorschul- und frühen Jugendalter konzi piert: der sog. Separation Anxiety Test (SAT) (vgl. SCHWARK et al. 2000, S.343 f.). Hier werden den Kindern Fotografien mit fiktiven Trennungssituationen vor gelegt sowie fiktive Kurzgeschichten vorgelesen und ihre Reaktionen darauf beo bachtet.
Bindungsrepräsentanzen und ihre Messung
Um festzustellen, inwieweit die Bindungsqualität, die Erwachsene in ihrer Kind heit aufwiesen, heute noch präsent is t, gibt es schließlich das Adult Attachment Interview (vgl. KÖHLER 1999, S.109 f., BRISCH 1999, S.50 ff.). Hier soll die Or ganisation der Erinnerungen auf der Ebene der Repräsentation aktiviert werden. Dabei werden dem Erwachsenen anhand eines Fragebogens Fragen zu Beziehun gen und Bindungserfahrungen in der Kindheit ge stellt und gefragt, welche Ein stellungen sie heute dazu haben. Das Interview wird auf Tonband aufgezeichnet und mit einem speziellen linguistischen Verfahren ausgewertet, denn „die Regeln, nach denen die Klassifizierung erfolgt, beruhen auf der Art des Diskurses mit dem Interviewer und nicht auf dem Inhalt.“ (KÖHLER 1999, S.110).
Entsprechend den früheren Bindungsqualitäten werden nun Bindungsreprä sentanzen herausgestellt: Typ A „unsicher- vermeidend organisierte innere Reprä sentation mit einer abwertenden Einstellung zur Bindung (`dismissing´)“, Typ B „sicher organisierte innere Repräsentation mit einer wertschätzenden Einstellung zur Bindung (`free autonomous´)“, Typ C „unsicher-ambivalent organisierte inne re Repräsentation mit einer verstrickten Einstellung zur Bindung (`enmeshed, pre- occupied´)“ und Typ D „unsicher organisierte innere Repräsentation der Bindung mit ungelöstem Trauma und/oder Verlust (`unresolved trauma of loss´)“ (alle in BRISCH 1999, S. 51 ff.)
Die Qualität ist also das Beobachtbare und Messbare, die Repräsentanz das Inne re, nur indirekt beobachtbare (s.a. Tabelle 1). Um den Methoden zur Klassifikati on von Bindungen den Anschein des Behavioristischen zu nehmen, weist DORNES (2000, S. 61 ff.) noch auf eine andere Methode für die Klassifikation der Bindung von 6-jährigen hin. Es findet eine Modifikation des SAT Anwendung:
„Das Neue bei diesen Untersuchungen ist, daß nicht nur das Verhalten der Kinder während der Wiedervereinigung (mit der Mutter, Anm. d. A.) untersucht wurde, sondern auch ihre Kommunikationsstile und Phantasien während der Trennung.“ (DORNES 2000, S. 62)
Bindungsstörung
Ausgehend von einem Konzept von GREENSPAN und LIEBERMANN (1995 a, b, zit. in BRISCH 1999, S.80), das die oben bezeichneten Bindungszustände als „Homö ostase“ beschreibt, die „durch eine ausgeglichene funktionierende Balance zwi schen Bindung und Exploration gekennzeichnet ist“ (BRISCH 1999, S.80), sind Abweichungen von diesem Zustand Störungen der Bindung. Es sind also Bin dungsverhalten, die sich nicht in die o.g. Muster der Bindungsqualitäten einord nen lassen, aber - in ihren verschiedenen Erscheinungsformen - an sie erinnern. Sie sind psychopathologisch. Für die Diagnose einer Bindungsstörung schlägt BRISCH (1999, S.83) einen Anamnesezeitraum über sechs Monate vor.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
- Arbeit zitieren
- Marc Leesch (Autor:in)Claudia Volkert (Autor:in), 2002, Die praktische Bedeutung der Resilienzforschung für den Umgang mit bindungsgestörten Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6596
Kostenlos Autor werden









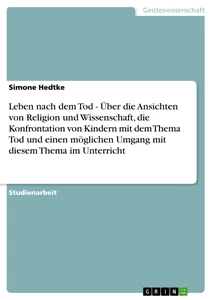

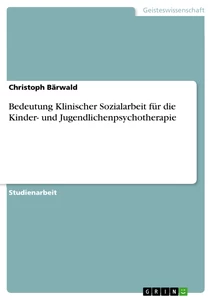


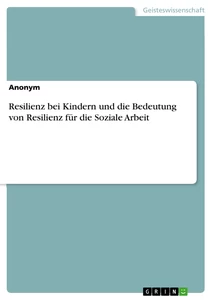

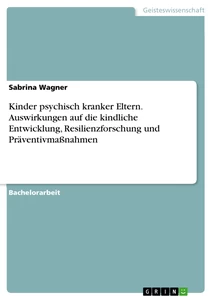





Kommentare
Antwort.
...nur durch Zufall bin ich mal wieder auf hausarbeiten.de gestoßen und dabei auf die Arbeit von meiner jetzigen Frau und mir. Schön, hier mal eine Reaktion zu lesen! Ich will versuchen, Dir zu antworten - die Arbeit ist schon sehr lange her...Im Mittelpunkt stand damals die Bindungstheorie - aber nicht allein. Wir wollten unbedingt auf die Resilienzforschung Bezug nehmen. Diese war damals unter diesem Begriff noch sehr neu. Es war - so weit ich mich erinnere - nicht mal eine (deutsche) Definition in Literatur und Internet zu finden. Zumindest in dieser Richtung waren Literaturbezüge also nicht in größerem Umfang zu erwarten (das Buch von Göppel mußten wir direkt vom Verlag bestellen - Internet und konventionelle Buchläden kannten den Autor nicht...). Die Darstellung der Bindungstheorie mußte also (laut Zielstellung) auch in dieser Richtung erfolgen. Sie konnte auf keinen Fall vollständig sein, sollte nur das Wesentliche zusammenfassen. Und so wurden auch nur die Grundannahmen der Bindungstheorie referiert - nicht ihr Bezug zu den 3 großen (und Krankenkassen-zugelassenen ;))psychologischen Theorien Psychoanalyse, Verhaltenstheorie und Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie - dies hätte eine eigene Diplomarbeit gefordert.
Dass man bei der Bewertung von Arbeiten Glück haben kann, steht außer Frage - das hängt ja durchaus von den Präferenzen der Prüfungskommission ab. Bei dieser Arbeit finde ich aber liegt unsere Leistung auch in der Verknüpfung von Bindungs- und Resilienzforschung - wie gesagt: das gab es im Sommer 2002 noch nicht auf dem Deutschen Buchmarkt. Dies erklärt auch, warum die Arbeit damals sehr oft heruntergeladen wurde (schade, dass es damals nicht so ein Forum bei hausarbeiten.de gab).
Nun sind seit Deinem Beitrag schon fast 2 Jahre vergangen... Ich hoffe, ich konnte dennoch einen Beitrag zur Erkenntnis leisten.
Herzliche Grüße
Marc Leesch
Sorry.
Hallo, ich beschäftige mich im Rahmen meiner Examensarbeit "Triangulierung als Entwicklungsnotwendigkeit. Neue Beiträge zum Entstehen von Verhaltensstörungen." unter anderem auch im Bereich der Bindungstheorien mit psychoanalytischen Theorien. In deiner Arbeit habe ich, außer den Verweis darauf, nichts Konkretes gefunden und war ehrlichn gesagt erstaunt, dass deine Bezüge zur Literatur so sehr knapp waren.Meine Frage nun. Bin ich zu pedantisch, oder hast du mit deiner Arbeit und deiner Note einfach Glück gehabt?
Grüße
Alexandra