Unternehmen befinden sich seit geraumer Zeit in einer Phase der ständigen äußeren und inneren Unsicherheit. Sie reagieren darauf mit Restrukturierungsmaßnahmen ihrer Organisation. Die alten, bürokratisch-tayloristischen Organisationsformen haben nun ausgedient und werden durch neue, flexiblere, produktivere und innovationsfähigere Organisationsformen ersetzt, um besser mit den neuen Rahmenbedingungen umgehen zu können. Die Lösungswege lauten Dezentralisierung, Enthierarchisierung und Gruppenarbeit. Diese neuen Strukturen führen jedoch auch zu neuen Problemen, deren Ursachen meist darin gesehen werden, dass es lediglich Einführungsprobleme seien, dass der neue Weg falsch und halbherzig begangen werde und dass die Beschäftigten aufgrund ihrer Sozialisation die nötigen Fähigkeiten für die neuen Strukturen (noch) nicht beherrschten. Daneben wird jedoch oft übersehen, dass die neuen Organisationsformen auch strukturelle Probleme und Widersprüche in sich tragen, die sich nicht etwa durch psychologische Trainings zur Steigerung der Teamfähigkeit beseitigen lassen. So müssen beispielsweise autonome Sub-Einheiten koordiniert werden, um die Ziele des Gesamtunternehmens nicht aus den Augen zu verlieren, was nur mit Widersprüchen vereinbar ist. Um diese der Struktur inhärenten Probleme geht es hier.
Zunächst geht der Artikel auf die traditionelle, tayloristische Organisationsform ein, anschließend wird der Wandel der Rahmenbedingungen untersucht, welcher zur Krise der alten und zum Erstarken der neuen Organisationsformen führte. Diese neuen Organisationsformen werden beschrieben und anschließend auf ihre Ambivalenzen hin untersucht, was die Kernfrage des Artikels darstellt. Zum Schluss wird auf mögliche Lösungen für zukünftige Organisationsformen eingegangen.
Gliederung
1. Einleitung
2. Das bürokratisch-tayloristische Unternehmen und seine Grenzen
3. Neue Rahmenbedingungen als Gründe für den Wandel der Organisationsform
3.1 Der gesellschaftliche Wertewandel
3.2 Die neue Technologie
3.3 Die veränderten Wettbewerbsbedingungen
3.4 Der Auslöser für den Wandel in den Organisationen
4. Neue Organisationsformen
4.1 Dezentralisierung und Netzwerke
4.2 Gruppenarbeit: Qualitätszirkel, Projektorganisation und teilautonome Gruppenarbeit
5. Strukturell bedingte Probleme der neuen Organisationsform
5.1 Stärkung der Zentrale durch Dezentralisierung
5.2 Machtverluste für die Mitarbeiter durch Gruppenarbeit
5.3 Zunehmende Machtkämpfe
5.4 Dezentralisierung versus Integration
5.5 Komplizierende Vereinfachungsstrategien
5.6 Nachteile der Gruppenarbeit
6. Mögliche Lösungen für die Zukunft
7. Schluss
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Unternehmen befinden sich seit geraumer Zeit in einer Phase der ständigen äußeren und inneren Unsicherheit. Sie reagieren darauf mit Restrukturierungsmaßnahmen ihrer Organisation. Die alten, bürokratisch-tayloristischen Organisationsformen haben nun ausgedient und werden durch neue, flexiblere, produktivere und innovationsfähigere Organisationsformen ersetzt, um besser mit den neuen Rahmenbedingungen umgehen zu können. Die Lösungswege lauten Dezentralisierung, Enthierarchisierung und Gruppenarbeit. Diese neuen Strukturen führen jedoch auch zu neuen Problemen, deren Ursachen meist darin gesehen werden, dass es lediglich Einführungsprobleme seien, dass der neue Weg falsch und halbherzig begangen werde und dass die Beschäftigten aufgrund ihrer Sozialisation die nötigen Fähigkeiten für die neuen Strukturen (noch) nicht beherrschten. Daneben wird jedoch oft übersehen, dass die neuen Organisationsformen auch strukturelle Probleme und Widersprüche in sich tragen, die sich nicht etwa durch psychologische Trainings zur Steigerung der Teamfähigkeit beseitigen lassen. So müssen beispielsweise autonome Sub-Einheiten koordiniert werden, um die Ziele des Gesamtunternehmens nicht aus den Augen zu verlieren, was nur mit Widersprüchen vereinbar ist. Um diese der Struktur inhärenten Probleme geht es hier. Die Anforderungen der neuen Organisationskonzepte an die Mitarbeiter werden hier nicht thematisiert, ebensowenig wie die Frage, wie stark und in welcher Form die neuen Organisationsformen tatsächlich verbreitet sind.
Zunächst geht der Text auf die traditionelle, tayloristische Organisationsform ein, anschließend wird der Wandel der Rahmenbedingungen untersucht, welcher zur Krise der alten und zum Erstarken der neuen Organisationsformen führte. Diese werden beschrieben und anschließend auf ihre Ambivalenz eingegangen, was den Kern des Textes darstellt. Zum Schluss wird auf mögliche Lösungen für die zukünftige Organisationsform eingegangen.
2. Das bürokratisch-tayloristische Unternehmen und seine Grenzen
Das tayloristisch-fordistische Unternehmen ist laut Kühl (1998, S.28) gekennzeichnet durch eine Trennung von planender und ausführender Tätigkeit, von Kopf- und Handarbeit. Die Arbeitsschritte seien bis ins kleinste zergliedert und detailliert vorgegeben, Mensch und Maschine wie im Uhrwerk miteinander verzahnt. Das System, nicht die Persönlichkeit stehe im Vordergrund. Bürokratie sei nach Weber durch fixierte, offizielle Regeln gekennzeichnet. Sie sei unpersönlich und berechenbar. Präzision, Stetigkeit, Disziplin, Straffheit und Verlässlichkeit zeichnete sie aus. Bürokratie ähnele tayloristischen Organisationen. Arbeit werde geteilt, die Hierarchie koordiniere und halte die einzelnen Elemente zusammen. Zerlegung, Standardisierung und Formalisierung von Abläufen bedeuteten Reduzierung von Unsicherheit. Formalisierung sei ein „Prozess, in dem ein Ablauf an Operationen künstlich fixiert, wiederholbar, berechenbar und für andere übernehmbar gemacht wird“ (Rammert nach Kühl 1998, S.30). Jedes relevante Ereignis löse festgelegte Reaktion aus, damit werde völlige Sicherheit gewährleistet. Rollen und Grenzen machten deutlich, wer wem unterstellt und wer wofür verantwortlich sei. Formalisierung bedeute klar fixierte Aufgabenverteilung, rigide Abteilungsgrenzen, genaue Arbeitsplatzbeschreibungen, starre Autoritätsgliederung und reglementierte Ablaufwege.
Unternehmen sind nach Springer nicht nur marktwirtschaftlich, sondern auch planwirtschaftlich und zentralistisch organisiert. Das traditionelle kapitalistische Großunternehmen sei – ähnlich der sozialistischen Planwirtschaft - durch Spezialisierung und Zentralisierung gekennzeichnet. Die dadurch geschaffenen Synergien brächten Einsparungen und damit Vorteile gegenüber Klein- und Mittelbetrieben, insbesondere bei Massenanfertigungen (Springer 1999, S.82).
Organisationen sind laut Kühl (1998, S.23) strukturiert und brauchen Mitgliedschaften. Mitgliedschaft bedeute, Mitgliedschaftsregeln zu akzeptieren (Verantwortlichkeiten, Kommunikationswege etc.). Organisationen existierten erst durch Entscheidungen. Bestimmte Normen und Identitäten dienten der Orientierung beim Entscheiden, so die Sicherung von Zahlungsfähigkeit und die Maximierung des Gewinnes bei Wirtschaftsorganisationen. Organisation seien einerseits Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten, böten aber andererseits Stabilität und Sicherheit. Ein zentrales Problem von Organisationen sei die Koordination kollektiven Handelns auf den Zweck der Organisation. Dafür gebe es zwei Handlungsmöglichkeiten: Wiederholung oder Neues schaffen, Redundanz oder Varianz, Stabilität oder Wandel und Flexibilität, Diktatur oder Anarchie. Die Aufgabe bestehe darin, einen vernünftigen Ausgleich dazwischen zu finden. Stabilität und Flexibilität würden zugleich benötigt. Hierarchie erzeuge Stabilität.
Organisationen tendierten dazu, Unsicherheit möglichst zu minimieren und Gewissheit zu schaffen. Demzufolge ließe sich in der idealen Organisation alles durchkalkulieren, standardisieren, bestimmen und kontrollieren. Organisationen seien strukturkonservierend und versuchten, die Zahl der möglichen Ergebnisse zu reduzieren.
Es gebe unterschiedliche Formalisierungsmedien, über welche in Organisationen Stabilität geschaffen werden könne: Regeln, Gesetze und Planungen (Zweckprogramme wie etwa Zielvereinbarungen oder Konditionalprogramme, die nach dem Wenn-dann-Schema funktionierten), festgelegte Kommunikationswege (z.B. Hierarchie) und Personen (Kenntnis und Berechenbarkeit der Person). In der „Stelle“ flößen diese drei Wege der Stabilisierung zusammen. Technisierung und Maschinisierung sei eine Methode, Unsicherheit zu verringern, da der Mensch ein Unsicherheitsfaktor sei.
Es bleibe jedoch immer eine Restunsicherheit vorhanden. Ein Minimum an Flexibilität müsse zugelassen werden. Die Abarbeitung von Unsicherheiten werde im zentralistisch-bürokratischen Unternehmen in managerielle Funktionsbereiche delegiert. Dieser Organisationstyp sei von einer relativ stabilen Umwelt abhängig und mit der Massenproduktion undifferenzierter Produkte verknüpft (Kühl 1998, S.21).
Ein Problem des bürokratischen Zentralismus ist Springer zufolge (1999, S.85), dass nicht nur strategische, sondern auch operative Entscheidungen von oben getroffen werden. Diejenigen, die die Produkte (also die Werte) erzeugten, hätten so gut wie nichts zu sagen. Die Angestelltentätigkeiten nähmen zu. Bürokratien unterlägen dem Gesetz des ständigen Wachstums. Rationalisiert werde nur im operativen Bereich. Dieser Vorgang setzte jedoch voraus, dass genügend Finanzmittel vorhanden seien. Die Nachteile des bürokratischen Zentralismus bzw. der etablierten Hierarchie- und Kontrollsysteme seien: langwierige Entscheidungsprozesse, Informationsverluste, ein unflexibler Apparat, aufwendige Kontrollverfahren, hohe Personalkosten durch den aufgeblähten Apparat und eine Statushierarchie, die zu Machtkämpfen führt (Braczyk/Schienstock nach Springer 1999, S.81). Viele Hierarchiestufen führten nicht nur zu einem komplizierteren Informationsfluss von oben nach unten (in Form von Anweisungen), auch der Informationsfluss von unten nach oben leide, da die höheren Instanzen nur selektiv und dosiert informiert würden. Durch diese Abschottung von Informationen wisse die Zentrale nicht, wo die Probleme lägen (Springer 1999, S.97).
Auch nach Deutschmann eignet sich der Taylorismus nur für den Bereich der Massenproduktion. Durch die organisatorische Standardisierung des Arbeitsprozesses und durch technische Mechanisierung solle eine maximale Kontrollierbarkeit der Arbeitsleistung gewährleistet werden. Neben Vorteilen wie niedrigen Löhnen, Qualifikations- und Anlernkosten, leichte Ersetzbarkeit der Arbeitskräfte und Transparenz der Leistungspolitik im operativen Bereich bringe dieses System jedoch auch Nachteile, so die geringe Motivation der Arbeitskräfte, die mangelnde Flexibilität des Arbeitseinsatzes und den aufwändigen bürokratischen Kontrollapparat. Daher werde die „direkte Kontrolle“ durch „verantwortliche Autonomie“ abgelöst, womit eine komplexere und sich wandelte Umwelt bzw. Marktlage besser bewältigt werden könne: „Je komplexer die geforderte Leistung, desto indirekter in aller Regel auch die gebotenen Machtmittel“ (Deutschmann 2002, S.118).
3. Neue Rahmenbedingungen als Gründe für den Wandel der Organisationsform
Da Organisationen strukturkonservierend und träge sind, stellt sich die Frage, wie es dazu kommt, dass sie ihre Strukturen nun ändern. Dafür sind Entwicklungen verantwortlich, die außerhalb der Unternehmen liegen.
3.1 Der gesellschaftliche Wertewandel
Seit den späten 60er Jahren hat nach Klages eine Verschiebung von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu Selbstentfaltungswerten stattgefunden. An Stelle von Disziplin, Gehorsam, Pflichterfüllung, Unterordnung, Fleiß, Fügsamkeit und Hinnahmebereitschaft seien Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung, Kreativität, Lebensqualität, Genuss, Abwechslung, Gleichheit (zwischen den Geschlechtern besonders), Partizipation, Autonomie und Umweltbewusstsein in den Vordergrund getreten (Klages nach Rosenstiel 1993). Disziplin werde jetzt weniger als Einfügungsdisziplin, denn als Selbstdisziplin aufgefasst (Klages nach Spieß 1996, S.106). Gründe für diesen Wertewandel seien das Aufwachsen im Wohlstand, welches durch die Befriedigung von Bedürfnissen materieller Art und Sicherheit zu neuen, ebengenannten Bedürfnissen führe und die Bildungsexpansion (längere Bildungsdauer und mehr Bildungsinhalte verstärkten die vorberufliche Sozialisationswirkung). Leistung habe als Wert nicht an Bedeutung verloren, sie werde nun jedoch mit Genuss verknüpft: „Selbstverwirklichung oder Selbstentfaltung ist nicht mit Genusssucht und Faulheit im Sinne von blankem Hedonismus gleichzusetzen, sie kann auch in der Arbeit Erfüllung finden. Daraus folgt: ‚Wenn die Arbeitsinhalte etwas für die individuelle Selbstverwirklichung hergeben, dann schmälert Wertewandel keineswegs die berufliche Leistungsbereitschaft‘ (Brock 1992, S.358). Leistung erfolgt nicht mehr so sehr aus Tradition oder um einer Norm gerecht zu werden, sondern eher um Bedürfnisse zu befriedigen“ (Marg 2004, S.8). Überspitzt gesagt wird Leistung genossen. Dies führt zu höheren Ansprüchen an die Arbeit. Die Ansprüche, so Baethge, seien gestiegen, die ganze Person solle in die Arbeit eingebracht werden können, nicht nur die berufliche Rolle: „Man will innerlich an der Arbeit beteiligt sein, sich als Person in sie einbringen können und über sie eine Bestätigung eigener Kompetenzen erfahren“ (Baethge 1991, S.7).
Diese neuen Wertorientierungen begünstigen die neuen Organisationsformen. Selbstverwirklichung, Partizipation und Kreativität als „neue Werte“ passen zu den Anforderungen des dezentralisierten und enthierarchisierten Unternehmens. Der gesellschaftliche Wertewandel machte sich zunächst als vergrößerte Kluft zwischen Individuum und Organisation bemerkbar, denn Organisationen verkörpern die traditionellen Pflicht- und Akzeptanzwerte wie Disziplin, Unterordnung, Pünktlichkeit und Fügsamkeit und wandeln sich aufgrund der Trägheit ihrer Strukturen nur langsam. Eben diese Kluft ist für Unternehmen ein Problem, da sich ein Mitarbeiter mit den neuen Wertorientierungen weniger leicht mit der Organisation und ihren Zielen identifizieren kann. Nach Rosenstiel reicht es für das Unternehmen nicht mehr, das Personal auszuselektieren oder den eigenen Vorstellungen gemäß zu sozialisieren, sondern es muss auch das eigene Wertsystem an den kritischen und kreativen Mitarbeiter anpassen (Rosenstiel nach Marg 2004, S.9)[1].
Deutschmann beschreibt diese Kluft zwischen Individuum und Organisation als Legitimitätskrise der betrieblichen Herrschaft. Demnach haben die deutschen Nachkriegsunternehmen bei ihrer betriebsinternen Sozialstruktur auf eine ständische Gesellschaftsstruktur zurückgreifen können. Die Autorität, welche letztlich Anerkennung bedeute, basierte demnach auf „letzten Werten“, auf Privateigentum, Berufung und Elite. Deutschmann nennt dieses System Industriefeudalismus und charismatisches industrielles Führertum. Der Arbeiter war demnach moralisch verpflichtet, eine Leistung zu erbringen, die über den Arbeitsvertrag hinausging, die Gesellschaftsstruktur und die damalige vorberufliche Sozialisation sicherten dieses System. Mit der Demokratisierung und Modernisierung der Gesellschaft funktioniere dieser Paternalismus nicht mehr: „Es kann nicht damit gerechnet werden, dass der Betrieb sich inmitten einer differenzierten, auf Individualismus und Demokratie hin orientierten Gesellschaft als Insel des Paternalismus erhalten lässt“ (Deutschmann 2002, S.131). Mit dem Aufkommen der neuen Organisationsformen werde auch versucht, „die durch die Modernisierung der Gesellschaft verursachte Legitimationslücke betrieblicher Herrschaft zu füllen“ (ebd., S.132).
3.2 Die neue Technologie
Die Hoffnung der 80er Jahre ging noch dahin, mittels neuer Technik eine menschenleere, zentral gesteuerte Fabrik zu schaffen und so mitsamt dem Personal alle Unsicherheit zu verbannen (Antoni 2000, S.15). Diese Hoffnung wurde jedoch bald enttäuscht. Vielmehr führte der Automatisierungsschub dazu, dass die Arbeit komplexer wurde. Die immer komplexeren und damit auch störanfälligen Maschinen benötigten Experten, die sich in Teams um sie kümmerten, der sogenannten „Systemregulierer“ (nach Schumann) war gefragt. Eine Reprofessionalisierung der Arbeit war notwendig. Damit wurde Arbeit interessanter und besser bezahlt. Der Taylorismus wurde durch diese Entwicklung in Frage gestellt (Springer 1999, S.135). Das zunehmend gefragte Spezialistenwissen führt auch dazu, „dass die Aufgabe der Führung weniger in Anweisung und Kontrolle besteht, sondern in der Koordination der Spezialisten. Anders ausgedrückt: ‚Der Punkt ist erreicht, wo die auf Arbeitsteilung und bürokratischer Organisation beruhende Rationalität der Moderne ins Kontraproduktive umschlägt‘ (Vester 1993, S.112)“ (Marg 2004, S.19). Zugleich bieten die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) auch Potentiale für neue Organisationsformen wie virtuelle Unternehmen, Telearbeit, mobile Büros und dezentrale Arbeitsstätten. Unternehmensübergreifende Kooperation ist nun unabhängig vom Standort möglich (Hesch 1997, S.113). Kühl zufolge wirken IuK im Gegensatz zu Maschinensystemen nicht stabilisierend auf Organisationen, sondern bringen eine inhärente Komplexität mit sich, welche zu einem zunehmenden Kommunikationsbedarf führe. IuK erleichterten die Koordination zwischen bisher getrennt operierenden Abteilungen, die Produktion könne intensiver und anpassungsfähiger werden und Schwankungen der Nachfrage kämen nun direkt und unvermeintlich als Unsicherheiten in den Produktionsprozess. Entscheidungen seien nun ohne zeitlichen Verzug möglich und erforderlich (Kühl 1998, S.37).
3.3 Die veränderten Wettbewerbsbedingungen
Nach Hesch sind die Märkte sind globaler geworden, haben neue Wettbewerber (etwa aus Ostasien und Osteuropa) mit geringeren Produktionskosten bei gleicher Qualität den Markt betreten, ist die Lebensdauer von Technik und Produkten immer weiter gesunken und haben die Märkte sich von Verkäufer- zu Käufermärkten gewandelt, wodurch der Wettbewerb sich verschärft hat (Hesch 1997, S.111). Käufermärkte sind nach Antoni durch einen starken Angebotsüberhang gekennzeichnet, wodurch sich ein schärferer Wettbewerb ergebe. Die Automobilindustrie beispielsweise hole weltweit Angebote für Zulieferteile ein, wodurch sich für die Zulieferfirmen der Konkurrenzkampf verstärke. Der Kunde fordere mehr Flexibilität hinsichtlich Produktvarianten und Lieferzeit, der Kostendruck steige bei wachsenden Qualitätsansprüchen. Auf all diese Entwicklungen sei das tayloristische Unternehmen nicht ausgerichtet: „Die Kostenvorteile der standardisierten Massenfertigung nehmen jedoch mit sinkenden Losgrößen, steigenden Variantenzahlen und kürzeren Produktlebenszyklen ab. Gleichzeitig steigen jedoch die Anpassungs- bzw. Transferkosten an die sich immer schneller wandelnden Marktanforderungen. (...) Auf Grund der extremen Funktions- und Arbeitsteilung und den damit verbundenen langen Informationsflüssen und Entscheidungswegen steigen die Transferkosten mit zunehmender Umweltdynamik überproportional an“ (Antoni 2000, S.14). Laut Vester müssten Funktionen und Verantwortlichkeiten dezentralisiert werden, um auf individuelle Wünsche rasch und flexibel reagieren zu können (Vester 1993, S.117). Nach Kühl verlagert sich die Nachfrage zu hochdifferenzierten, individuelleren Produkten und das Verhältnis von Quantität und Qualität kehre sich um. Kühl verknüpft die steigende Nachfrage nach Verschiedenheit mit der IuK: beide führten zu steigender externer Unsicherheit und Komplexität, auf welche Organisationen mit Erhöhung ihrer Flexibilität reagierten. Die Organisation müsse nun so gestaltet werden, dass ständiger Wandel möglich sei (Kühl 1998, S.43).
Die neuen Wettbewerbsbedingungen wirken jedoch widersprüchlich auf die Unternehmen. So werden durch die Deregulierung der Geldmärkte nach Hoffmann (1999, S.6) zunehmend Finanzinvestitionen anstatt produktiver Investitionen getätigt, was zu einem Wandel der Unternehmenskultur führe. Dadurch, dass die Unternehmen ihr Kapital zunehmend an der Börse beschafften, dominiere – ausgerichtet an den kurzfristigen Interessen der Aktionäre - betriebspolitisch die kurze Frist und die variablen Kosten. Die variabelsten Kosten seien die Personalkosten. „Dies hat“, so Hoffmann, “in den Ländern des eher mittelfristig und kooperativ orientierten Typus des ‚rheinischen Kapitalismus‘ eine z.T. dramatische Veränderung der Unternehmenskulturen zur Folge, die sich immer mehr an den kurzfristigen Dividenen-Interessen der Anteilseigner orientieren – ‚shareholder-value capitalism‘ – und die deshalb heute den Arbeiter (...) am liebsten wieder auf ‚Produktionsfaktorkosten‘ reduzieren und diese Kosten damit soweit wie möglich reduzieren möchten“ (ebd. 1999, S.7). Dörre beschreibt die Auswirkung der Orientierung der Unternehmen am Aktienmarkt als Pendelschlag. In der ersten Hälfte der 90er Jahre habe diese „unternehmenswertbasierte Steuerung“ zu einer Zunahme der Partizipation geführt, danach führte das kurzfristige und kostenorientierte Denken zu einer Zurücknahme von Partizipation und Autonomie der Mitarbeiter. Wichtig sei den Unternehmen nun eine Kontrolle der Kosten durch Transparenz (Dörre 2001).
3.4 Der Auslöser für den Wandel in den Organisationen
Auslöser für die Restrukturierungsmaßnahmen der Unternehmen war die MIT-Studie von Womack, Jones und Roos von 1991, welche das japanische Modell der Lean Production (schlanke Fertigung) mit der Massenfertigung verglich und deutliche Produktivitätsvorteile für die japanische Variante aufzeigte. In der schlanken Fertigung wird Verantwortlichkeit an die wertschöpfenden Mitarbeiter übertragen und ein spezielles System der Fehlerentdeckung angewandt. Lean Managment bedeutet flachere Hierarchien, ganzheitlichere Aufgabeninhalte und eine drastische Entbürokratisierung (Spieß 1996, S.114). Antoni zufolge wirkte die MIT-Studie „vermutlich nur als Katalysator, da sie Schwächen zum richtigen Zeitpunkt sehr eingängig und nachdrücklich ansprach, auf die man durch den Druck des Marktes bereits aufmerksam gemacht worden war, die man aber noch nicht so recht wahrhaben wollte“ (Antoni 2000, S.12).
4. Neue Organisationsformen
Nach Springer soll der bürokratische Zentralismus nicht abgeschafft, sondern reformiert werden. Die Ziele in diesem Zusammenhang lauten ihm zufolge (Springer 1999, S.91):
- Konzentration auf die eigentlichen Kerngeschäfte
- Vereinfachung und Beschleunigung der Abläufe und Entscheidungsprozesse innerhalb dieser Kerngeschäfte
- Flexiblere Reaktionsmöglichkeiten auf wechselnde Umfeld- bzw. Marktanforderungen
- Bessere Nutzung vorhandener Innovationspotentiale und Beschleunigung der Innovationszyklen
- Reduzierung von Gemeinkosten (Umlagen)
Die Methoden, um diese Ziele zu erreichen, seien produkt- bzw. geschäftsprozessbezogene Verantwortlichkeiten, mehr Entscheidungsbefugnisse für den operativen Bereich, Zielvereinbarungen, interne Kunden/Lieferanten-Beziehungen, starke Kostenverantwortung vor Ort, Reduzierung der Hierarchiestufen und Projektmanagement statt Linienorganisation. Kühl zufolge geht es bei den neuen Organisationsformen hauptsächlich um die Auflösung horizontaler bzw. funktionaler Differenzierung, um den Abbau von vertikaler Differenzierung (weniger Hierarchiestufen) und um die Stärkung von Autonomie und Selbstverantwortung der Mitarbeiter und Einheiten (Dezentralisierung) (Kühl 1998, S.57).
4.1 Dezentralisierung und Netzwerke
Faust unterscheidet zwischen paralleler und echter Dezentralisierung. Bei der parallelen oder auch strukturbegleitenden Dezentralisierung bleibe die ursprüngliche Organisationsstruktur bestehen. Ergänzt werde diese Struktur jedoch von Qualitätszirkeln und Projektorganisation, welche begrenzt seien hinsichtlich Zweck und Zeit. Die echte oder auch strukturverändernde Dezentralisierung stelle dagegen einen generellen und zeitlich unbegrenzten Eingriff in die Arbeitsorganisation dar. Die vertikale Arbeitsteilung werde reduziert, Kompetenzen würden von oben nach unten verlagert. Es werde in teilautonomen Gruppen zusammengearbeitet. Der Dezentralisierungsgrad variiere danach, welche Funktionen und Verantwortlichkeiten in welchem Umfang verlagert werden. Die echte Dezentralisierung unterscheidet Faust weiter in das Selbstorganisationsmodell und das Intrapreneurmodell. Bei Ersterem werde der Gruppe Kompetenzen und Verantwortung zugewiesen, sie erledige ihre Aufgaben in Selbstorganisation. Die Fertigung erfolge jetzt objekt- bzw. kundenorientiert (beispielsweise in Fertigungsinseln) und nicht mehr verrichtungsorientiert. Es würden auch indirekte Aufgaben übernommen, wie Wartung der Betriebsmittel, Qualitätskontrolle, Terminüberwachung, Orientierung an ökonomischen Zielen und Verwaltungstätigkeiten. Beim anderen Fall, auch „neue Meisterwirtschaft“ genannt, würden Kompetenzen und Verantwortung auf den unteren Vorgesetzten verlagert, der jetzt der „Unternehmer im Unternehmen“ sei und die Verantwortung für Kosten, Termine, Qualität und Bestände trage. Dabei könne er die Verantwortung für ein Produktspektrum, wie beispielsweise Mehrleiterplatten, oder für einen Prozessabschnitt, wie beispielsweise Bohren, tragen. Unter dem Intrapreneur würden Teams gebildet. Die Abteilungen würden nach der Produktverantwortung gebildet, dabei könnten bestimmte, kapitalintensive Prozesse und Maschinen weiterhin zentral organisiert sein, wenn es zu teuer sei, wenn jede Einheiten über sie verfüge (Faust 1995). In der modularen Organisation nach Hesch (1997, S.119) bearbeiten kleine, dezentrale Einheiten ganzheitlich, kundenorientiert und am Markt ausgerichtet Arbeitsprozesse. Die organisatorischen Schnittstellen der funktionalen Arbeitsteilung sollen beseitigt werden. Planung und Ausführung würden reintegriert, Hierarchien abgeschafft, die Aufgabenfelder erweitert und die Kommunikationsstrukturen geöffnet, damit der Zugang zu Informationen erleichtert werde. Reaktionsgeschwindigkeit und Flexibilität sollen gesteigert und die Kundennähe erhöht werden. Bei der vernetzten Organisation könne das Unternehmen sich (insbesondere bei komplexen Aufgaben) auf die eigenen Kernkompetenzen konzentrieren und Kosten und Risiken in strategischen Allianzen teilen. Virtuelle Organisationen kooperierten bei hoher Marktunsicherheit und Produktkomplexität über einen begrenzten Zeitraum mittels gemeinsamer Informations- und Kommunikationsstruktur.
Kühl zufolge sind Unternehmen Mischformen zwischen den Kooperationsformen Markt und Hierarchie. Bei einer instabilen Umwelt tendierten Unternehmen zu einer besonders starken Vermischung beider Formen: Die Marktbeziehungen würden stärker durch organisationsspezifische Koordinationsmechanismen strukturiert und die Organisationsstruktur würde mit Marktmechanismen durchzogen. Die Rede ist von Netzwerken. Interorganisationelle Beziehungen würden zu einem der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Marktnetzwerke und Profitcenter stünden für diese neuartigen Beziehungsmuster. Profitcenter seien relativ autonome und selbstverantwortliche Abteilungen eines Unternehmens. Wichtig sei, dass ihr Leistungsangebot klar ist. Zentral werde lediglich grob ein Produktspektrum definiert. Die Profitcenter fingen das Risiko beim Versagen ab (etwa indem sie abgestoßen würden) und könnten zugleich flexibel und dezentral auf Marktveränderungen reagieren. Um die Flexibilität unternehmensintern zu steigern, ersetzte Kontextsteuerung der autonomen Einheiten die Hierarchie, lösten organisationsinterne Märkte komplexe Hierarchieketten ab und erfolge die Differenzierung segmentär und an Produkten orientiert anstatt funktional in Abteilungen. Eine gemeinsame Konzernpolitik halte weitestgehend autonome Einheiten zusammen. Profitcenter dienten der besseren Anpassung an Produktmärkte, aber auch größerer Übersichtlichkeit und Verantwortlichkeit sowie der organisationsinternen Koordination über Marktmechanismen. Langfristig gesehen könnten sich Unternehmen in ein Netzwerk von vielen unabhängigen Auftragnehmern und freien Unternehmern verwandeln. Profitcenter dienten der Flexibilität, Netzwerke dienten der Stabilisierung und Strukturierung einer unsicheren Umwelt. „Netzwerke sind unter instabilen Umweltbedingungen sowohl marktmäßig organisierten zwischenunternehmerischen Beziehungen überlegen als auch rein hierarchischen Formen der Koordination“ (Kühl 1998, S.55). Rationalisierungsbemühungen zielten zunehmend auf die zwischenbetriebliche Ebene.
Auch Deutschmann beschreibt Netzwerke als zwischen Markt und Hierarchie angesiedelt. Sie entstünden aus der Verflüssigung von Organisationsgrenzen, dem Abbau von Hierarchie und Bürokratie und aus Outsourcing. Netzwerke seien langfristiger, verbindlicher und stärker auf Vertrauen basierend als reine Marktbeziehungen, zugleich jedoch flexibler als Hierarchien. Mintzberg (nach Deutschmann 2002, S.123) zufolge führt zunehmende Umweltkomplexität und -dynamik zu abnehmender Strukturierung und zunehmender Politisierung von Organisationen. Bei größter Umweltkomplexität entstünde der Organisationstypus der „Adhocracy“, „der auf das scheinbar einfachste Steuerungsmedium, die gegenseitige Abstimmung mittels persönlicher Kommunikation, zurückgreift“ (ebd., S.124). Politisierung, d.h. ständige Machtkämpfe und Diskussionen seien der Preis, der für größere Innovationskraft zu zahlen sei. Kühl zufolge ist Kommunikation die Grundlage jedes kollektiven Handelns, in postbürokratischen Organisationen sei sie jedoch immer weniger formalisiert, weshalb mehr Zeit auf sie verwendet werden müsse; Kommunikation über kollektives Handeln und ständige Neustrukturierung würden nun mehr und mehr zur Hauptaufgabe der Mitarbeiter (Kühl 1998, S.62).
Zusammenfassend lässt sich mit den Worten Deutschmanns schließen: „Dort, wo die Marktnachfrage sich rasch verändert, wo komplexe und innovative Produkte und Dienstleistungen gefragt sind, versagt das bürokratische Organisationsmodell. Hier erweisen sich netzwerkförmige, dezentralisierte und wenig formalisierte Strukturen als überlegen“ (Deutschmann 2002, S.113).
4.2 Gruppenarbeit: Qualitätszirkel, Projektorganisation und teilautonome Gruppenarbeit
Ein zentraler Bestandteil neuer Organisationsformen ist Gruppenarbeit. Typisierungen von verschiedenen Formen von Gruppenarbeit gibt es in vielen Variationen, auf die hier nicht in aller Vollständigkeit eingegangen werden kann. Im Zusammenhang dieser Arbeit soll hier nur auf die wichtigsten Unterscheidungen eingegangen werden. Dazu zählt die Trennung (wie bereits bei Faust gesehen) zwischen Qualitätszirkeln und Projektgruppen als nicht in die Arbeitsorganisation integrierte, temporäre Gruppen auf der einen Seite und teilautonomen Arbeitsgruppen als in die Arbeitsintegration integrierte und dauerhafte Gruppen auf der anderen Seite (Antoni 2000, S.24). Kühl (1998, S.64) definiert diese drei Typen wie folgt:
- Qualitätszirkel bestehen aus sechs bis zehn Mitarbeitern, die sich regelmäßig und freiwillig treffen, um arbeitsbezogene Probleme zu besprechen. Qualität soll in Eigenverantwortung produziert werden, anstatt dass sie von außen bzw. oben kontrolliert wird. Zirkel laufen parallel zur eigentlichen Organisation. Sie haben keine formelle Entscheidungsgewalt. Sie haben lediglich eine ergänzende Funktion, indem sie Nachbesserungen in Detail vornehmen sollen. Sie laufen als „partizipativer Taylorismus“.
- Teilautonome Arbeitsgruppen (oder Fertigungsgruppen) besitzen ein hohes Maß an Autonomie und Kontrolle über ihr unmittelbares Verhalten und übernehmen auch Aufgaben, für die vorher das Management zuständig gewesen ist. Die Eigenverantwortlichkeit ist hoch. Durch Teamarbeit sollen Flexibilität und Qualität gesteigert werden. Ein permanenter Problemlösungsprozess (Kaizen / Total Quality Management) soll Nacharbeit überflüssig machen. Teamführer steuern die Arbeit in der Gruppe und vertreten sie nach außen.
- Projektgruppen oder Ad-hoc-Gruppen sind zeitlich begrenzt und an eine spezielle Aufgabe gebunden. Je weiter die Arbeit vom Produktionsprozess entfernt ist (z.B. Beratungsprojekt), desto eher werden Projektgruppen an Stelle von teilautonomen Fertigungsgruppen eingesetzt.
Nach Hesch besitzen Teams eine höhere Flexibilität und ein gesteigertes Problemlösungspotential. Es zähle nun Kooperation statt Individualismus, Generalismus statt Spezialisierung und einen Konsens herbeizuführen anstatt das Team zu führen. Selbststeuernde Teams seien effektiver hinsichtlich Produktivität, Qualität und Zeit als Manager, die vorgaben machen. Die wachsende Aufgabenkomplexität sei nicht mehr von Einzelpersonen zu lösen und das kreative Potential der Mitarbeiter könne besser von der Organisation genutzt werden. Ferner werde die Leistungsbereitschaft und die Motivation der Mitarbeiter gefördert. Als Merkmale des (idealen) Teams zählt Hesch folgende Faktoren auf: die optimale Gruppengröße liege zwischen fünf und zwölf Personen; durch unterschiedliche Qualifikationen der Teammitglieder ergänzten sie sich; eine gemeinsame Aufgabe und Leistungsziele bestimmten den Charakter der Teamarbeit; jeder trage Verantwortung für jeden und für das Team; ein Zusammengehörigkeitsgefühl sei wichtig für den Teamgeist (Hesch 1997, S.123).
5. Strukturell bedingte Probleme der neuen Organisationsform
Die neuen Organisationsformen bringen (intendierte und nichtintendierte) Nebenfolgen mit sich. Diese drehen sich vor allem um Fragen der Zentralisierung und der Macht, der zunehmenden Machtkämpfe, der Integration von autonomen Einheiten und um Probleme der Gruppenarbeit.
5.1 Stärkung der Zentrale durch Dezentralisierung
Nach Springer bedeutet Dezentralisierung keine Alternative zur Zentralisierung, sondern eine Modernisierung der Zentralisierung (Springer 1999, S.93). Die wirtschaftlichen Ziele der Unternehmensleitung sollten durch Zielvereinbarungen überall wirksam werden. Über finanzielle Controllingsysteme würde Transparenz geschaffen und die Zentrale gestärkt, denn die wirtschaftlichen Leistungen aller Subeinheiten lägen nun offen und würden streng kontrolliert. Während im tayloristischen Betrieb die Leitung durch die konzentrierten Entscheidungsbefugnisse für alles verantwortlich gewesen sei, die operativen Einheiten der Kontrolle entglitten seien, Misserfolge in beiderseitigem Interesse kaschiert worden seien und Quersubventionierungen stattgefunden hätten, hätte die Leitung nun die Kontrolle über die operativen Subeinheiten zurückgewonnen. Die Abschaffung oder Umgehung von Hierarchiestufen führe durch den direkteren Kontakt der Führung zu den operativen Einheiten ebenso zu einer verbesserten Kontrolle über selbige. Der eigentliche Zweck der neuen Organisationsformen sei nicht die Stärkung des internen Unternehmertums, sondern Kosten zu sparen, Abläufe zu beschleunigen und die operativen Einheiten besser unter die zentrale Kontrolle zu bringen (ebd., S.99). Auch Kühl beschreibt die Gleichzeitigkeit von Zentralisierungs- und Dezentralisierungsstrategien und zählt die einzelnen Argumentationsstränge der Dezentralisierungsliteratur auf. Selbstkoordination in dezentralen Einheiten werde nach Kieser durch Fremdorganisation erst ermöglicht. Dezentralisierung stärke Rainnie und der Kontrolltheorie zufolge nicht kleine autonome Einheiten, sondern ein global tätiges Management, die Konzernzentralen würden dank EDV-basierten und an Zielvorgaben orientierten Kontrollmechanismen mächtiger und müssten nur noch Ergebnisse, nicht mehr Personen und Prozesse kontrollieren, was mit Springers Aussagen übereinstimmt. Zudem könne die Zentrale die dezentralen Einheiten machttheoretisch gesehen gegeneinander ausspielen. Eine Dezentralisierung einer Organisation beispielsweise in Profit-Center könne laut Mintzberg und der Steuerungstheorie dazu führen, dass die einzelnen Einheiten in sich stärker zentralisiert seien. Wichtiger als Zentralisierung oder Dezentralisierung sei für Organisationen Baecker und der Kybernetik zufolge, beide Organisationsformen gezielt zu kombinieren und die jeweiligen Vorteile zu nutzen. Der tendenziellen Desintegration durch Dezentralisierung müsse nach Wilke, Stacey und der Managementliteratur auf höherer Ebene durch Reintegration begegnet werden, was zu rigideren Regeln und stärkerer Unternehmenskultur führe. Zentralisierung und Dezentralisierung würden verknüpft. Mit zunehmender Dezentralisierung werde die Gesamtintegration allerdings schwieriger.
Dörre zufolge, wie bereits weiter oben kurz angesprochen, führte die zunehmende Shareholder-value-Orientierung der Unternehmen in der ersten Hälfte der 90er Jahre zu einer vermehrten Anwendung von partizipativen Managementprinzipien, in der zweiten Hälfte dagegen führte eben diese Profitsteuerung zu einer Zurücknahme selbiger Versuche. Dörre erklärt dies damit, dass die Internationalisierung zu einer verstärkten Ausrichtung an den Aktionärsinteressen führe. Die Anteilseigner seien an der Transparenz der wirtschaftlichen Leistung interessiert, wobei kurzfristiges Gewinndenken dominiere. Priorität hätten kurzfristig wirksame Kostensenkungen und Rationalisierungserfolge, was zu einem niederen Weg der industriellen Restrukturierung führe. Neu sei nun das straffe betriebswirtschaftliche Controlling mit Hilfe von EDV-gesteuerten Kontrollsystemen, mit welchen Budgets und Leistungsdaten einsehbar seien (vgl. Springer und Kühl oben). Herrschaft würde durch diese Kostenfixierung anonymisiert. Im „marktzentrierten Kontrollmodus“ seien Rendite, Kapital und Kreditfähigkeit entscheidend. Die Mitarbeiter könnten sich aktiv an der Rationalisierung beteiligen, nicht jedoch mitbestimmen. Kritisch aus Sicht des Unternehmens merkt Dörre hierzu an, dass der Aktienkurs nicht die Realaktivitäten widerspiegele und etwa Innovationen kaum qualitativ bewerten könne. Die Verzerrungen des Marktes würden nun bis in die Organisationseinheiten hineinwirken. Die Belegschaft sei dabei das Flexibilitätspotential und werde durch Rekommodifizierung ihrer Arbeitskraft bedroht. Es gebe Zonen der kontrollierten Autonomie, welche jedoch rigide ökonomisiert seien, wobei das Marktrisiko als Triebkraft einer aktiven Rationalisierungsbeteiligung diene und die Diffusität des Marktes als Machtressource für abstrakte Zwänge diene (Dörre 2001). Hier wird die Anwendung von Gruppenarbeit, Partizipation und Dezentralisierung in ihrer „Reinform“ als in der Realität sehr eingeschränkt gesehen.
Kühl (2001a) beschreibt den Effekt der Zentralisierung speziell auf den Fall bezogen, wenn es zwei Ebenen von Gruppen gibt: operative Gruppen und Führungsteams darüber. Gruppenarbeit sei insbesondere unter hohem Zeitdruck und in Konfliktsituationen problematisch (siehe 5.6). Daher würden die Führungsgruppen in solchen Situationen von der Leitung übersprungen, um Zeit zu sparen. Die nun abgeschafften Meister in ihrer an Einzelpersonen geknüpften hierarchischen Position hätten zuvor nicht nur eine „Lehm –und Lähmschicht“ dargestellt, sondern auch eine entlastende Funktion, indem sie Informationen von oben nach unten und umgekehrt nach ihrer Relevanz gefiltert und weitergegeben hätten. Die Stärke von Hierarchien sei ihre Funktion als Entscheider von Konflikten, diese würden vom Vorgesetzten entschieden. Sie legitimiere sich aus sich selbst heraus, nicht durch Fachkenntnisse, Umweltkontakte oder Rückfragen, wie es bei der Konsensfindung in Gruppen der Fall sei. Führungsgruppen tendierten dazu, im Konfliktfall, insbesondere bei Themen wie Entlassung, Lohnkürzungen oder Arbeitszeitverlängerung, die Entscheidung nach oben weiterzureichen: „Die Konflikte kann man nur beim Chef lösen“ (Mitglied einer Führungsgruppe nach Kühl 2001a, S.486). Zwei hintereinander geschaltete Teamebenen könnten demnach in Konfliktsituationen und unter hohem Zeitdruck dazu führen, dass Entscheidungen bis ganz in die Führungsspitze weitergereicht würden. Dadurch würden Entscheidungen noch zentralistischer gefällt als in der klassischen Meisterstruktur. Diese Zentralisierung von Entscheidungen könnte nach Friedberg und Ortmann als funktionale Regelverletzung betrachtet werden (welche zur Erhaltung der Regeln beitrage, indem ihre Missachtung sie nicht automatisch delegitimiere), solange sie nicht zum Normalfall geworden sei und dann immer mehr Entscheidungen vom Werkleiter getroffen würden.
Punktuell werde hierarchische Steuerung durch Koordination per diskursiver Abstimmung ersetzt, die Gesamtsteuerung des Unternehmens bleibe jedoch hierarchisch organisiert. Die stärkere konsensuale und diskursive Abstimmung innerhalb der Einheiten bedeute nicht zwangsweise einen Bedeutungsverlust von Hierarchie; sie werde vielmehr so umgebaut, dass sie den Einsatz von Gruppen- und Teamstrukturen definiere, begrenze und befriste. Eine Mischung aus Ebenen mit Gruppenorganisation und mit Ein-Personen-Führung könne die jeweiligen ungewollten Nebenfolgen der Organisationsformen einschränken (Kühl 2001a, S.492). Nach Springer wird das diskursive Element nun funktional, umgekehrt käme die neue Organisation „auch nicht völlig ohne dirigistisch-bürokratische Elemente aus, die vor allem immer dann reaktiviert werden, wenn die ‚diskursive Koordinierung‘ nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt“ (Springer 1999, S.101). Der „dirigistisch-bürokratische Zentralismus“ wird in seinen Worten durch einen „diskursiv-repräsentativen Zentralismus“ ersetzt, unter welchem Kommunikations- und Abstimmungsprozeduren herausragende Bedeutung zukäme (ebd., S.105). Deutschmann merkt kritisch an, dass Netzwerke oft verkappte Hierarchien seien (etwa in den Zuliefernetzwerken der Automobilindustrie) und stellt die Frage, ob sie die Vereinbarkeit des Unvereinbaren vorgaukeln und Lohnabhängigkeit lediglich verschleierten: „Nur dort, wo Netzwerke auf dem Austausch komplexer, gegenseitig kaum substituierbarer Dienstleistungen beruhen, dürften sie dem (...) Idealtypus einer relativ egalitären Machtverteilung tatsächlich nahe kommen“ (Deutschmann 2002, S.125).
5.2 Machtverluste für die Mitarbeiter durch Gruppenarbeit
Aus der Perspektive des einzelnen Mitarbeiters bedeuten die stärkere Betonung der Partizipation nicht gleich mehr Macht. Kühl (2001b) stellt die Frage, warum sich Mitarbeiter nicht dagegen wehrten, wenn Gruppenarbeit zurückgefahren wurde, obwohl durch sie der Gruppenarbeitsliteratur zufolge die Arbeitszufriedenheit erhöhen, eine humanere Arbeit schaffen und den Einfluss der Mitarbeiter erhöhen sollte. Er begründet dies auf der Ebene von Macht und Einfluss. Demnach habe sich der reale Einfluss der Mitarbeiter durch Gruppenarbeit nicht erhöht. Zwar hätten sie nun mehr Handlungsspielräume, aber weniger Verhandlungsmacht. Dies liege daran, dass das tayloristische Unternehmen auf Abweichungen von ihren starren Regeln angewiesen sei, da Regeln und Strukturen nicht an alle Alltagsprobleme angepasst werden könnten. Es gebe funktionale Abweichungen, die im Interesse der Organisation lägen, jedoch nicht über formale Sanktionsmöglichkeiten eingeklagt werden könnten. Aus dieser Diskrepanz zwischen offizieller Handlungsverpflichtung und real erwarteten Arbeitsanforderungen ergebe sich Macht für die Mitarbeiter, sie könnten ihre informellen Handlungsmöglichkeiten als Verhandlungsgut einsetzen. Durch Zielvereinbarungen würden diese zuvor informellen Handlungen nun zur Selbstverständlichkeit. Durch die Verlagerung des Qualitätsmanagements in die Gruppen hinein würden Regelabweichungen von den Gruppen erwartet und nicht mehr wahrgenommen. Die Mitarbeiter bekämen nicht mehr gesagt, wie sie arbeiten sollen, sondern nur noch, welche Ziele sie erreichen sollen. Was vorher Extraleistung gewesen sei, sei nun selbstverständlich (Kühl 2001b, S.208).
5.3 Zunehmende Machtkämpfe
Kühl zufolge (1998, S.93) haben die Machtkämpfe in postbürokratischen Unternehmen zugenommen. Individualität und Selbstregulation erforderten mehr Absprachen über Umgangsregeln. Enthierarchisierung und Entstrukturierung führten zu einer Zunahme von Machtkämpfen, da sie weniger reguliert seien. Hierarchien, Bürokratien und Aufteilungen in Abteilungen hätten neben ihren negativen Seiten für Flexibilität und Kreativität auch eine Entlastungsfunktion. Positionen müssten nicht ständig neu ausgehandelt werden und die Konfliktanfälligkeit der Organisation werde reduziert. „Dadurch, dass es keine stabilen Herrschaftsgefüge gibt, werden alle Machtprozesse in mehr oder minder offenen Auseinandersetzungen aufgelöst. Die Organisation ist letztlich nichts weiter als eine Welt des Konflikts“ (ebd., S.104).
Politisierung, wie Kühl es bezeichnet, bedeute in postbürokratischen Unternehmen erstens, dass durch Enthierarchisierung jede Entscheidung von jedem kritisierbar und in Frage stellbar sei; zweitens führe die Vereinheitlichung der Informationsbasis dazu, dass Kommunikation von Entscheidungen und Informationen einer interessenoffenen Interpretation durch die beteiligten Akteure ausgesetzt seien; drittens führten ständige Innovationen zu ständig neuen Unsicherheitszonen, die nicht immer von den gleichen Leuten kontrolliert würden. Innovationen führten somit zu Verunsicherung und Politisierung.
Macht werde in postbürokratischen Organisationen zunehmend tabuisiert. „Der Selbst- und Fremdanspruch, dass man Probleme autonom löst und man das gute Unternehmensklima nicht durch unnötige Spannungen gefährden dürfe, führte dazu, dass Machtverhältnisse und Schlüsselprobleme nicht mehr kommunizierbar waren“ (ebd., S.105). Als Schutzreaktion auf das Politisierungsdilemma würden Machtbeziehungen mit einem Mantel des Schweigens verhüllt. „Gerade weil Macht und Machtprozesse durch Entstrukturierungen so zentral geworden sind, können sie nicht mehr thematisiert werden“ (ebd., S.106). So bekomme Macht insbesondere in Projektgruppen, aber auch in teilautonomen Fertigungsgruppen einen diffusen, unkontrollierbaren Charakter, da es keine Routinen (ausgenommen teilautonome Fertigungsgruppen) oder formalisierte Regeln für Kooperation und Kommunikation gebe. Die begrenzte Rationalität des Verhaltens der Organisationsmitglieder, die eher lokal als allumfassend sei und welche die eigenen Interessen, Ziele und Wertsetzungen über die der Organisation stelle, schwäche die Position der Organisationsziele. Dezentralisierung, Profitcenter, Individualität und Autonomie in postbürokratischen Unternehmen verstärkten diese Ausbildung von lokaler und begrenzter Rationalität. Die Interessen der einzelnen Mitarbeiter seien stark ausdifferenziert und es gebe keine Spielregeln für die Lösung von Konflikten, so dass der Konflikt häufig die sachliche Problemdefinition überdecke. Inhaltlich unterschiedliche Positionen dienten in diesem Fall lediglich der Legitimation persönlicher Animositäten. Zu den Gefahren postbürokratischer Unternehmen zitiert Kühl Mintzberg: „Keine Struktur ist darwinistischer, keine fördert mehr den Fitten – solange er fit bleibt -, und keine ist verheerender für den Schwachen. Die verflüssigten Strukturen begünstigen die inneren Konkurrenzen und sind manchmal Nährboden für heftige Machtkämpfe“ (Mintzen nach Kühl 1998, S.108).
5.4 Dezentralisierung versus Integration
Die Grenzen zwischen System bzw. Organisation und Umwelt sind laut Kühl (1998, S.84) variabel. Sie hätten die „Doppelfunktion der Trennung und Verbindung von System und Umwelt“ (Luhmann nach Kühl 1998, S.86): die Identität werde durch die Grenzen erhalten, zugleich werde ein Austausch mit anderen Systemen ermöglicht.
Eine idealtypische postbürokratische Organisation ohne Grenzen würde keine Orientierung leisten und die Komplexität der Welt nicht reduzieren. Die Entscheidungen wären beliebig und nicht zusammenhängend. Totale Flexibilität bedeute den Verlust von Einheit und Kontinuität, die Grenzen zur Umwelt gingen verloren und die Organisation „fließt sozusagen in die Umwelt hinüber, zergeht im Reich der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Umsetzung externer Unsicherheit in interne Sicherheit droht somit, die Organisation an sich zu zerstören“ (ebd., S.87). Kühl bezeichnet dieses Problem als „Identitätsdilemma“.
Die Aufnahme von Marktmechanismen in die internen Organisationsprozesse lasse die Grenze zwischen Organisation und Umwelt verschwimmen. Umweltkontakte der Organisation seien nicht mehr in einem einzelnen Unternehmensbereich monopolisiert, sondern potentiell habe jeder Mitarbeiter die Möglichkeit zu Außenkontakten, was die Grenzziehung erschwere. Eine Reaktion auf diese Auflösungserscheinung könnten autoritäre Regelungen, klare Abgrenzungen und eine stärkere interne Gliederung sein, dann würden die Flexibilitätsanforderungen jedoch nicht mehr erfüllt. Die Grenzen von Unternehmen seien auch geographisch immer weniger festzumachen, der Arbeitsplatz könne jetzt etwa beim Kunden liegen. Dazu werde immer undurchsichtiger, wer zur Organisation zähle und wer nicht, wer Mitglied sei. Mitgliedschaft bedeute gegenseitige Erwartungssicherheit zwischen Organisation und Mitarbeiter, Rollenerwartungen gäben vor, was von den Mitarbeitern verlangt und was nicht verlangt werden könne. Die klare Abgrenzung „Mitglied oder Nichtmitglied“ verschwimme in postbürokratischen Organisationen, wodurch sich die Loyalität zum Gesamtunternehmen verringere. Das Wohl der eigenen Geschäftseinheit, für die der Manager voll verantwortlich sei, werde ihm irgendwann wichtiger als das Wohl des Gesamtunternehmens. Dezentralisierung fördere „engstirnige Kleinstaaterei“ und „Bereichsegoismen“, was in der Natur der Sache liege: „Das Problem, das sich autonome Einheiten nur begrenzt mit dem Gesamtunternehmen identifizieren, ist eben nicht das Ergebnis einer schlechten Dezentralisierung, sondern das Resultat einer konsequenten Ausbildung von selbstständigen Einheiten“ (ebd., S.91)[2]. Kompetenzstreitigkeiten und Rivalitäten, wie es sie zwischen autonomen Einheiten gibt, habe es auch in hierarchisch-bürokratischen Unternehmen gegeben, doch habe dort letztlich die Unternehmensspitze entscheiden können. Diese stehe im postbürokratischen Unternehmen vor der paradoxen Aufgabe, gleichzeitig Desintegration und Integration zu ermöglichen. „Das Identitätsdilemma postbürokratischer Organisationen besteht darin, selbstständigen Organisationseinheiten ein Höchstmaß an Autonomie zuzugestehen, gleichzeitig diese autonome Einheiten aber so zu integrieren, dass das Gesamtunternehmen eine eigenständige Identität behält“ (ebd., S.92).
5.5 Komplizierende Vereinfachungsstrategien
Die neuen Organisationsformen sollen Kühl zufolge (1998, S.108) Komplexität durch Einfachheit ersetzen. Wachsende äußere und innere Turbulenzen bedeuteten oft ein Zuviel an Informationen und an raschen Veränderungen. Die hochgradig arbeitsteilige Organisation, die zu große Produktpalette und überzogene Automatisierung gälten heute als „Komplexitätstreiber“. „Komplexitätskosten“ sollten durch kürzere Entscheidungswege, die durch Hierarchieabbau entstünden, durch Center-Konzepte und durch die Konzentration auf Kernkompetenzen und Auslagerung anderer Kompetenzen gesenkt werden. Lean Management sei die Bezeichnung für diese Vereinfachung und Verschlankung. Letztlich gehe es bei diesem Konzept genau wie bei Bürokratien um die Vorwegfürsorge für alle denkbaren Fälle. Outsourcing beinhalte, dass weniger selbst gemacht und mehr eingekauft werde, wodurch Komplexität an externe Zulieferer und Dienstleister abgegeben werden solle. Ein ständiger Verbesserungsprozess (Kaizen) solle nun durch die in die Verantwortung genommenen Mitarbeiter selbst geschaffen werden. Hierarchieebenen würden reduziert, ohne dass Hierarchie abgeschafft werde. Automatisiert werden sollten bei der Lean Production nur noch die einfachen Arbeitsgänge.
Auch Taylorismus und Bürokratien zielten darauf ab, Komplexität zu reduzieren. Ihr Resultat sei jedoch eine hochkomplexe Form des Produzierens. Fertigungsfehler würden von den unmotivierten Mitarbeitern hingenommen und sorgten für erhöhte Komplexität und die funktional ausdifferenzierten Abteilungen führten zu zunehmendem Abstimmungsbedarf. Innovationsprozesse würden dadurch hochkomplex und langsam. Für das Lean Management gelte allerdings genauso wie für den Taylorismus, dass die Komplexitätsvereinfachung nichts anderes sei als eine Komplexitätssteigerung:
- Auslagerung bedeute nur Komplexitätsverlagerung von den rein organisationsinternen Bereichen zu den Abteilungen, die für die Umweltbeziehungen zuständig sind. „Man plagt sich jetzt nicht mehr mit den hauseigenen Informatikerinnen herum, sondern mit den teuer von außen eingekauften“ (ebd., S.114)[3].
- Just-in-time-Konzepte sollten die Lagerkosten reduzieren, führten aber auch dazu, dass die gesamte Logistik extrem störanfällig werde. Daher benötigten diese Konzepte intensive Wartungs- und Qualitätssicherungsanstrengungen und veränderte Zuliefer-Abnehmer-Beziehungen. Es seien keine Reserven und Zeitpuffer für Störanfälle mehr vorgesehen, das gelte auch organisationsintern.
- Durch weniger Personal solle verschlankt und Komplexität reduziert werden, doch durch weniger Personal stiegen die Anforderungen an den einzelnen Mitarbeiter. Komplexität werde nicht reduziert, sondern versteckt.
- Teamarbeit sei wesentlich komplexer als eine funktional bis kleinste zergliederte Produktion. Bei ersterer sei wenig definiert. Teamarbeit auf japanische Weise bedeute dagegen Vereinfachung, da sie sehr stark strukturiert sei.
Die Probleme mit den Lean-Konzepten würden auf unfähiges oder unzureichend geschultes Personal abgewälzt. Dazu merkt Kühl an: „Das Versagen einer Organisationsstrategie mit Persönlichkeitsmängeln der Manager und Mitarbeiter zu erklären ist nicht nur intellektuell unbefriedigend, sondern verstellt dem zur Veränderung bereitem Management auch den Blick auf strukturelle Probleme neuer Organisationskonzepte“ (ebd., S.116).
Die Annahme, dass einfache Regeln und Strukturen zu einer niedrigkomplexen Organisation führten, sei falsch. Vielmehr erzeugten einfache Regeln hochkomplexe Systeme, wie es von Mathematikern, Wirtschaftswissenschaftlern, Physikern und Biologen nachgewiesen worden sei. „Komplexität entsteht durch das Zusammenwirken einiger einfacher Regeln und nicht als Ergebnis eines umfangreichen, detaillierten Regelwerkes.(...) Eine Organisation ist nicht entweder hoch komplex oder einfach, sondern sie kann ihre Komplexität durch Vereinfachungsstrategien steigern“ (S.118). Organisationen strebten nach Einfachheit, da alles komplexer geworden sei. „Postbürokratische Unternehmen sind letztlich die organisationelle Reaktion auf große Umweltturbulenzen. Sie können diese nur deswegen beherrschen, weil sie sich mit ihren internen, komplexen Abläufen auf sie einstellen. Postbürokratische Unternehmen sind – allem Dürsten nach einfachen Strukturen zum Trotz – dazu verdammt, komplex zu sein“ (ebd., S.119). Entweder könnten Unternehmenseinheiten sämtliche Organisationsfunktionen angegliedert werden oder bestimmte Funktionen würden zentral von allen Einheiten genutzt. In beiden Fällen steige die Komplexität, da jeweils komplexe Kooperationsbeziehungen aufgebaut werden müssten.
Die Gefahr bestehe nicht so sehr in dem Komplexitätsdilemma selbst, sondern darin, dass dieses Dilemma nicht wahrgenommen werden würde und weiterhin von vermeintlichen Vereinfachungen die Rede ist. Komplexität müsse als Herausforderung, nicht als Gefahr begriffen werden.
5.6 Nachteile der Gruppenarbeit
Gruppenarbeit bedeutet Spieß zufolge (1996, S.175) einen größeren Zeitaufwand für die Entscheidungsfindung durch Diskussionen, was auch einen größeren finanziellen Mehraufwand für das Unternehmen bedeute. Nach Kühl (2001a) wird Gruppenarbeit eingeführt, um schnell und treffsicher Entscheidungen in einer sich rasch wandelnden Umwelt zu fällen. Die Informationsverzögerung durch viele Hierarchieebenen falle weg. Dieser Vorteil sei jedoch nur unter ruhigen Bedingungen zutreffend, bei hohem Zeitdruck fehlten klare Anweisungen von oben, da nicht alles ausdiskutiert werden könne. In der Gruppe mit gleichberechtigten Mitgliedern erfordere der Konsens eine hohe Kommunikationsbelastung (je größer die Gruppe, desto mehr Kommunikationsmöglichkeiten und Notwendigkeiten gibt es). Entscheidungen würden so unter großem Druck gefällt oder den Vorgesetzten überlassen. Diese diskursive Belastung trete auch bei höher qualifizierten Führungsteams ein.
Die Verantwortung für Qualität, Produktivität und Termineinhaltung werde nicht mehr einer einzelnen Person, sondern einer Gruppe zugewiesen. Dies führe jedoch zu einer Verantwortungsdiffusion, es würde sich der Verantwortung entzogen und Aufgaben nach oben weitergereicht. Dies liege daran, dass man nicht durch Fehler zum Prügelknaben werden wolle. Insbesondere für die Sprecher entstehe der Eindruck, dass sie ihren Kopf alleine hinhalten müssten, ohne alleine verantwortlich zu sein. Diese Schwierigkeiten träfen insbesondere auf Führungsteams zu, da die Aufgabenstellungen hier offener seien als bei den Montage- und Fertigungsinseln und somit schwieriger standardisiert werden könnten (Kühl 2001a, S.477).
Durch Teamstrukturen sollten die Führungskräfte den Mitarbeitern gegenüber klarer und koordinieter auftreten, wie ein gemeinsam verantwortliches Team. In Stresssituationen funktioniere dies jedoch nicht, weil es keinen klaren Ansprechpartner für die einzelnen Bereiche mehr gebe. Dadurch könnten die Mitglieder der Führungsteams von den Untergebenen gegeneinander ausgespielt werden: „Wenn ich sage: das geht nicht, geht er zum nächsten, und schon ist der Wurm drin“ (Führungsteammitglied nach Kühl 2001, S.479).
Wie bereits weiter oben angesprochen (5.3), stellen Machtkämpfe ein zunehmendes Problem für das postbürokratische Unternehmen dar. Gruppenarbeit solle laut Kühl (2001a, S.479) die Kooperation und Kommunikation zwischen den Mitarbeitern verbessern und Geborgenheit und Zusammengehörigkeit vermitteln. Es werde suggeriert, dass die Kooperation innerhalb der Gruppe besser funktioniere als nach außen und dass es weniger Konflikte innerhalb der Gruppe gebe. Tatsächlich verstärke das Prinzip der Selbstorganisation jedoch Machtkämpfe, da die Machtverhältnisse nun diffuser und weniger stabil seien. Auseinandersetzungen tendierten nun eher dazu, persönlich statt sachlich zu werden. Das Fehlen eines Vorgesetzten, der bei Auseinandersetzungen deeskalierend und schützend eingreife, mache sich bemerkbar.
In den Fertigungs- und Montagegruppen entstehe eine informelle Hackordnung in einem darwinistischen Machtkampf. Wer nicht genügend Leistung erbringe und damit der Gruppe schade, werde von den anderen Gruppenmitgliedern sanktioniert.
In den Führungsgruppen seien die Arbeitsaufgaben weniger standartisiert, sie seien sachlich, zeitlich, personell und ökonomisch unbestimmter. Die Leistungsbeiträge der einzelnen Personen könnten kaum objektiv gemessen werden. Der Wunsch nach Karriere und Anerkennung sei in den Führungsgruppen ausgeprägter, zugleich seien Aufstiegschancen durch die dezentralen Strukturen beschränkt. Um Karriere zu machen, müsse man daher als Person und nicht als Teammitglied wahrgenommen werden.
Probleme bei der Gruppenarbeit rührten zum Teil auf Schwierigkeiten bei der Einführung und fehlender teamorientierter Sozialisation der Mitarbeiter, jedoch nicht nur. Die neue Organisationsstruktur habe genau wie der Taylorismus auch negative Seiten. Dabei seien Führungskräfteteams aufgrund geringer Aufgabenstandardisierung und der Sandwich-Position des mittleren Managements eher noch stärker von den Problemen betroffen als Teams im wertschöpfenden Bereich (Kühl 2001a, S.481).
Eine starke Kohäsion in der Gruppe ist Spieß zufolge (1996, S.172) nicht mit mehr Leistung gleichzusetzen. Zwischen der Gruppenverbundenheit und der Organisationsverbundenheit bestünde nur eine schwache Beziehung. Die Dominanz einzelner oder eine zu hohe Kohäsion stellten eine Gefahr dar, die eigene Meinung könne unterdrückt werden. Nonkonformes Verhalten würde unterdrückt. Insbesondere Leistungsschwache und Außenseiter würden diskriminiert. Es fehle ein Leistungsanreiz, da nur individuelle Leistung belohnt würde. Manche Arbeitsplätze seien besser für Einzelpersonen geeignet.
6. Mögliche Lösungen für die Zukunft
Unternehmen müssen Deutschmann zufolge Unsicherheit wiedereinführen. Überleben könnten sie nur, indem sie aktive Anpassung betrieben anstatt nur zu reagieren. Führungskräfte wie Mitarbeiter müssten zu Beobachtern des eigenen Unternehmens werden, Selbstreflexivität sei gefordert (Deutschmann 2002, S.115).
Kühl meint, dass Organisationen sowohl Stabilität, Strukturen, Routinen und Regeln als auch Flexibilität, Chaos und Wandle benötigen (Kühl 1998, S.124). Unternehmen sollten nach dem Prinzip der „begrenzten Instabilität“ (ebd., S.128) organisiert sein. Kühl zieht die Chaosforschung heran und vergleicht postbürokratische Unternehmen mit dem Wetter, bei welchem langfristige Voraussagen unmöglich seien, welches aber dennoch nicht völlig beliebig sei sondern aus irregulären Mustern bestehe. Viele Unternehmen befänden sich in einem ständigen Hin und Her zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Dabei suchten sie nicht einen perfekten Zustand, sondern profitierten von einem Prozess des Wandels, einer begrenzten Instabilität zwischen zentralistischer und dezentralistischer Strategie.
Es gebe bei Menschen die Tendenz, auf starre Ordnungen und Strukturen mit Widerstand und Zerstörung zu reagieren und umgekehrt auf Instabilität, Strukturlosigkeit und mangelhafter Kommunikation mit der Schaffung von Strukturen, Sicherheiten und Übersichtlichkeit. Chaos und Komplexität bewirkten, dass Selbstorganisation sich entwickeln könne. Selbstorganisationsfähigkeit von Systemen setzte allerdings voraus, dass es keine zu starren Strukturierungen gebe. Das System müsse in einem „kritischen Zustand“ sein, um sich selbst organisieren zu können. Ein Beispiel dafür sei ein Unternehmen, dessen Auftragsbücher in einer Krise leer sind und deren Beschäftigte daraufhin selbständig losziehen, um Aufträge zu akquirieren und neue Betätigungsfelder für ihr Unternehmen zu finden. „Im Prozess der Selbstorganisation sind nicht mehr die Teile oder Elemente wichtig, sondern die Aktionen und Interaktionen, die von ihnen ausgehen. Eine Organisation ist dann nicht mehr Summe ihrer Teile, sondern ein komplexes Gebilde aus Aktionen und Interaktionen von unabhängigen Elementen (...) Die Leistung eines Systems ist eben nicht die Summe der Leistungen der einzelnen Teile, sondern das Produkt der Interaktionen zwischen den Teilen“ (ebd., S.138). Selbstmanagement und Selbstorganisation erforderten Rückkopplungen, eine ständige Selbstbeobachtung, einen reflexiven Zirkelprozess. „Organisationen sind dann in letzter Konsequenz nicht mehr Strukturgebilde, sondern ein sich dauernd wandelnder, rückgekoppelter Prozess“ (ebd., S.139). Es gelte für Unternehmen, keine langfristige Planung vorzunehmen, sondern die Ausnutzung sich spontan ergebender Möglichkeiten in den Vordergrund zu stellen. Die Organisationsstrukturen müssten so gestaltet werden, dass Freiräume geschaffen werden, ohne dass Dilemmata wie Politisierung und mangelnde Integration einträten, wofür es keine Zauberformel gebe. Den Anforderungen von Stabilität und Flexibilität müssten gleichzeitig entsprochen werden. Um Unsicherheit von Organisationen zu reduzieren, ohne die Fähigkeit zur Selbstorganisation zu zerstören, führt Kühl vier exemplarische Strategien auf:
- Externalisierung von Unsicherheiten:
Netzwerke und Profitcenter unterlägen einer Doppelorientierung: Sie müssten eigenständig Profit vermehren und gleichzeitig das Wohl des Gesamtunternehmens mehren. Sie tendierten dazu, sich zu selbstständigen kollektiven Akteuren zu entwickeln. Dabei müssten die Eigenschaften von Netzwerken als Ergebnis einer selbstorganisierten Prozessdynamik gesehen werden und nicht als Summe der einzelnen Teile. Virtuelle Unternehmen beispielsweise bestünden aus einem komplexen Informationssystem und aus Subunternehmern. Ihre wichtigsten Merkmale seien Technologie (welche die Verknüpfungen erstellt), Spitzenleistungen (Konzentration auf Kernkompetenz), Vertrauen (gemeinsame Leistung) und Kurzfristigkeit (Beziehungen enden nach Erbringen der Leistung). „Hohle Organisationen“ bedienten nur noch die Schalthebel zwischen verschiedenen Akteuren. Sie kauften Ideen auf und vermittelten Produktion und Distribution an Subunternehmer bzw. selbständige Absatzvermittler. Das Risiko marktmäßiger Organisation bestehe darin, dass das mächtige Unternehmen dem Drang nicht widerstehen könne, strukturierend in die Selbständigkeit der Einheiten einzugreifen, wie es beispielsweise bei großen Endherstellern oft der Fall sei, die ihren Zulieferern diktierten, wie sie sich intern organisieren sollten. Ein anderes Beispiel seien Ölgesellschaften, die ihren offiziell selbstständigen Tankstellen und deren Pächtern sehr genaue Vorschriften machten. Auch Risiko und Haftung würden auf die Subunternehmer geschoben. Damit würden die Fähigkeiten zur kreativen Selbstorganisation der Subunternehmer genommen und ihre Eigeninitiative eher darauf gelenkt, wie sie ihre Muttergesellschaft austricksten.
- Relativ offene Technisierung von Abläufen und postbürokratische Architektur:
Technisierung diente in tayloristischen Betrieben als zentrales und zugleich subtiles Instrument der Kontrolle von Arbeitsprozessen. Sie sorge für Stabilität. Mit der Informations- und Kommunikationstechnologie könnten formale Regeln, bürokratische Prozeduren und externe Kontrollen vorprogrammiert werden. Neben Vereinfachung sorge die Technologie jedoch für mehr Komplexität auf höherer Ebene, da sie installiert, kontrolliert und gewartet werden müsse. Fehler erster Ordnung würden vermieden, Fehler zweiter Ordnung erzeugt. Der Technisierungsprozess müsse möglichst offen gestaltet werden, grobe Strukturen müssten ein Höchstmaß an Flexibilität ermöglichen (etwa bei einem Computerprogramm).
Die Architektur tayloristischer Unternehmen sei auf totale Kontrolle ausgerichtet gewesen, es wäre (nach Focault) eine „Architektur der Disziplin“ gewesen. Die Architektur postbürokratischer Unternehmen sei dagegen auf Gruppenarbeit und Kommunikation, auf viel Licht und wenig Wände ausgerichtet. Feste Arbeitsplätze gebe es nicht mehr. Innerhalb eines groben Orientierungsrahmens ließen sich die verschiedenen Möbel und Stellwände nahezu beliebig verschieben.
- Kontextsteuerung:
Bei der „kontrollierten Autonomie“ beschränke sich das Management auf Zielvorgaben. Den Mitarbeitern würden Eigenständigkeit und die Möglichkeit zu Fehlern eingeräumt. In einem offenen Kommunikationsklima sollten Erfahrungen ausgetauscht werden. Das Management bleibe dabei jedoch Herrscher über den Rahmen, über die Definition des Musters. Kontextsteuerung gehe darüber hinaus. Die autonomen Einheiten würden auch an der Bildung des Kontextes der Rahmenbedingungen beteiligt. Durch diese Partizipation an der Musterfestlegung erfolge zugleich eine Selbstbindung der Einheiten an den Kontext. Kommunikation über Koordination, über Erwartungen, Anforderungen, Informationen und Interessen ermögliche eine gemeinsame Abstimmung über Ziele. Bei der Soziokratie würde die Idee der Kontextsteuerung in der Organisationsstruktur formalisiert. In Betriebskreisen, in denen Vertreter verschiedener Abteilungen säßen, werde im Konsens über die gesamte Geschäftspolitik abgestimmt. Das Prinzip der Kontextsteuerung benötige Mechanismen, die ermöglichten, dass alle Teilnehmer mit dem Muster bzw. dem Kontext einverstanden seien, da es keine übergeordnete Rationalität, sondern nur begrenzte und lokale Rationalität in Organisationen gebe, was bedeute, dass die ausgehandelten Muster immer nur ein Kompromiss seien könnten. Hierarchie bleibe aufgrund der begrenzten Rationalität in Organisationen der letzte Rettungsanker, um eine Entscheidung zentral durchzusetzen. Sie werde nun jedoch durch Konsensprinzip, doppelte Bindung und Personenwahl reguliert (Soziokratie).
- Unternehmenskultur:
Unternehmenskultur bzw. Corporate Identity diene der Sinn-, Glaubens- und Visionsstiftung. Kulturen bildeten sich in jeder Organisation aus. Hierbei handele es sich um eine soziale Konstruktion aus Werten, Symbolen, Mythen und Legenden. Dabei gebe es ein Nebeneinander von verschiedenen Symbol- und Wertsystemen (oder auch Semantiken). Unternehmenskultur wolle diese Vielfalt reduzieren, tatsächlich sei sie nicht beherrschbar und programmierbar. Eine von oben verordnete Unternehmenskultur werde nur als Kontrolle durch das Management gesehen. Nur die allgemeine Zustimmung der Mitarbeiter könne die Legitimation einer Unternehmenskultur sichern. Zahlungsfähigkeit als Unternehmenskultur sei wohl zu ehrlich, Wandel als Leitgedanke sei paradox, da dann genau das, was die Organisation an den Rand der Selbstauflösung dränge, sie stabilisieren solle. Unternehmenskultur könne dennoch die Mitarbeiter auf einen groben Kontext ihres Beisammenseins einigen und für einen begrenzten Zeitraum einen stabilen Orientierungsrahmen bieten. Sie schaffe Einheit nach außen und Integration nach innen: „Je fließender die Grenzen zwischen Umwelt und Organisation sind, desto notwendiger und schwieriger ist die Integration durch eine Organisationskultur“ (ebd., S.157).
Die neuen Organisationskonzepte ließen viele Fragen offen, anders als dies die Managementliteratur meist suggeriert werde. Unsicherheit gelte nicht nur für Organisationen, sondern auch für Organisationsberater. Klar sei jedoch: „Der tayloristische Siegeszug ist vorbei“ (ebd., S.158), denn durch noch mehr Kontrolle, Regeln und Bürokratie sei die wachsende Komplexität nicht in den Griff zu bekommen. Es gehe darum, ein neues Mischverhältnis zwischen Stabilität und Flexibilität zu schaffen.
7. Schluss
Die Rahmenbedingungen für Organisationen haben sich mit den neuen gesellschaftlichen Werten, der komplexeren Technik und den härteren Wettbewerbsbedingungen geändert. Tayloristische Organisationskonzepte stellen für diese Situation keine Lösung mehr dar. Die neuen Organisationskonzepte sind komplexer als die alten, weil die komplexer gewordene Umwelt es so erfordert. Die hohe Bedeutung diskursiver Koordination und der ständige Wandel machen diese Komplexität aus. Konsensfindung in der Gruppe bedeutet zunächst einen höheren Aufwand an Zeit, persönlicher Energie und an Kosten, als wenn die Entscheidungen zentral von Einzelpersonen gefällt würden. Dennoch ist sie nötig, denn mehr Komplexität bedeutet eben, dass für die richtigen Entscheidungen ein höherer Aufwand betrieben werden muss. Eine auf kurzfristige Aktienwertsteigerung angelegte Unternehmensstrategie kann jedoch verhindern, dass dieser Mehraufwand betrieben wird. Dezentralisierung, flache Hierarchien und Gruppenarbeit sind nicht nur in sich komplex, sondern sie stellen auch einen inhärenten Widerspruch zur Organisation per se dar, welche durch Hierarchie, Zentralismus und Entscheidungen von Einzelpersonen gekennzeichnet ist. Dieser Widerspruch kann letztlich nicht aufgelöst werden, muss aber bedacht werden. Eine autonome Unternehmenseinheit ist eben ein Widerspruch in sich, entweder ist die Einheit autonom, oder sie gehört zum Unternehmen. Doch die Realität liegt immer zwischen diesen radikalen Punkten von Anarchie und Diktatur. Netzwerke stellen so eine Zwischenlösung dar. In der Realität schwanken Organisationen zwischen Zentralisierungs- und Dezentralisierungsstrategien. Ein aktuelles Beispiel für Zentralisierung stellen die vier großen Bremer Krankenhäuser dar, in welchen Bereiche zusammengelegt werden, so dass bestimmte Behandlungen nur noch in jeweils einem der Krankenhäuser erfolgen. Dadurch werden Kosten gespart[4]. Der Trend zu Dezentralisierung ist also nicht total.
Solange es Organisationen gibt, gibt es auch Hierarchien. Die Machtassymetrie im Unternehmen ist erhalten geblieben, sie wird nun aber anders gehandhabt. Der Mitarbeiter hat mehr Handlungsspielräume, doch seine Leistung ist nun noch stärker gefordert und sie wird effektiver kontrolliert. Die quantitative Kontrolle durch den Markt ist nicht nur verschleierte Herrschaft, sie besitzt auch eine größere Legitimität ihrer Herrschaft als die Unternehmensleitung, welche diese heutzutage nicht mehr erreichen kann.
Partizipation der oder Kontextsteuerung durch die Mitarbeiter gehören nicht nur zu den neuen Organisationskonzepten, sie entsprechen auch der modernen Gesellschaft und der Demokratie eher, auch wenn sie sich als allein politische Forderung in den Unternehmen kaum durchsetzen werden. Auch von der Demokratie ist bekannt, dass die Entscheidungsfindung mitunter mit Schwierigkeiten verbunden ist. Dennoch hat sich gezeigt, dass Alleinherrschaft keine bessere Alternative ist (auch wenn die Gleichsetzung von Organisation und Politik mit Schwierigkeiten verbunden ist).
Es ist viel von Konsensfindung die Rede gewesen. Dabei ist außer Acht gelassen worden, dass auch in Arbeitsgruppen Mehrheitsentscheidungen möglich und in manchen Fällen möglicherweise angemessener sind – mit den verbundenen Nachtteilen aber dafür mit weniger Aufwand, sich zu einigen. Konsensfindung setzt voraus, dass alle Teilnehmenden einigermaßen „auf gleicher Wellenlänge liegen“, was gerade in Unternehmen sicherlich nicht immer der Fall ist. Auf der anderen Seite können hier Entscheidungen tendenziell zielorientierter gefällt werden. Durch Mehrheitsentscheidungen wird dafür riskiert, dass ein mancher sich von der Entscheidung ausgeschlossen fühlt und dementsprechend reagiert.
Weiterhin gilt es zu unterscheiden zwischen Ambivalenzen von idealtypischen Organisationskonzepten (wie Koordination von autonomen Einheiten) und den Ambivalenzen von betrieblichen Realitäten. Zu Letzteren: Zum einen ist jedes Unternehmen anders, wie auch Dörres Typologie von Betrieben nach Grad der Partizipation zeigt (Dörre 2001, S.677). Zum anderen muss die Unternehmensrhetorik hinsichtlich Gruppenarbeit und Dezentralisierung nicht viel mit der Realität im Unternehmen gemein haben. So sind nicht alle Probleme der neuen Organisationskonzepte darauf zurückzuführen, dass sie in sich widersprüchlich sind. Wie Minssen festgestellt hat, sind nicht die Strukturen der Organisationen homogen, sondern nur die nach außen vertretenen Leitlinien. Diese würden auch dann vertreten, wenn sie nicht realisiert werden und die Diskrepanz zwischen Selbstdarstellung und interner Praktik sei groß (Minssen 2001, S.194). Die Probleme entstehen also auch dadurch, dass die neuen Konzepte falsch, halbherzig oder gar nicht umgesetzt werden. Ganz ohne die Akzeptanz der Beteiligten geht es übrigen auch nicht.
Die von Kühl vorgeschlagenen Lösungswege machen deutlich, dass es keine detaillierten Antworten darauf gibt, wie eine Organisation gestaltet werden solle. Dennoch wird eine grobe Richtung deutlich. Unternehmen können nicht völlig auf Hierarchien verzichten, aber diese dürfen nicht statisch sein und die Mitarbeiter müssen an ihrer Gestaltung beteiligt werden. Freiräume müssen geschaffen werden, um Flexibilität, Kreativität und Innovation möglich zu machen. Ständige Selbstreflexion und Selbstbeobachtung sowie Diskursivität sind vonnöten, um die gestiegene Komplexität zu meistern.
Literaturverzeichnis
Antoni, Conny H. 2000: Teamarbeit gestalten. Grundlagen, Analysen, Lösungen. Beltz Verlag, Weinheim und Basel.
Baethge, M. 1991: Arbeit, Vergesellschaftung, Identität. Zur zunehmenden normativen Subjektivierung von Arbeit. In: Soziale Welt, Jahrgang 42, Heft 1, S.6-19.
Bihl, G. 1995: Wertorientierte Personalarbeit. Strategie und Umsetzung in einem neuen Automobilwerk. C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München.
Brock, D.; Otto-Brock, Eva-M. 1992: Krise der Arbeitsgesellschaft oder Entmythologisierung der Arbeit? Wandlungstendenzen in den Arbeitsorientierungen Jugendlicher im 20 –bzw. 30-Jahres-Vergleich. In: Klages, H.; Hippler, H.-J.; Herbert, W.: Werte und Wertewandel. Ergebnisse und Methoden einer Forschungstradition. Campus, Frankfurt/New York.
Deutschmann, Christoph 2002: Postindustrielle Industriesoziologie. Theoretische Grundlagen, Arbeitsverhältnisse und soziale Identitäten. Juventa Verlag Weinheim und München.
Dörre, Klaus 2001: Das deutsche Produktionsmodell unter dem Druck des Shareholder Value. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg.53, Heft 4, 2001, S.675-704.
Faust, Michael; Jauch, Peter; Brünnecke, Karin; Deutschmann, Christoph 1995: Dezentralisierung von Unternehmen. Bürokratie- und Hierarchieabbau und die Rolle betrieblicher Arbeitspolitik. Rainer Hampp Verlag, München und Mering.
Hoffmann, Jürgen 1999: Ambivalenzen des Globalisierungsprozesses. Chancen und Risiken der Globalisierung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 23/99.
Hesch, Gerhard 1997: Das Menschenbild neuer Organisationsformen. Mitarbeiter und Manager im Unternehmen der Zukunft. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
Kühl, Stefan 1998: Wenn die Affen den Zoo regieren. Die Tücken der flachen Hierarchien. Campus Verlag, Frankfurt/New York.
Kühl, Stefan 2000: Grenzen der Vermarktlichung. Die Mythen um unternehmerisch handelnde Mitarbeiter. In: WSI Mitteilungen 12/2000.
Kühl, Stefan 2001a: Zentralisierung durch Dezentralisierung. Paradoxe Effekte bei Führungsgruppen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 53, Heft 3, 2001, S.467-496.
Kühl, Stefan 2001b: Über das erfolgreiche Scheitern von Gruppenarbeitsprojekten. Rezentralisierung und Rehierarchisierung in Vorreiterunternehmen der Dezentralisierung. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg.30, Heft3, Juni 2001, S.199-222.
Marg, Oskar 2004: Wertewandel und der Arbeitskraftunternehmer. Stimmen die gewandelten Wertorientierungen mit dem Idealtypus der neuen Grundform der Ware Arbeitskraft überein? Hausarbeit, Universität Bremen.
Minssen, Heiner 2001: Zumutung und Leitlinie. Der Fall Gruppenarbeit. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg.30, Heft 3, Juni 2001, S.185-198.
Rosenstiel, Lutz von 1993: Wandel in der Karrieremotivation – Neuorientierungen in den 90er Jahren. In: Rosenstiel, Lutz von.; Djarrahzadeh, M.; Einsiedler, H.; Streich, Richard K. (Hg.): Wertewandel. Herausforderungen für die Unternehmenspolitik in den 90er Jahren. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
Spieß, Erika 1996: Kooperatives Handeln in Organisationen. Theoriestränge und empirische Studien. Rainer Hampp Verlag, München und Mering.
Springer, Roland 1999: Rückkehr zum Taylorismus? Arbeitspolitik in der Automobilindustrie am Scheideweg. Campus Verlag, Frankfurt/New York.
Vester, H.-G. 1993: Soziologie der Postmoderne. Quintessenz Verlags-GmbH, München.
[...]
[1] [1] Als Beispiel für eine Reaktion von Unternehmen auf die gewandelten Wertorientierungen sei die „wertorientierte Personalarbeit“ bei BMW hingewiesen, welche Bihl (1995) untersucht hat.
[2] Dazu passen die Klagen eines Managers von Kraft Foods während eines Universitätsseminars, der sich über „Säulendenken“ beschwerte und die Probleme nur in den Köpfen der Mitarbeiter sah, jedoch kein Wort über die inhärent-strukturellen Probleme von Gruppenarbeit und Dezentralisierung verlor.
[3] Siehe dazu auch den kürzlich in der Presse besprochenen Vorfall, bei welchem Bosch keine Einspritzanlagen an BMW und Daimler-Chrysler liefern konnte und beide Automobilkonzerne daraufhin ihre Produktion kurzzeitig einstellen mussten.
[4] Entnommen aus „Impuls. Personalzeitung am Klinikum Bremen-Mitte“, Nr.48, 12/04.
-

-
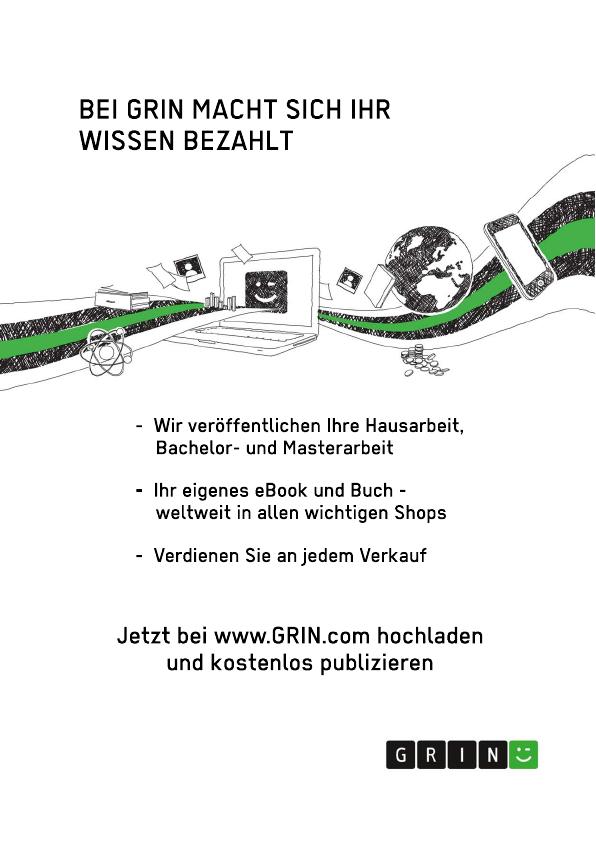
-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.

