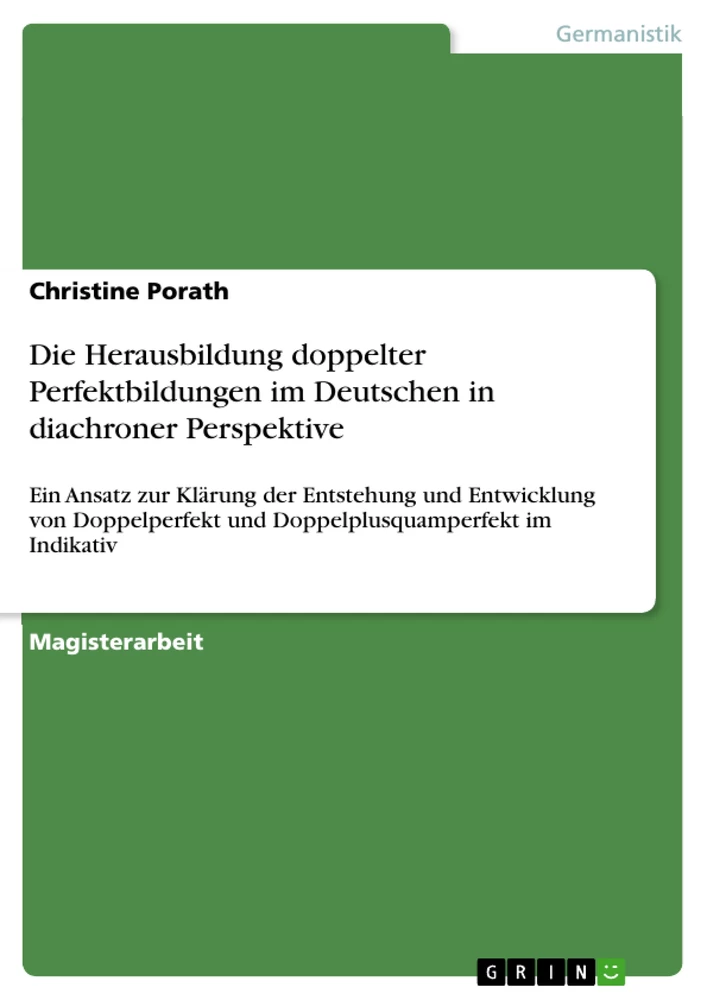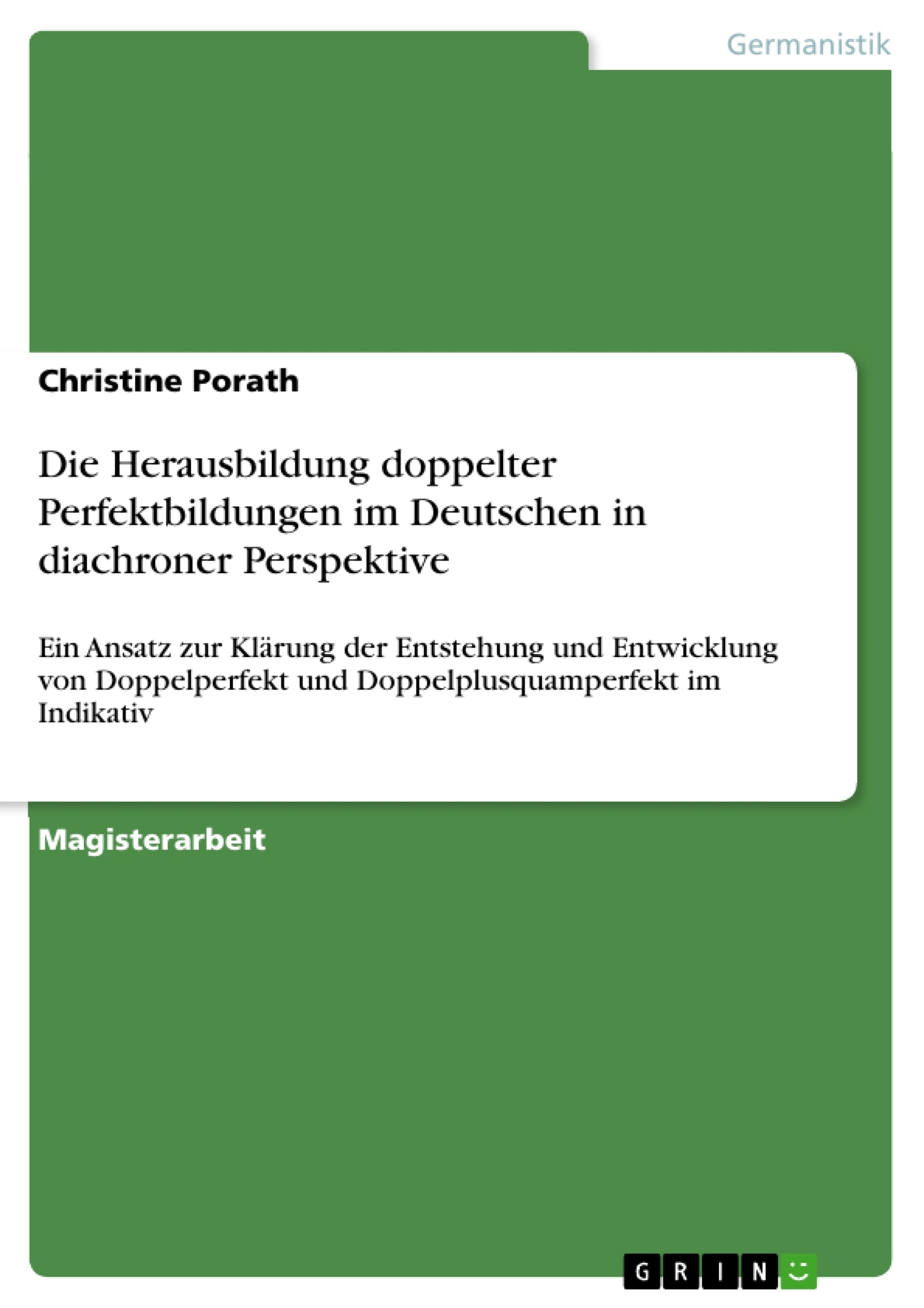Die Beschäftigung mit den doppelten Perfektformen im Deutschen hat in den letzten Jahren in der linguistischen Forschung immer mehr an Interesse gewonnen. Vorrangig ist das Hauptanliegen hier jedoch die synchrone Bedeutung und Funktion von Doppelperfekt und Doppelplusquamperfekt. Eher nebenbei wird auch die Entstehung dieser Formen thematisiert, wobei in vielen Fällen die Bildung auf synchroner Ebene als Grundlage dazu dient. Nur wenige Arbeiten bearbeiten diese Problemstellung tatsächlich aus diachroner Perspektive, noch seltener geschieht dies anhand von historischen Belegen. Erwähnenswert sind hier vor allem die Arbeiten von Buchwald-Wargenau (2010) und Şandor (2008).
Zur Diskussion stehen gerade auch in diesen Untersuchungen hauptsächlich zwei Thesen zur Herausbildung doppelter Perfektformen, die in der Forschung vielfach vertreten wurden: Bezeichnet werde können diese als Präteritumschwundhypothese und Aspekthypothese (Buchwald-Wargenau 2010, 223). Während erstere Hypothese davon ausgeht, dass der Schwund des Präteritums (und im Zuge dessen des Plusquamperfekts) im Oberdeutschen die Ursache dafür war, dass das Doppelperfekt (nicht jedoch das Doppelplusquamperfekt) als Ersatz des einfachen Plusquamperfekts zum Ausdruck von Vorvergangenheit entstanden ist, sieht die Aspekthypothese als Grund die abgeschwächte bzw. geschwundene resultative Aspektkomponente des einfachen grammatikalisierten Perfekts, die dazu geführt hat, dass sich die doppelten Perfektformen herausgebildet haben, um eben diese resultative Aspektualität wieder ausdrücken zu können.
In der Untersuchung von Buchwald-Wargenau (2010, 224ff.) wird jedoch vor allem die Gültigkeit der Präteritumschwundhypothese anhand von historischen Beispielsätzen stark in Zweifel gezogen. Aber auch für die Richtigkeit der Aspekthypothese konnten keine eindeutigen und überzeugenden Belege gefunden werden. Dies macht besonders deutlich, dass eine genauere Untersuchung historischer Belege und ein ausgereifter Theorierahmen zur Beschreibung der Herausbildung der doppelten Perfektbildungen im Deutschen notwendig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Vorgehensweise
- Das Doppelperfekt
- Die Funktion des Doppelperfekts Indikativ in der Gegenwartssprache
- Das Doppelperfekt als Plusquamperfektersatz
- Die Bedeutung, abgebrochener Zustand
- Die aspektuelle Bedeutung und die, weiter geltende Resultativität
- DPf zur Bezeichnung der „einfachen Vergangenheit“
- Systeminterne Voraussetzung für das DPf: Das einfache Perfekt
- Perfekt, Präteritum und Präteritumschwund
- Analyse der historischen Doppelperfekt-Belege
- Zusammenfassung zum Doppelperfekt
- Die Funktion des Doppelperfekts Indikativ in der Gegenwartssprache
- Das Doppelplusquamperfekt
- Die Funktion des Doppelplusquamperfekts in der Gegenwartssprache
- Die Bedeutung, Vor-Vorvergangenheit
- Die Funktion „einfache Vorzeitigkeit“
- Die Bedingung „versetzter Referenzpunkt“
- „Abgebrochener Zustand“ oder „abgebrochene Vollendung“
- Systeminterne Voraussetzung: Das einfache Plusquamperfekt
- Analyse der historischen Doppelplusquamperfekt-Belege
- Zusammenfassung zum Doppelplusquamperfekt
- Die Funktion des Doppelplusquamperfekts in der Gegenwartssprache
- Afinite Doppelformen
- Allgemeines zum Vorkommen afiniter Konstruktionen
- Afinite Doppelformen in der linguistischen Forschung
- Analyse der historischen afiniten Doppelformen
- Zusammenfassung zur afiniten Doppelform
- Schlussfolgerung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung von Doppelperfekt und Doppelplusquamperfekt im Deutschen aus diachroner Perspektive. Im Fokus steht die Klärung der Genese dieser Formen, basierend auf empirischen Untersuchungen, im Gegensatz zu bisherigen synchronen Ansätzen. Die Arbeit leistet somit einen Beitrag zur diachronen Syntaxforschung.
- Diachrone Entwicklung des Doppelperfekts und Doppelplusquamperfekts
- Funktion und Bedeutung der doppelten Perfektbildungen im historischen Kontext
- Systeminterne Bedingungen für die Entstehung der doppelten Perfektformen
- Analyse historischer Belege für Doppelperfekt und Doppelplusquamperfekt
- Vergleich der doppelten Perfektbildungen mit anderen Tempusformen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der doppelten Perfektbildungen im Deutschen ein und hebt die Forschungslücke hinsichtlich der diachronen Perspektive hervor. Sie begründet die Notwendigkeit einer empirischen Untersuchung und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Thematik der doppelten Perfektbildungen. Es werden die bisherigen Ansätze und deren Limitationen beleuchtet, insbesondere der Fokus auf synchrone Beschreibungen und das Fehlen umfassender diachroner Analysen.
Vorgehensweise: Hier wird die Methodik der Arbeit erläutert, einschließlich der verwendeten Korpora und der Analysemethoden. Es wird die Herangehensweise an die empirische Untersuchung der historischen Belege detailliert beschrieben.
Das Doppelperfekt: Dieses Kapitel analysiert die Funktion des Doppelperfekts in der Gegenwartssprache und seine historischen Entwicklungen. Es untersucht verschiedene Bedeutungsnuancen und den Zusammenhang mit anderen Tempusformen wie dem einfachen Perfekt und dem Präteritum. Die Analyse der historischen Belege soll Aufschluss über die Entstehung und Entwicklung des Doppelperfekts liefern.
Das Doppelplusquamperfekt: Analog zum Kapitel über das Doppelperfekt, wird hier das Doppelplusquamperfekt untersucht. Die Analyse umfasst die Funktion in der Gegenwartssprache, die historischen Entwicklungen, und den Vergleich mit anderen Tempusformen. Besonderes Augenmerk liegt auf der diachronen Entwicklung der Bedeutung und Funktion.
Afinite Doppelformen: Dieses Kapitel befasst sich mit afiniten Doppelformen und deren Vorkommen im historischen Kontext. Es analysiert die linguistische Forschung zu diesem Thema und untersucht die historischen Belege, um die Entwicklung dieser Konstruktionen nachzuvollziehen.
Schlüsselwörter
Doppelperfekt, Doppelplusquamperfekt, diachrone Linguistik, historische Syntax, Tempus, Aspekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Präteritum, Präteritumschwund, empirische Forschung, deutsche Grammatik, historische Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Diachrone Entwicklung von Doppelperfekt und Doppelplusquamperfekt
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die diachrone Entwicklung von Doppelperfekt und Doppelplusquamperfekt im Deutschen. Im Fokus steht die Klärung der Genese dieser Formen basierend auf empirischen Untersuchungen, im Gegensatz zu bisherigen synchronen Ansätzen. Die Arbeit leistet somit einen Beitrag zur diachronen Syntaxforschung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die diachrone Entwicklung des Doppelperfekts und Doppelplusquamperfekts, deren Funktion und Bedeutung im historischen Kontext, die systeminternen Bedingungen für ihre Entstehung, die Analyse historischer Belege und einen Vergleich mit anderen Tempusformen. Zusätzlich werden afinite Doppelformen im historischen Kontext untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Forschungsstand, Vorgehensweise, Das Doppelperfekt, Das Doppelplusquamperfekt, Afinite Doppelformen, Schlussfolgerung und Ausblick. Jedes Kapitel widmet sich einem spezifischen Aspekt der Thematik, beginnend mit einer Einführung und einem Überblick über den aktuellen Forschungsstand, gefolgt von der Beschreibung der Methodik und der detaillierten Analyse der Doppelperfekt- und Doppelplusquamperfekt-Formen sowie afiniten Doppelformen. Die Arbeit schließt mit einer Schlussfolgerung und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Wie wird die diachrone Entwicklung der Doppelperfekt- und Doppelplusquamperfekt-Formen untersucht?
Die diachrone Entwicklung wird anhand der Analyse historischer Belege untersucht. Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik, einschließlich der verwendeten Korpora und Analysemethoden. Die Analyse umfasst die Untersuchung verschiedener Bedeutungsnuancen und den Zusammenhang mit anderen Tempusformen wie dem einfachen Perfekt und dem Präteritum.
Welche Bedeutung haben die systeminternen Voraussetzungen für die Entstehung der doppelten Perfektformen?
Die Arbeit untersucht die systeminternen Voraussetzungen, wie z.B. das einfache Perfekt und Plusquamperfekt, um die Entstehung der Doppelformen zu erklären. Die Analyse zielt darauf ab, die Bedingungen zu identifizieren, die die Entwicklung dieser grammatischen Strukturen begünstigt haben.
Welche Rolle spielen afinite Doppelformen in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert auch afinite Doppelformen und deren Vorkommen im historischen Kontext. Diese Analyse trägt zum umfassenden Verständnis der Entwicklung von komplexen Tempuskonstruktionen im Deutschen bei.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und bewertet den Beitrag der Studie zur diachronen Syntaxforschung. Der Ausblick gibt Hinweise auf mögliche zukünftige Forschungsrichtungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Doppelperfekt, Doppelplusquamperfekt, diachrone Linguistik, historische Syntax, Tempus, Aspekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Präteritum, Präteritumschwund, empirische Forschung, deutsche Grammatik, historische Sprachentwicklung.
- Arbeit zitieren
- Cand. M. A. Christine Porath (Autor:in), 2010, Die Herausbildung doppelter Perfektbildungen im Deutschen in diachroner Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191930