Allgemein wird im umgangssprachlichen Gebrauch unter dem Begriff Vermittlung eine Art Schlichtung verstanden, welche von einer dritten Instanz zwischen zwei Parteien ausgeht. So soll beispielsweise eine dritte, vermeintlich neutrale Person zwischen zwei in Streit geratene Menschen „vermitteln“, indem sie beide Seiten anhört und die Diskussion auf ein friedliches Ende hin lenkt. Dabei versucht diese Person die Interessen beider Parteien zu berücksichtigen und möglichst eine Einigung herbeizuführen, die den Bedürfnissen beider entspricht.
Der lateinische Terminus Mediation, der übersetzt „Vermittlung“ bedeutet, be-schreibt die „harmonisierende Vermittlung bei persönlichen oder sozialen Konflikten“, wie zum Beispiel zwischen Scheidungsparteien (Duden Band 5: 615).
Die verschiedenen Verwendungsweisen des Begriffes stimmen dahin gehend überein, dass Vermittlung etwas ist, was zwischen zwei Seiten beziehungsweise zwischen zwei oder mehreren Subjekten stattfindet. Vermittlung gehört demnach auch zur sozialen Interaktion und setzt eine Beidseitigkeit in dem Sinne voraus, dass eine gegenseitige Bezugnahme erfolgen muss. Was durch diesen Prozess generiert wird, trägt zwar Teile von beiden Seiten in sich, ist aber dennoch etwas völlig „Neues“, das weder dem einen noch dem anderen ähnlich ist.
Sprechen wir in diesem Kontext von „Vermittlung“, impliziert eine gegenseitige Bezugnahme auch eine wechselseitige Einflussnahme beziehungsweise Beeinflussung. Dies hat weiter gedacht zur Folge, dass durch die Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft beide Parteien stetig eine mehr oder weniger gravierende Veränderung erfahren; der gesellschaftliche Kontext hat Einfluss auf das Verhalten und Denken der einzelnen Person, sowie die Verhaltensweisen der Mitglieder einer Gesellschaft diese selbst transformieren. Individuum und Gesellschaft befinden sich seit jeher in einem korrelativen Verhältnis, das auch als ein Abhängigkeitsverhältnis zu beschreiben ist. Einerseits hat man oft das Gefühl, durch die in einer Gemeinschaft notwendige Anpassung ein Stück „Freiheit“ aufzugeben, auf der anderen Seite wird uns gerade in diesem gesellschaftlichen Bereich auch wieder eine gewisse Freiheit eingeräumt. Diese Diskrepanz zwischen Anpassung und dadurch subjektiv eingebüßte, aber gleichzeitig auch daraus resultierende Freiheit macht Vermittlung, verstanden als reflexive Bezugnahme zwischen dem Einzelnen und dem sozialen Umfeld, zu einem komplexen Unterfangen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Was ist Vermittlung?
1.2 Die Ausgangsproblematik
1.3 Zielsetzung und Herangehensweise
1.4 Anmerkungen zum Aufbau dieser Arbeit
Teil A
2. Donald W. Winnicott und die psychoanalytische Pädagogik
2.1 Leben und Werk
2.2 Die Theorie der emotionalen Entwicklung
3. Der Beginn der Vermittlung
3.1 Ich und Selbst
3.2 Ich-Integration
3.3 Omnipotenzerfahrung und Realitätsprinzip
3.4 Von der absoluten zur relativen Abhängigkeit
3.5 Übergangsphänomene und –objekte
4. Vermittlungen des Selbst
4.1 Vermittlung als soziale und individuelle Aufgabe
4.2 Das „wahre Selbst“ – Der Kern der Identität
4.3 Das „gefügige Selbst“ und Vermittlung
4.4 Das „falsche Selbst“
4.4.1 Zur Konstitution des falschen Selbst
4.4.2 Formen des falschen Selbst und die Gefahr der Spaltung
5. Voraussetzungen für Vermittlung
5.1 Spiel, Kreativität und der „potenzielle Raum“
5.2 Der Beitrag der Umwelt
6. Zusammenfassung: Vermittlung bei D.W. Winnicott
Teil B (Vergleich)
7. George H. Mead und die Sozialpsychologie
7.1 Mead als Sozialpsychologe und Sozialphilosoph
7.2 Der symbolische Interaktionismus
8. Identitätsentwicklung
8.1 Identität: „I“ und „Me“
8.2 Subjektivität und Identität
8.3 Zur Konstitution des Ichs
8.4 Selbstbewusstsein
9. Voraussetzungen für Vermittlung
9.1 Spielen und Kreativität
9.2 Die Rolle der Umwelt
9.2.1 Identität als gesellschaftlicher Prozess
9.2.2 Sozialität
10. Zusammenfassung: Vermittlung bei G.H. Mead
11. Resümee
12. Literaturverzeichnis
12.1 D.W. Winnicott
12.2 G.H. Mead
... „die verschiedenen elementaren Ichs, die zusammen ein gesamtes Ich ausmachen und sich zu einem gesamten Ich organisieren, sind nur verschiedene Aspekte der Struktur des gesamten Ich; sie entsprechen den verschiedenen Aspekten des gesamten sozialen Prozesses.“
(George Herbert Mead: Sozialpsychologie, S. 271)
... „so ist doch die andere Tatsache ebenso wahr, daß jedes Individuum ein Isolierter ist, in ständiger Nicht-Kommunikation, ständig unbekannt, tatsächlich ungefunden.“
(Donald Woods Winnicott: Reifungsprozesse und fördernde Umwelt, S. 245)
1. Einleitung
1.1 Was ist Vermittlung?
Allgemein wird im umgangssprachlichen Gebrauch unter dem Begriff Vermittlung eine Art Schlichtung verstanden, welche von einer dritten Instanz zwischen zwei Parteien ausgeht. So soll beispielsweise eine dritte, vermeintlich neutrale Person zwischen zwei in Streit geratene Menschen „vermitteln“, indem sie beide Seiten anhört und die Diskussion auf ein friedliches Ende hin lenkt. Dabei versucht diese Person die Interessen beider Parteien zu berücksichtigen und möglichst eine Einigung herbeizuführen, die den Bedürfnissen beider entspricht.
Der lateinische Terminus Mediation, der übersetzt „Vermittlung“ bedeutet, beschreibt die „harmonisierende Vermittlung bei persönlichen oder sozialen Konflikten“, wie zum Beispiel zwischen Scheidungsparteien (Duden Band 5: 615).
Die verschiedenen Verwendungsweisen des Begriffes stimmen dahin gehend überein, dass Vermittlung etwas ist, was zwischen zwei Seiten beziehungsweise zwischen zwei oder mehreren Subjekten stattfindet. Vermittlung gehört demnach auch zur sozialen Interaktion und setzt eine Beidseitigkeit in dem Sinne voraus, dass eine gegenseitige Bezugnahme erfolgen muss. Was durch diesen Prozess generiert wird, trägt zwar Teile von beiden Seiten in sich, ist aber dennoch etwas völlig „Neues“, das weder dem einen noch dem anderen ähnlich ist.
Sprechen wir in diesem Kontext von „Vermittlung“, impliziert eine gegenseitige Bezugnahme auch eine wechselseitige Einflussnahme beziehungsweise Beeinflussung. Dies hat weiter gedacht zur Folge, dass durch die Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft beide Parteien stetig eine mehr oder weniger gravierende Veränderung erfahren; der gesellschaftliche Kontext hat Einfluss auf das Verhalten und Denken der einzelnen Person, sowie die Verhaltensweisen der Mitglieder einer Gesellschaft diese selbst transformieren. Individuum und Gesellschaft befinden sich seit jeher in einem korrelativen Verhältnis, das auch als ein Abhängigkeitsverhältnis zu beschreiben ist. Einerseits hat man oft das Gefühl, durch die in einer Gemeinschaft notwendige Anpassung ein Stück „Freiheit“ aufzugeben, auf der anderen Seite wird uns gerade in diesem gesellschaftlichen Bereich auch wieder eine gewisse Freiheit eingeräumt. Diese Diskrepanz zwischen Anpassung und dadurch subjektiv eingebüßte, aber gleichzeitig auch daraus resultierende Freiheit macht Vermittlung, verstanden als reflexive Bezugnahme zwischen dem Einzelnen und dem sozialen Umfeld, zu einem komplexen Unterfangen; Vermittlung kann daher als Aporie verstanden werden, als ein „Problem“, dessen „(Auf)lösung“ nicht möglich ist. Andererseits würde eine Lösung des Problems bedeuten, eine Seite hätte sozusagen „Recht bekommen“ beziehungsweise eine Seite würde in die andere völlig aufgehen. Es ist nicht möglich, dass der Einzelne in die Gesellschaft oder die Gesellschaft in den Einzelnen irgendwie aufgeht. Man könnte sagen, dass durch die gedachte Lösung des Problems das eigentliche Problem erst entstünde, da in diesem Fall eine der beiden Seite seine Existenz verlieren müsste. Bezieht man Vermittlung auf die Verhältnisbestimmung von Individuum und Gesellschaft, muss man grundsätzlich von einer Unlösbarkeit des „Problems Vermittlung“ ausgehen.
Eine weitere umgangssprachliche Verwendung des Vermittlungsbegriffs bezieht sich auf die „Vermittlung“ von Wissen; in diesem Kontext ist die Darlegung von mehr oder weniger fundierten Inhalten gemeint. Korrelierend mit dieser Semantik steht Vermittlung hier auch mit Aneignung in Verbindung. Wir machen uns beispielsweise in Bildungsveranstaltungen präsentiertes „Wissen“ zu eigen, indem wir dieses in bestehende subjektive Denk- und Handlungsmuster einbauen, wodurch sich einerseits die Inhalte, andererseits auch die bestehenden Denkmuster verändern können. Auch bei dieser begrifflichen Verwendung impliziert Vermittlung einen Dualismus; beide Seiten machen einen Vermittlungsprozess durch, denn auch die Seite, die vermeintliches Wissen darlegt, kann durch den eigensinnigen Aneignungsprozess beeinflusst und verändert werden. Auch wenn diese semantische Facette des Vermittlungsbegriffs im Kontext dieser Arbeit nicht explizit gemeint ist, sind einige Parallelen zu konstatieren.
Gehen wir hierzu von einem Subjekt aus, das sein Selbst mit der ihn umgebenden Welt vermittelt, findet auch hier eine Art Darlegung und Präsentation statt; die bestehende Welt, in welche das Kind im Zuge des Sozialisationsprozesses eingeführt werden soll, wird ihm als feststehendes Gebilde offenbart. Indem es jedoch sein Selbst mit den vorgefundenen Objekten und Subjekten „vermittelt“, das heißt indem es seine eigene Person zu dieser Umwelt in Beziehung setzt, verändert es die Dinge dadurch, dass es diese sich aneignet. Durch diesen Prozess konstituiert sich das Ich, die Identität. Andererseits kann die Umgebung, vor allem die soziale, immer wieder Transformationen unterliegen.
Grundlegend befinden sich Individuum und Gesellschaft in einem wechselseitigen Verhältnis. Diese Wechselseitigkeit ist eine notwendige, auf welcher die Existenz beider beruht. Das wechselseitige und in sich auch widersprüchliche Verhältnis zwischen Subjekt und Umwelt muss immer wieder neu hergestellt, beziehungsweise ausbalanciert werden; Vermittlung könnte man als Instrument für diesen Prozess bezeichnen.
Vermittlung hat in allen Verwendungsweisen etwas mit Reflexivität zutun; Voraussetzung ist die Bezugnahme eines Bereiches auf einen anderen. Im Falle der Vermittlung von Individuum und Gesellschaft ist diese Bezugnahme von Beginn des Lebens an immanent. Um die eine „Seite“, die des subjektiven, persönlichen Bereichs ausbilden zu können, ist diese Referenz auf das soziale Umfeld notwenig; das Umfeld impliziert bereits das Subjekt, da sich Gesellschaft durch und über die einzelnen Mitglieder konstituiert und transformiert.
Das Individuum kann es nicht ohne diese soziale Referenz geben, da Vermittlung die Voraussetzung für einen Menschen ist, welchen man als Subjekt mit eigener Identität bezeichnen kann. Ist von Gesellschaft und Individuen die Rede, muss von einer semantischen und existenziellen Einheit ausgegangen werden; eine Einheit, in der doch beide Teile für sich sichtbar sind, die jedoch dennoch nicht getrennt werden können, da die Existenz beider Teile durch den jeweils anderen bedingt ist.
1.2 Die Ausgangsproblematik
Die Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft stellt eines der Grundprobleme in pädagogischen Diskursen dar. In Mittelpunkt des Interesses vonseiten der Wissenschaft und der pädagogischen Praxis steht die Frage, wie der Eigensinn des Individuums mit dem gesellschaftlichen Auftrag von Bildung und Integration zu vereinbaren ist.
Diese Problematik stellt sich nicht nur in pädagogischen und bildungspolitischen Kontexten, sondern begegnet uns in fast jeder Lebenslage. Da das Individuum nur als Teil eines großen Ganzen, der Gesellschaft, gedacht werden kann, ist eine Herauslösung aus dem sozialen Umfeld nicht möglich. Aus diesem Grund erscheint es unmöglich zu erfassen, was genau das Subjektive, das man als „Kern“ der Identität bezeichnen kann, darstellt und impliziert. Trotz dieses Problems scheint es für die Meisten keine Schwierigkeit darzustellen, die Existenz eines solchen inneren Kerns anzunehmen.
Da wir als Teil einer Gemeinschaft aufwachsen und von Beginn unseres Lebens in einem wechselseitigen Verhältnis zu unserem Umfeld stehen, kann dieser Kern nicht unabhängig betrachtet werden. Es hängt zum großen Teil von unserer Umwelt und der Art und Weise unseres Aufwachsens ab, welche Anteile des „wahren Selbst“ zum Vorschein kommen. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass ein Mensch von Geburt an ganz bestimmte für ihn charakteristische Eigenschaften in sich trägt, entscheidet die Sozialisation maßgeblich darüber, wie ein Mensch wird. Sprechen wir vom „Werden“ eines Individuums, ist damit bereits angedeutet, dass Identität als ein Prozess, als Entwicklung zu verstehen ist. Das Menschsein ist von einer „Entwicklungstatsache“ bestimmt; Menschen sind nicht einfach, sie werden, oder genauer: Sie „werden erst, was sie sind“ ( Sesink 2001: 53). Die Potenziale für diese Entwicklung des Seins sind mit der Geburt gegeben, sie sind latent vorhanden; die Verwirklichung dieser Potenziale jedoch ist ein Prozess, welcher durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird.
Die eigene Potenzialität mit den Einflüssen der Umwelt zu vermitteln, das heißt beide Seiten aufeinander zu beziehen, stellt sich sowohl als individuelle, als auch als soziale und gesellschaftliche Aufgabe. Schon bei Erziehungsfragen sehen die meisten Eltern ihre Aufgabe auch darin, ihr Kind entsprechend zu fördern, das heißt beispielsweise Talente zu erkennen und weiterzuentwickeln, aber ihr Kind eben auch zu einem Mitglied der Gesellschaft zu erziehen. Als ein solches Mitglied muss sich das Individuum relativ unabhängig von der eigenen Potenzialität ein Stück weit anpassen und unterordnen. Anpassung ist im Allgemeinen meist sehr negativ konnotiert, da oft die Vorstellung mitschwingt, dadurch auf irgendeine Weise Teile der Persönlichkeit einbüßen zu müssen; völlig an ihre Umwelt angepasste Menschen erscheinen uns als „Mitläufer“, die nicht den Mut zu einer eigenen Meinung haben und immer mit dem „Strom“ schwimmen. Ein solcher Mensch hat sich nach dem allgemeinen Empfinden für den einfachsten Weg entschieden: Der Meinung der Mehrheit folgen und immer tun, was von ihm verlangt wird. Der hohe Preis für dieses „einfache Leben“ scheint ein wichtiger Teil der Persönlichkeit zu sein. Dieser Teil, der bei völliger Anpassung und Unterordnung ein Stück weit aufgegeben wird, scheint uns als einzigartigen Menschen auszumachen; Donald W. Winnicott, dessen Theorie ich in Verlauf meiner Arbeit darstelle, spricht diesbezüglich vom „wahren Selbst“ als Kern unserer Identität.
Grundsätzlich geht man zunächst davon aus, dass unsere Persönlichkeit als Ausdruck dessen, was man ist, durch jene Anteile gebildet wird, die dem wahren Selbst zugehörig sind. Äußere Einflüsse erscheinen hierbei oftmals als Störfaktoren, die es zu umgehen gilt.
Integration ist aufgrund der Vorstellung von Anpassung und Selbstaufgabe negativ konnotiert; dabei wird nicht berücksichtigt, dass eine gewisse Anpassung die Freiheit einräumt, sein „wahres Selbst“ zum Ausdruck zu bringen. Persönlichkeit oder Identität stellt immer eine Mischung dessen dar, was wir von Geburt an als Potenziale mitbringen und dem, was aus uns wird, das heißt, wie wir uns als Teil einer Gemeinschaft entwickeln. Der Kern unseres Selbst, den Winnicott „wahres Selbst“ nennt, kann nur im sozialen Kontext der Gesellschaft Realität werden; wir sind also nicht von Beginn unseres Lebens an, sondern tragen lediglich die Möglichkeiten zu dem in uns, was wir sein können. Um zu sein, müssen wir demnach werden, und dies kann nur im Rahmen unseres Umfeldes geschehen. Vermittlung in diesem Sinne ist also Grundvoraussetzung für das Sein, da die korrelative Bezugnahme von Potenzialität und Möglichkeiten zur Realisation erforderlich ist.
1.3 Zielsetzung und Herangehensweise
In der folgenden Arbeit soll dieses „Problem“ der Vermittlung auf der Grundlage eines exemplarischen Vergleichs zweier auf den ersten Blick durchaus recht unterschiedlich wirkenden Ansätzen dargestellt werden. Zu dieser vergleichenden Analyse dient zunächst die psychoanalytische Theorie der emotionalen Ent wicklung von Donald Woods Winnicott, welcher seine Einsichten vor allem auf seine praktische Tätigkeit als Kinderarzt uns Psychologe, sowie auf seine theoretisch fundierte, an Sigmund Freud angelehnte psychoanalytische Ausbildung stütze.
Diese Theorie möchte ich im Verlauf meiner Arbeit mit ausgewählten Stellen aus den Schriften des Sozialpsychologen George Herbert Mead vergleichen, der von einem sozialpsychologischen Behaviorismus ausgehend das soziale Verhalten im Rahmen eines symbolischen Interaktionismus analysierte.
Sowohl in der Psychologie als auch Soziologie wird der Mensch als Individuum im gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachtet. Damit haben Winnicott und Mead den gleichen Ausgangspunkt; der Mensch als soziales und interaktionelles Wesen kann und darf nur als Teil einer Gemeinschaft analysiert werden. Da beide von dieser Grundannahme ausgehen, stellt die Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft auch für beide ein zentrales Thema dar.
Diese Arbeit soll herausstellen, wie beide dieses Thema argumentativ entwickeln; was bedeutet Vermittlung in diesem Zusammenhang und warum muss die vonseiten der Gesellschaft und von der einzelnen Person ausgehend erbracht werden? Kann man überhaupt von einer vollkommenen und „gelungenen“ Vermittlung sprechen? Und falls ja, welche Bedingungen und Voraussetzungen müssen gegeben sein?
Eine weitere wichtige Frage, die vor allem Winnicott aufgrund seiner praktischen Arbeit mit Kindern beschäftigte ist die, wie das Umfeld, vornehmlich die Eltern, dem Kind beziehungsweise dem Säugling den Eintritt in die soziale Welt und damit gleichsam den Eingang in die Vermittlungsauseinandersetzung erleichtern und ermöglichen können.
Korrelierend mit der Vermittlungsthematik wird ausführlich auf die Begriffe des Ichs, der Identität, der Subjektivität und des Selbst eingegangen; diese Bezeichnungen werden von Winnicott und Mead gebraucht, um den Zustand der Integration beziehungsweise Integriertheit zu beschreiben. Integration bedeutet in diesem Kontext die Möglichkeit aber auch Notwendigkeit zur Vermittlung. Hier soll auf der Basis der genannten Theorien dargestellt werden, über welche Stufen beziehungsweise Phase der „Prozess der Integration“ erfolgt; wie kann Integration erreicht und beschrieben werden? Welchen Beitrag muss oder kann das Individuum, welchen die Umwelt leisten, um diesen Prozess sozusagen „in Gang“ zu setzten? Solche und ähnliche Fragen stehen bei dieser Analyse im Vordergrund, da die Bedeutung von Vermittlung vor allem durch „Fehler“ bei dieser individuellen, gesellschaftlichen und pädagogischen Aufgabe sichtbar werden können. Welche Auswirkungen es haben kann, dem Kind beispielsweise zu wenig oder gar keinen Freiraum für die emotionale Entwicklung einzuräumen, zeigt sich oftmals in der Herausbildung von psychischen Störungen und Problemen. Diese Schwierigkeiten führt Winnicott zum großen Teil auf eine Fehlentwicklung in der frühkindlichen Phase zurück; ist in dieser sehr bedeutsamen Phase eine Entfaltung in dem Sinne nicht möglich, dass das Kind zum Beispiel seine Kreativität im Spiel aufgrund bestimmter äußerer Einflüsse nicht entdecken kann, kann das Folgen für die spätere Entwicklung haben.
Auch wenn die Theorie Winnicotts diesbezüglich auf den ersten Blick möglicherweise etwas radikal erscheinen kann, besteht über die Bedeutung der Phase der frühkindlichen Entwicklung in Psychologie, Soziologie und Pädagogik weitgehend wissenschaftlicher Konsens.
Unter Bezugnahme auf den psychoanalytischen Ansatz von Winnicott und den sozialpsychologischen Ansatz Meads möchte ich des Weiteren erörtern, ob und wie das „Problem“ der Vermittlung „gelöst“ werden kann. Im Falle keiner Lösung (eine Auflösung kann es nicht geben, solange von Individuen ausgegangen wird) sollen zumindest Möglichkeiten aufgezeigt werden, auf welche Weise man sich diesem Problem annehmen kann, damit es weniger als „Problem“, sondern vielmehr als Aufgabe und Herausforderung verstanden werden kann.
Insgesamt möchte ich herausstellen, wie es im Normalfall einer „gesunden“ Entwicklung eines Menschen zu der Konstitution eines „Selbst“ kommt und damit zu der Möglichkeit von Vermittlung. Hierbei ist die Frage zentral, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit sich ein Individuum in diesem Sinne „normal“ oder „gesund“ entwickeln kann. Darüber hinaus muss an dieser Stelle der Frage nachgegangen werden, ab wann überhaupt von einem „Ich“ oder einem „Selbst“ die Rede sein kann.
1.4 Anmerkungen zum Aufbau dieser Arbeit
Die vorliegende Arbeit stellt die Vermittlungsproblematik anhand eines Vergleichs zweier theoretischer Ansätze dar, um exemplarisch aufzuzeigen, auf welche Art und Weise das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft betrachtet und interpretiert werden kann. Die dargestellten Perspektiven auf dieses Thema geben Aufschluss darüber, wie Vermittlung auf einer wissenschaftlichen Ebene verstanden werden kann, und welche Faktoren eine „gelingende“ Vermittlung beeinflussen. In beiden Theorien ist Vermittlung auf gesellschaftlicher, aber auch auf individueller Ebene angesprochen.
Der Vergleich von Donald Woods Winnicott und George Herbert Mead intendiert unter Einbeziehung soziologischer, psychologischer und pädagogischer Aspekte herausstellen, wie Vermittlung als individuelles und gesellschaftliches „Problem“ zu beurteilen ist. Beide Wissenschafter liefern hierfür unterschiedliche Ansätze, welche in dieser Arbeit dargestellt und analysiert werden sollen.
Da die Theorien von Winnicott und Mead relativ komplex aufgebaut sind, werde ich mich bei meinem Vergleich auf ausgewählte Aspekte beschränken, die ich vor dem Hintergrund des Vermittlungsthemas als sinnvoll und aussagekräftig erachte.
Zur Vereinfachung beginne ich mit der Darstellung einiger Ansätze Winnicotts, um diese anschließend in einen direkten Vergleich zu ähnlichen Aspekten der Theorie Meads zu setzten. Im Zuge dessen soll die gedanklich argumentative Entwicklungslinie beider Wissenschaftler nachvollzogen werden; auf diese Weise möchte ich zeigen, ob und in welchen Sinnzusammenhang die Vermittlung von Individuum und Gesellschaft in den beiden Theorien einzuordnen ist.
Da ich mich bei der Literaturauswahl überwiegend auf Originalschriften von Winnicott und Mead beziehe, weiche ich zur Vereinfachung von der gängigen Zitierweise ab, indem ich bei Primärliteratur auf die Angabe des Autors und die Jahresangabe verzichte. Da sich der erste Teil meiner Arbeit ausschließlich auf D.W. Winnicott bezieht, sowie der zweite Teil auf G.H. Mead, beschränke ich mich in diesen Kapiteln jeweils auf Nennung des Werkes mit Seitenangabe (zum Beispiel Familie und individuelle Entwicklung, 8).
In den darauf folgenden Abschnitten des theoretischen Vergleichs sowie im Schlussteil und Resümee verweise ich hingegen auf die jeweiligen Kapitel meiner Arbeit, die das Angesprochene ausführlich darstellen. Auf diese Weise vermeide ich Doppelnennungen und meines Erachtens nach unnötig lange Belegstellen.
Die von mir verwendete Sekundärliteratur wird wie allgemein üblich zitiert (zum Beispiel Schäfer 1995: 65).
Im Literaturverzeichnis werden alle Titel genau und vollständig aufgeführt, wobei ich die Originaltitel von Winnicott und Mead getrennt nenne und darüber hinaus eine Unterteilung von Primär- und Sekundärliteratur vornehme.
2. Donald W. Winnicott und die psychoanalytische Pädagogik
2.1 Leben und Werk
Donald Woods Winnicott wurde 1896 als Jüngstes von drei Kindern in Plymouth als Sohn einer britischen Kaufmannsfamilie geboren. Das Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern war nach eigenen Angaben Donalds von Toleranz, Offenheit und Erziehung zu Selbstständigkeit geprägt (vgl. Sesink 2002: 19).
Nach Beginn seines Medizinstudiums wurde Winnicott zeitweise als Krankenpfleger eingesetzt und sammelte während des Ersten Weltkrieges dort grundlegende praktische medizinische Erfahrungen, und meldete sich später freiwillig zur Marine, wo er Sanitätsoffizier wurde (vgl. Schäfer 1995: 68).
Nach der Beendigung seines Medizinstudiums arbeitete er als Kinderarzt im Green Childrens Hospital in Paddington und machte sich gleichzeitig mir einer eigenen Praxis selbstständig. Während seines Medizinstudiums und seiner psychoanalytischen Ausbildung kam er erstmals in Kontakt mit Freuds Psychoanalyse. Inspiriert von Freuds Traumdeutung beschäftigte sich Winnicott von da an viele Jahre mit den theoretischen Ansätzen Freuds. 1920 schloss er seine medizinische Ausbildung ab und begann kurz darauf im Alter von 27 Jahren seine zehnjährige psychoanalytische Ausbildung. Des Weiteren wurde er Mitglied der Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft (vgl. Sesink 2002: 19).
Winnicott war stets darum bemüht, seine theoretischen Einsichten in seine praktische Arbeit als Arzt und Psychologe einfließen zu lassen und umgekehrt (vgl. Schäfer 1995: 68 f.). Seine Erkenntnisse wollte er an andere weitergeben, vor allem an diejenigen, welche privat oder beruflich in direktem Kontakt zu Kindern stehen. Sein Werk beschränkt sich fast ausschließlich auf Vorträge und Aufsätze, im Zuge dessen er den unmittelbaren Kontakt zu seinen Hörern und Lesern suchte. Sein breites Publikum reichte von Kinderschwestern, Hebammen, Kindergärtnerinnen über Ärzte, Schüler und natürlich Mütter. Da sich Winnicott primär als praktizierender Arzt, und weniger als Theoretiker verstand, sind seine Schriften nicht als rein theoretisch-systematisches Werk zu verstehen (vgl. Sesink 2002: 21). Man könnte Winnicotts Hinterlassenschaft als eine Art Anhäufung von Reflexionen betrachten; persönliche Gedanken, praktische Beobachtungen und theoretische Einsichten, welche durch die Verbindung analytischer Überlegungen und praktischer Erfahrung entstanden sind. Auch Winnicott selbst distanziert sich von der Annahme eines systematischen Aufbaus seiner Schriften, indem er in Bezug auf seine Vorgehensweise sagt: „Ich nehme dies hier und jenes dort auf, widme mich der klinischen Erfahrung, bilde meine eigenen Theorien und dann, zuallerletzt, schaue ich interessiert nach, um herauszubekommen, wo ich was gestohlen habe.“ (vgl. Sesink 2002: 21).
2.2 Die Theorie der emotionalen Entwicklung
Donald W. Winnicott geht bei seiner psychoanalytischen Theorie davon aus, dass die emotionale Entwicklung am Anfang jeden Lebens beginnt. Im Gegensatz zur klassischen Psychologie sind demnach schon die Ereignisse der ersten Tage und Stunden eines Lebens wichtig für eine fundierte Untersuchung der Persönlichkeitsentwicklung. Besonders das erste Lebensjahr wird hierbei als Grundlage für die spätere psychische Gesundheit eines Menschen gesehen (vgl. Familie und individuelle Entwicklung, 9f.).
Darüber hinaus ist bei diesem Ansatz die Mutter-Kind-Beziehung von zentraler Bedeutung; sie wird von Winnicott häufig als Erklärungsansatz für verschiedene Phänomene in der frühkindlichen Entwicklung herangezogen. Aufgrund der Abhängigkeit des Säuglings kann diese Entwicklung nur im Kontext der Mutter-Kind-Bindung erörtert werden.
Motivation war für Winnicott nicht nur der Wunsch und das persönliche und medizinische Anliegen einer Ursachenfindung für psychische Störungen und Fehlentwicklungen, sondern auch und vor allem die frühe Behandlung und Prävention emotionaler Störungen.
Ausgangspunkt für seine Untersuchungen und Betrachtungen ist nicht wie anzunehmen das psychisch erkrankte, sondern das gesunde Kind. Vom Idealfall dessen emotionaler Entwicklung schließt er auf die Defizite der nicht „normal“ entwickelten Kinder. Bei all seinen Überlegungen nimmt er das Kind als Ausgangspunkt, das „körperlich gesund und psychisch potenziell gesund“ ist (Familie und individuelle Entwicklung, 10). Damit zeigt sich bereits sehr deutlich, dass psychische Krankheiten für ihn auf der Ebene der Sozialisation und Integration zu verorten sind, das Kind an sich potenziell gesund ist und über die Möglichkeiten einer in dem Sinne „normal“ verlaufenden emotionalen Entwicklung verfügt.
Im Fokus seines Interesses steht in erster Linie die Frage nach der Bedeutung dieses Potenzials und danach, was bei der Geburt an Potenzial vorhanden ist und inwieweit sich dieses auf die Entwicklung eines Individuums auswirkt oder auswirken kann (vgl. Familie und individuelle Entwicklung, 10).
Winnicott hat mit seinem Werk einen erheblichen Beitrag zur psychoanalytischen Pädagogik geleistet, indem auf der Basis seiner praktischen Erfahrungen als Kinderarzt und Psychologe nicht zuletzt durch seine „Phänomenologie früher Mutter-Kind-Interaktionen“ einen theoretischen Zugang für eine Pädagogik der frühen Kindheit lieferte (vgl. Schäfer 1995: 69).
Winnicotts Theorien widerlegen die Vorstellung vom passiven Säugling, der sich nur aufgrund seiner Umgebung entwickeln kann, und demzufolge ein Produkt seiner Umwelt darstellt. Im Rahmen der psychoanalytischen Theorie der emotionalen Entwicklung wird der Säugling nicht nur als aktives, sondern als vielmehr eigenaktives Wesen betrachtet, welches einen innerpsychischen Impuls zur Entwicklung besitzt, sich also aus sich selbst heraus entwickeln kann, wenn gewisse Umstände und Voraussetzungen gegeben sind. Diese Annahmen Winnicotts werden größtenteils von einer kognitiv orientierten Säuglingsforschung und wahrnehmungsorientierten Psychologie unterstützt (vgl. Schäfer 1995: 70).
Unter anderem die intensive Beschäftigung mit Freuds Psychoanalyse führt Winnicott dazu, den inneren spontanen Impuls des Kindes als Triebimpuls zu betrachten; danach sind die Motivationen des Kindes auf die Befriedigung des Lustprinzips ausgerichtet.
Mit der Motilität führt Winnicott einen neuen theoretischen Begriff ein, der über die bisherigen Standpunkte der klassischen Psychoanalyse hinausgeht. Die Motilität bildet den Ausgangspunkt für Winnicotts Konzept der Entwicklung von Aggressivität und bedeutet „lebendige Bewegung“, welche den Gegensatz zur reinen Triebbefriedigung bildet (vgl. Schäfer 1995: 71).
3. Der Beginn der Vermittlung
3.1 Ich und Selbst
Das Konzept des Selbst bildet den wichtigsten Ausgangspunkt für die Theorie der emotionalen Entwicklung von D.W. Winnicott. Die terminologische Verwendung von Ich und Selbst sind bei Winnicott etwas irreführend, da die Begriffe eine semantische Trennung und zugleich Verbundenheit implizieren, die wir im umgangssprachlichen Gebrauch meist nicht differenzieren.
Während man im Alltag das „Ich“ und „Selbst“ oft synonym zur Bezeichnung für eine bereits entwickelte Persönlichkeit gebraucht, verortet Winnicott im „Ich“ den Ausgangspunkt jeglicher Entwicklung. Er versteht jedoch das frühe Ich eines Säuglings nicht als eine Art „leere Hülle“, die durch Entwicklungsprozesse einfach gefüllt werden muss, sondern das Selbst muss als Ziel eines sich entwickelnden Ichs mitgedacht werden.
Im Gegensatz zu anderen psychoanalytischen Theorien versteht Winnicott nicht die Triebe als Ausgangspunkt der menschlichen Entwicklung, sondern eine naturgegebene Potenzialität, welche den Menschen als „Ich“ charakterisiert.
Das „ererbte Potenzial“ enthält demnach bereits die vollen Möglichkeiten zu einer individuellen Persönlichkeitsentwicklung und damit zusammenhängend auch eine angeborene „Tendenz zur Integration“. Winnicott selbst nennt diese Potenzialität auch das „primäre zentrale Selbst“, welches eine „Kontinuität des Seins erlebt und auf seine eigene Weise und in seiner eigenen Geschwindigkeit eine personale psychische Realität und ein personales Körperschema erwirbt“ (Davis/ Wallbridge 1995: 52).
Aufgrund des vorhandenen Entwicklungspotenzials kann der Zustand des Säuglings als „Ich“ bezeichnet werden. Dieses Ich impliziert eine Bewegungskraft, die dem Menschen sozusagen in die Wiege gelegt worden ist und wodurch ihm eine Entwicklung erst möglich wird. Das Ich als „zentrales Selbst“ beschreibt Winnicott infolgedessen als Ursprung der Spontanität, Kreativität und des kindlichen Spiels (vgl. Davis/ Wallbridge 1995: 53).
Von einem Selbst kann nach Winnicott die Rede sein, wenn das Kind beziehungsweise der Mensch Teil seiner Umgebung geworden ist, also wenn er sich über die Tatsache bewusst ist, in und mit einer Umwelt zu leben.
Auch wenn Winnicott das Ich an den Anfang eines Lebens setzt, ist eine Abgrenzung von „Ich“ und „Ich bin“ nachzuvollziehen (vgl. Der Anfang ist unsere Heimat, 31f.); Winnicott betrachtet das Ich als die vorhandene Tendenz und Potenzialität zur emotionalen Entwicklung, unabhängig von den Bedingungen und Möglichkeiten dessen Realisierung. Mit der Begrifflichkeit „Ich bin“ ist hingegen schon der Beginn des Prozesses gemeint, den Winnicott als Integration bezeichnet. Um von der Verfasstheit eines „Ich bin“ sprechen zu können, muss eine Einheit zwischen Kind und Umwelt erkennbar sein, und das Kind muss sich auch selbst als eine solche Einheit wahrnehmen. Die Selbstwahrnehmung des Kindes als Teil seiner Umgebung geschieht nach Winnicott lange bevor das Kind dies äußern kann; „es kommt die Zeit, da das Kind, wenn es sprechen könnte, sagen würde: ICH BIN“ (Babys und ihre Mütter: 66).
Diese Entwicklungsstufe ist durch ein kindliches Erleben als „Ich bin“, und nicht etwa durch das Vermögen „Ich bin“ sagen zu können gekennzeichnet, da das Kind die Bedeutung verstehen kann, bevor es die Worte aussprechen kann.
Am Ende des Prozesses, welcher sowohl die psychische als auch die körperliche Entwicklung meint, steht das „Selbst“. Der beschriebene Zustand des „Ich bin“ ist Voraussetzung für die Herausbildung des Selbst, da das Kind durch das Erleben als „Ich bin“ sein Ich mit der Umwelt in Beziehung bringt. Erst durch diese Verknüpfung kann eine Integration im Sinne Winnicotts Theorie der emotionalen Entwicklung erfolgen. Das Selbst tritt jedoch nicht nur mit der es umgebenden Umwelt in Kontakt, sondern es ist in Form einer Wechselbeziehung integriert; „Das Wort ‚Selbst’ wird sinnvoll, wenn das Kind angefangen hat, seinen Intellekt zu benützen, um das anzuschauen, was andere sehen oder fühlen oder hören und was sie begreifen, wenn sie diesem Säuglingskörper begegnen.“ (Reifungsprozesse, 72f.).
Demzufolge kann man das „Ich“ als ererbte Potenzialität bei der Geburt, das „Ich bin“ als ersten (zunächst einseitigen) Kontakt mit der Umwelt und das „Selbst“ als Prozess der Vermittlung von Ich und Umwelt begreifen. Der Kontakt durch und mit der Umwelt ist notwendig für das Kind, um das vorhandene Potenzial überhaupt zu erfahren beziehungsweise erfahrbar zu machen; durch den Zustand des „Ich bin“ kann das im Ich liegende Potenzial zur Realität werden.
Dies geschieht über Objektbeziehungen, welche das Kind eingeht, sobald es die Existenz einer Umwelt außerhalb der Einheit Mutter-Kind wahrnimmt.
Die Wahrnehmung als „Ich bin“ schließt auch eine Negativabgrenzung mit ein; eine Auseinandersetzung mit der Umwelt ermöglicht demzufolge auch die notwendige Erfahrung eines „Ich bin nicht...“, wodurch die Wahrnehmung als „Ich bin...“ unterstützt wird. Das Selbst kann nur in diesen Sinnzusammenhängen existieren, da für ein Wissen über das eigene Sein auch ein Wissen über die Nichtzugehörigkeit dieses Seins erforderlich ist. Die Frage „wer bin ich?“ schließt die Frage „wer bin ich nicht?“ notwendig mit ein, zumindest stehen die Antworten auf beide Fragen in einem engen Zusammenhang.
An dieser Stelle ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass unter dem Selbst nicht ein Zustand verstanden werden kann, der sich auf kurz oder lang einstellt; im Gegensatz zum anfänglichen Ich ist das Selbst nicht einfach da, sondern es muss durch Nutzung des naturgegebenen Potenzials herausgebildet werden. Dieser Prozess der Entwicklung des Selbst wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Auch wenn Winnicott eine angeborene Tendenz zur Integration unterstellt, ist das „Gelingen“ derselbigen der Normalfall eines „gesunden“ Kindes; demnach kann nur bei einem psychisch und emotional „gesunden“ Menschen von der Existenz eines solchen Selbst ausgegangen werden (vgl. Davis/ Wallbridge 1995: 52).
Die Umwelt spielt hierbei eine tragende Rolle, da sie Integration fördern und zulassen, aber eben auch erschweren oder sogar verhindern kann. Das Selbst kann also als Prozess des „Werdens“ beschrieben werden, ein Werden, das gewollt und ermöglicht werden muss.
3.2 Ich-Integration
Das Kind kommt bereits als potenziell integriertes Wesen zur Welt. Zu Beginn des Lebens bildet der Säugling eine Einheit mit der Mutter, eine Verschmolzenheit, die mit dem Eintreten des Realitätsprinzips allmählich partiell aufgelöst wird. Aus der mütterlichen Einheit geht das Kind Stück für Stück in eine andere Einheit über, die der sozialen Umwelt.
Unabhängig vom Eintreten in das gesellschaftliche Umfeld betrachtet Winnicott den Säugling bereits im Alter von einem Jahr als Individuum mit einer integrierten Persönlichkeit. Sind bestimmte Umweltbedingungen gegeben, findet in diesem Zeitraum Integration statt; sie entsteht aus einem „primären unintegrierten Zustand“ (vgl. Familie und individuelle Entwicklung, 12 f.).
Auch wenn Integration aus einer Entwicklung heraus erfolgt und von den gegebenen Umweltbedingungen abhängt, betrachtet Winnicott Integration als den Normalzustand eines gesunden Menschen. Das Kind kommt jedoch nicht als bereits integrierte Person zur Welt, sondern mit einer natürlichen aktiven Tendenz zur Integration (vgl. Sesink 2002: 23). Die Umwelt sieht und empfängt das Kind bereits als Einheit, auch wenn das Kind für sich selbst nicht von Anfang an diese Einheit darstellt; „Der Beobachter kann von Anfang an sehen, dass ein Säugling schon ein menschliches Wesen, eine Einheit ist“ (Familie und individuelle Entwicklung, 12 f.).
Die Integration eines Menschen ist eine Entwicklungsaufgabe, die sich mit der Geburt stellt. Die Bedingungen für die Erfüllung dieser Aufgabe müssen von der gesellschaftlichen Umwelt gegeben werden. Diese Entwicklungsaufgabe stellt die Vermittlung zwischen Selbst und Umwelt dar; das „ererbte Potenzial“ als „Material“ (vgl. Sesink 2002: 25) muss in eine gesellschaftliche „Form“ gebracht werden. Dieser Prozess der Bezugnahme der Potenziale des Kindes auf die Objekte der Umwelt stellt die vermittelnde Integration dar.
Das Ich des Säuglings bildet den Ausgangspunkt und stellt noch keine integrierte Person dar, sondern die Tendenz zur Integration. Das Ich impliziert jedoch schon die Möglichkeiten eines Selbst, das sich unter der Bedingung einer „hinreichend fördernden Umwelt“ entwickeln und entfalten kann. Auf dem Weg zur psychischen Verfassung eines Selbst erreicht das Kind eine Stufe des „Ich bin“, einen „Zustand der Einheit, zu dem persönlichen Fürwort ‚ich’, zu der Ziffer eins; sie ermöglicht ein ‚ich bin’, das dem ‚ich tue’ erst einen Sinn gibt.“ (Der Anfang ist unsere Heimat, 31). Das „ich bin“ bedeutet, dass sich das Kind als existierendes Wesen erkennt; zunächst erkennt es seine Existenz nur in Verbindung mit der Mutter. „Ich bin“ meint folglich zunächst die reale Existenz der Mutter-Kind-Einheit. Diese Wahrnehmung ist die Voraussetzung für das sich entwickelnde Selbst. Das Selbst nimmt sich im Kontext des sozialen Umfeldes wahr und als integrierter Teil der ihn umgebenden Welt. Als Selbst reflektiert das Ich seine Stellung und Bedeutung in Bezug auf seine Umwelt und grenzt sein „Ich bin“ von den Dingen ab, die es nicht ist. Dem Selbst geht ein Integrationsprozess und Entwicklungsprozess voraus, denn „das Wort ‚Selbst’ wird sinnvoll, wenn das Kind angefangen hat, seinen Intellekt zu benützen, um das anzuschauen, was andere sehen oder fühlen oder hören ...“ (Reifungsprozesse, 72f.). Das Selbst betrachtet sich im Gegensatz zum Ich als Teil der Gesellschaft; erst im Zustand des Selbst kann daher von Vermittlung gesprochen werden, da Vermittlung auch bedeutet, die Reaktionen und Handlungen der anderen Menschen wahrzunehmen und als Reaktion der eigenen Reaktionen zu begreifen. Dieser Aspekt wird auch von George Herbert Mead aufgegriffen, der die Verinnerlichung der „Haltungen anderer“ als Merkmal von Identität versteht. Auf diesen Punkt werde ich im zweiten Teil meiner Arbeit ausführlich eingehen.
[...]
-

-
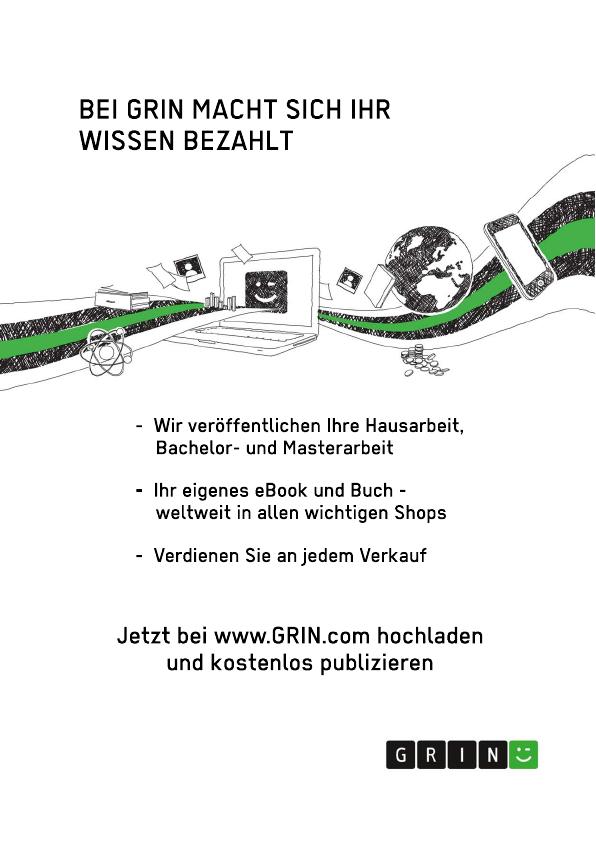
-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.

