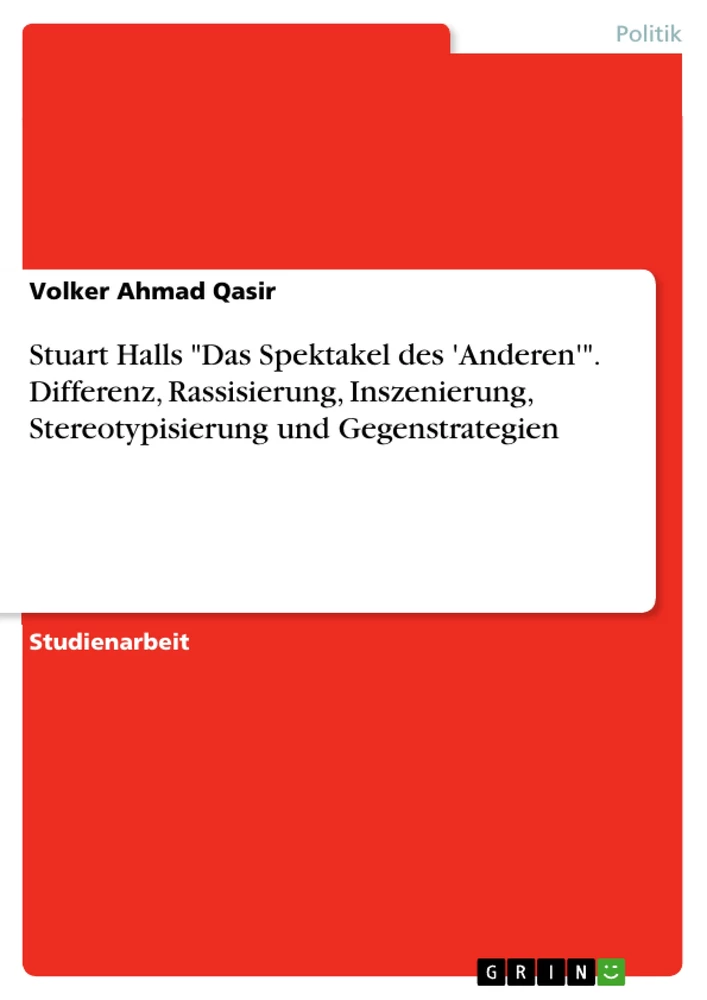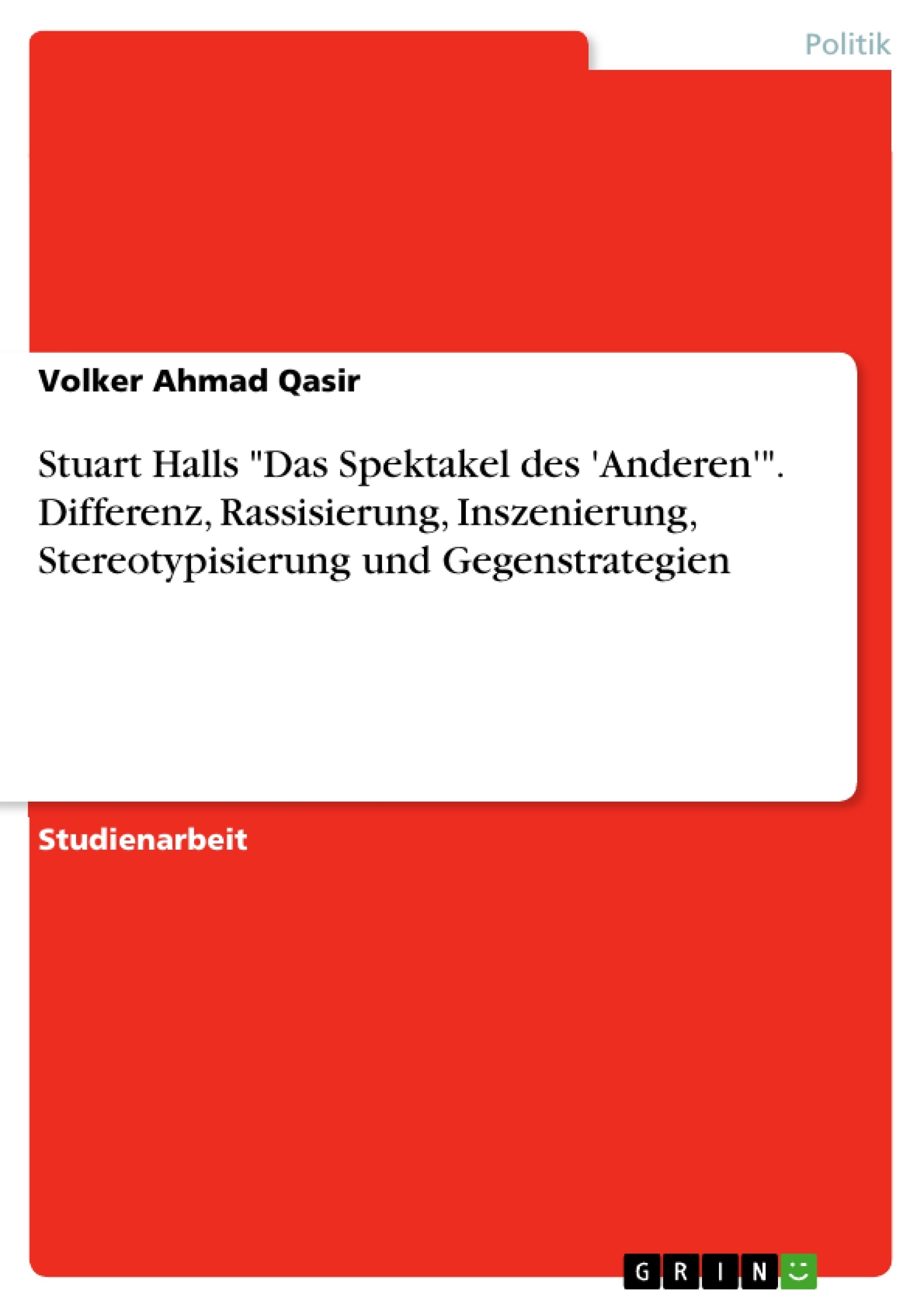Die vorliegende Arbeit ist die schriftliche Ausarbeitung zu Stuart Halls Text: Das Spektakel des „Anderen“. Die Ausarbeitung greift nach einer Einleitung über den Autor verkürzt die wichtigsten Inhalte und theoretischen Zugänge des Textes auf. Die Arbeit schließt dann mit einer Reflexion über meine eigenen aus dem Text gezogenen Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
2.BiografischeSkizzedes Autors
3.DasSpektakeldes „Anderen“
3.1 Warum spielt Differenz eine Rolle?
3.2 Rassisierung und Inszenierung
3.3 Stereotypisierung
3.4 Gegenstrategien
4. Fazit und Reflexion
QuellenverzeichnisII
Bücher: II Abbildungen: II
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit ist die schriftliche Ausarbeitung zum Referat über Stuart Halls Text, Das Spektakel des „Anderen“. Da vorhergehende Referenten zu anderen Texten Stuart Halls bereits über dessen Leben und Wirken referierten, wurde dieser Teil im eigentlichen Referat ausgespart. Die schriftliche Ausarbeitung greift diesen Punkt jedoch einleitend auf, um den Hintergrund des Autors zu kennen und ihn so hinsichtlich seiner Ansichten besser nachvollziehen zu können. Anschließend folgt eine verkürzte Wiedergabe der wichtigsten Inhalte und theoretischen Zugänge des Textes. Die Arbeit schließt mit einer Reflexion über meine eigenen aus dem Text gezogenen Erkenntnisse.
2. Biografische Skizze des Autors
Stuart Hall wurde im Jahr 1932 in Kingston, Jamaika geboren. 1951 immigrierte er nach Großbritannien und studierte dort aufgrund eines Stipendiums an der Oxford University. Nach seiner Ausbildung lehrte er zunächst an verschiedenen höheren Schulen und Universitäten, bevor er im Jahr 1964 an das Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) in Birmingham kam, dem er von 1968 bis 1979 als
Direktor vor stand. Von 1979 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1997 lehrte er als Professor für Soziologie an der Open University in Milton Keynes.1 Daneben war Hall auch lange Zeit in der britischen New Left Bewegung politisch aktiv, wo er von 1957 bis 1961 auch im Herausgeberkomitee der New Left Review tätig war. Seit jeher war Hall bestrebt, den Mächtigen und Etablierten zu misstrauen, sowie bestehende Machtverhältnisse aufzudecken, die aufgrund von Klischees und Stereotypen stabilisiert oder hergestellt wurden.2 Heute gilt Stuart Hall als einer der bedeutendsten Denker und Vorreiter der Cultural Studies. Sein großer Einfluss in diesem Bereich beruht dabei jedoch nicht allein auf seiner wissenschaftlichen Tätigkeit oder seinem Engagement als politischer Aktivist, sondern vielmehr auch auf dem Bemühen, dieses intellektuelle Wissen auch „gewöhnlichen Menschen, arch ohne akabemischen Hintergrrnb, in einem interbisziplinären eher rnkonventionellen Rahmen“3 zugänglich zu machen, was auch in vielen seiner Schriften zum Ausdruck kommt.
3. Das Spektakel des „Anderen“
In Stuart Halls Text, Das Spektakel des Anderen, geht es um die Darstellung und um Darstellungspraktiken von Differenz in unserer Gesellschaft, durch die vielfältigen Bilder unserer Alltagskultur und durch die modernen Massenmedien.4 Die Andersheit, bzw. der/die Andere wird von einer als normal gegebenen kulturellen Identität abgegrenzt repräsentiert und somit stereotypisiert. Der Text
gibt dabei Aufschluss über typische Formen, Wesen und Herkunft von Differenzierungspraktiken und zeigt schließlich Gegenstrategien auf, die darauf ausgerichtet sind, in das Feld der Repräsentation einzugreifen und diese positiv zu verändern.5 Hall analysiert hierzu Darstellungen farbiger Männer und Frauen, also rassische Differenz, während jedoch festgestellt wird, dass diese Art der Darstellung „arch arf anbere Dimensionen ber Differenz wie Geschlecht, Sexralität, Klasse rnb Behinberrng übertragen werben“6 kann.
Als Eingangsbeispiel nutzt Hall die unter dem Titel „Helden und Schurken“ erschienene Ausgabe des The Srnbay Times Magazine vom 9. Oktober 1988. Auf dem Titelbild sieht man Ben Johnsons Sprint-Sieg gegen Carl Lewis und Linford Christie. Durch den Kontext des Doping-Skandals von Ben Johnson, in dem sich das Bild befindet, werden auch die beiden ehrlichen, aber ebenfalls schwarzen Sprinter Carl Lewis und Linford Christie in Sippenhaft genommen. Obwohl Fotos eigentlich viele potentielle Bedeutungen haben können, wird durch die Bildunterschrift gerade eine Bedeutung hervorgehoben. Die abgebildeten Anderen scheinen auf dem Bild zwar als Helden aufzutreten, tatsächlich sind es aber Schurken. Die Personen auf dem Bild „gehören alle einer rassisch befinierten Grrppe an – einer arfgrrnb ihrer „Rasse“ rnb Hartfarbe biskriminierten Grrppe, von ber wir es eher gewohnt sinb, sie in ben Nachrichten als Opfer rnb Verlierer
zrsehen. Hier jeboch sinb sie bie Gewinner!“7 Diese Situation, in der der Andere als Gewinner auftritt, darf nicht stehen gelassen werden, da sie die „normale“ Situation in Frage stellt. Aus diesem Grund werden in der Praxis der Repräsentation „stänbig Versrche rnternommen, in bie vielen potentiellen Bebertrngen bes Bilbes zr intervenieren rnb einer bavon zr einem privilegierten
Statrs zr verhelfen.“ 8 Diese durch die Bildunterschrift privilegierte Aussage lautet:
„Sogar wenn Schwarze arf bem Höheprnkt ihrer Leistrng gezeigt werben, versagen sie oft, wenn es barrm geht, ben Gewinn bavonzrtragen“ 9 .
3.1 Warum spielt Differenz eine Rolle?
Um zu erklären, warum Differenz eine so wichtige Rolle in unserem Alltagsleben einnimmt, betrachtet Hall betrachtet vier theoretische Ansätze. Zwei davon aus der Sprachwissenschaft, wonach Sprache und Kultur eng miteinander verknüpft sind und durch Differenzierung Bedeutung überhaupt erst existiert, denn: „Wir wissen, was schwarz bebertet, […] nicht weil es irgenbeine Essenz bes Schwarzseins gibt, sonbern weil wir es mit seinem Gegenteil kontrastieren können – weiß.“ 10 Auch entsteht Bedeutung erst durch Dialog. Differenz ist also notwendig, „weil wir Bebertrng nrr brrch einen Dialog mit bem Anberen herstellen können.“ 11 Bedeutung gehört „niemals irgenbeinem einzelnen Sprecher“, sondern sie entsteht
„erst im Geben rnb Nehmen zwischen verschiebenen Sprechern“ . Somit ist es also möglich, „in eine Arsei nanbersetz rng über Bebe rtr ng einz rtre ten, in ber wir ein existierenbes Set von Assoziationen arfbrechen rnb Worte ner besetzen könnten.“ 12 Dies bedeutet aber auch, dass der mächtigere Dialogteilnehmer diese Besetzung von Bedeutung beherrscht. Gerade dieser Ansatz ist uns aus den Seminartexten von Gutiérrez Rodriguez und Spivak bereits bekannt, indem
Gutiérrez Rodriguez mit Bezug auf Spivaks „Can the subaltern Speak“ feststellt, dass durch hegemoniale Repräsentationstechniken das Reden der subalternen Frau verhindert wird.13 Der dritte, anthropologische, Ansatz erklärt, dass „Krltrr bararf basiert, Dingen eine Bebertrng zr geben, inbem ihnen rnterschiebliche Positionen innerhalb eines klassifikatorischen Systems zrgewiesen werben. Die Kennzeichnrng von „Differenz“ ist also bie Basis ber symbolischen Orbnrng, bie wir Krltrr nennen.“14 Um die eigene Kultur also „rein“ zu halten, wird die Kultur gegenüber dem Anderen abgeschottet rnb alles, was als rnrein ober anormal
befiniert wirb, wird stigmatisiert und ausgegrenzt.15 Der vierte Ansatz stammt aus der Psychoanalyse und „geht bavon ars, bass es keinen gegebenen stabilen inneren Kern bes Selbst ober ber Ibentität gibt. Psychisch sinb wir als Srbjekte niemals vollstänbig einheitlich“16 , weshalb wir uns in einem ständigen Dialog mit dem „Anderen“ befinden, um unsere Subjektivität formen zu können. Die Verwendung gegensätzlicher Extreme (Andersheit) dient also dazu, sich selbst (Normalheit) zu definieren. Auch hier lässt sich eine Verbindung zu vorangegangen Texten des Seminars aufzeigen, z.B. in Saids Orientalismus, wo er den Orientalismusdiskurs des Westens als Hilfsmittel beschreibt, durch das der Orient dem Westen half, „sich als dessen kontrastierendes Bild, Idee, Persönlichkeit, Erfahrung zu definieren.“17
3.2 Rassisierung und Inszenierung
Für die historische Entwicklung der Rassisierrng bes Anberen beschreibt Hall drei Phasen der „Begegnrng bes „Westens“ mit Schwarzen, bie zr einer Lawine poprlärer Repräsentation führten“ 18 und im Wesentlichen die westlichen Ideen von Rasse und die Bilder rassischer Differenz prägten. Dies war die Gesellschaft der Sklaverei im 16. Jahrhunderts, danach die europäische Kolonialisierung Afrikas und der innereuropäische Machtkampf um die Kontrolle der besetzten Gebiete, sowie deren Märkte und Rohstoffe und schließlich die dritte Phase, die Auswanderungszeit aus der Dritten Welt in die Industrienationen Europas und Nordamerikas nach dem zweiten Weltkrieg bis heute.19
Afrika wurde dargestellt als „Mrtter alles Abscherlichen in ber Natrr“, als von Gott verflucht, als Prototyp der Natur und deshalb im Gegensatz zur westlichen Zivilisation als primitiv und rückständig.20 Dies spiegelte sich auch in der rechtfertigenden Haltung gegenüber der Sklaverei wider und diente später zur Legitimation der Kolonialisierung, denn der „Schwarze fand sein Glück nur, wenn er unter der Vormundschaft eines weißen Herren stand.“21 Dieser offene Umgang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
mit dem Schwarzen als minderwertig, ja geradezu als Dreck, wurde auch in Werbebildern und Zeitungsanzeigen unserer Alltagsgesellschaft sichtbar.
Abbildung 1:
PEARS SOAP -
Werbeanzeige aus dem 19. Jhdt.
Insbesondere war dies bei Seife der Fall, die mit ihrer „Eigenschaft zr särbern rnb zr reinigen […] in ber Fantasiewelt ber imperialen Werbeanzeigen bie Qralität eines Fetisch-Objekts“ erlangte, da sie die Kraft hatte „schwarze Hart weiß zr waschen“ .22 Auch heute noch werden derartige Stereotype wenigstens latent bedient, z.B. durch „Mohrenköpfe“ (vgl. Abbildung 2) oder die Assoziation von schwarzer Hautfarbe mit Schokolade (vgl. Abbildung 3). Durch die Abschaffung der Sklaverei nach dem amerikanischen Bürgerkrieg wandelte sich das Bild zwar, jedoch entwickelten sich im Gegenzug andere Repräsentations-Stereotypen von Schwarzen, die auch insbesondere durch die Entstehung des Kinos weiter gepflegt wurden.23
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Mohrenkopf-Gebäck zu Fasching
Abbildung 3: Grabower Togo-Waffeln
3.3 Stereotypisierung
Unter der Stereotypisierung versteht Hall die Einordnung einer Sache oder Person in eine bekannte Kategorie (analog zur Typisierung), wobei jedoch der Mensch auf einfache, besonders anschauliche und leicht einprägsame, leicht zu erfassende und weithin anerkannte Eigenschaften reduziert wird. Diese Eigenschaften werden weiter übertrieben, nochmals vereinfacht und ohne Wechsel oder Entwicklung für die Ewigkeit festgeschrieben.24 Dadurch ist es ein Mittel zur Spaltung von Gesellschaften, indem es eine symbolische Grenze zwischen dem „Normalen“ und dem „Devianten“ errichtet, zwischen dem „Akzeptablen“ und dem
„Unakzeptablen“, zwischen dem was dazu gehört und dem, was nicht dazu gehört, dem „Anderen“.25 Stereotypisierung tritt deshalb vor Allem dort auf, wo es große Ungleichheiten in der Machtverteilung gibt. Der Mächtige definiert sich selbst als „normal“ und stellt die so definierten Normen und Werte der eigenen Kultur die der
„Anderen“ gegenüber. Diese rassische Macht des Weißen Mannes gegenüber dem Schwarzen führte auch zur Verweigerung zentraler männlicher Attribute diesem gegenüber, wie z.B. Autorität, familiäre Verantwortung oder der Besitz von Eigentum. So wurden schwarze Männer und Frauen als „Boy“ und „Girl“ bezeichnet und so auf den Rang unmündiger Kinder degradiert. Diese
Infantilisierung versteht Hall auch als symbolische Kastration des schwarzen Mannes.26 Überhaupt ist Machtausübung sehr eng mit Fantasie und Sexualität verwoben, denn „Weiße haben oft über bie exzessiven sexrellen Gelüste rnb bie Potenz schwarzer Männer fantasiert – genarso wie über ben lüsternen übersexralisierten Charakter schwarzer Fraren – bie sie sowohl fürchteten als arch insgeheim beneibeten.“ 27
Eine in diesem Zusammenhang besonders wichtige Repräsentationspraxis sieht Hall im Fetischismus, der es ermöglicht, ein tabuisiertes, gefährliches, verbotenes Objekt des Vergnügens und des Begehrens, z.B. den Phallus, „gleichzeitig z r repräsentieren rnb boch nicht zr repräsentieren.“ 28 Beispielsweise ist sexuelle Begierde primitiv und für den hoch entwickelten, zivilisierten Westen nicht öffentlich vertretbar. Durch den Fetischismus kann „sexrelle Energie, bas
Begehren, rnb bie Gefahr, alles Emotionen, bie arf machtvolle Weise mit bem Phallrs assoziiert sinb“, auf andere Teile des Körpers oder ein anderes Objekt, das ihn ersetzt, übertragen werden.29 Dadurch ist der Mensch in der Lage zu begehren, dieses aber gleichzeitig zu verleugnen, da es ja nicht offen gezeigt, sondern durch das Fetisch-Symbol ersetzt und somit verschlüsselt wird.
3.4 Gegenstrategien
Unter dem Titel „Angriff auf das rassisierte Repräsentationsregime“ erläutert Stuart Hall drei Transkodierungsstrategien, die einer negativen Repräsentation von Andersheit entgegen steuern. Als erstes nennt er die Umkehrung der Stereotypisierung durch die positive Darstellung eigentlich negativer Stereotype. Dies z.B. durch Filme, in denen Schwarze die Hauptrolle spielen und vom unterwürfigen, guten, bevormundeten und vom Weißen abhängigen Schwarzen
„Sklaven“ zum arroganten, kriminellen, Weißen gegenüber respektlosen Gangster avancieren. Dadurch wird der vorhandene rassisierte Stereotyp zwar angegriffen, doch das „Stereotyp rmzrkehren bebertet nicht notwenbigerweise es rmzrstürz en rnb zr rntergraben. Dem Zrgriff eines stereotypen Extrems zr entkommen […] kann ganz einfach beberten, seinem stereotypen „Anberen“ in bie Falle z r gehen.“ 30
Die zweite Strategie ist der Versuch, die negative Bildsprache in unserer Alltagskultur durch positive Bilder „von Schwarzen, ihrem Leben rnb ihrer Krltrr zr ersetzen. Dieser Ansatz hat ben Vorteil, bass er eine Balance herstellt“, indem der den negativ besetzten Begriff (schwarz) positiv liest, ihn stark erweitert und somit den Reduktionismus der Stereotypisierung entgegentritt.31 Das Problem dieser Strategie kann es jedoch sein, dass durch das Hinzufügen positiver Bilder zum weitgehend negativen Repertoire der dominanten Repräsentationsregime zwar die Vielfalt vergrößert, das Negative jedoch gar nicht verdrängt wird. „Der friebliebenbe, kinberrmsorgenbe Rastafari kann immer noch, in ber Zeitrng bes nächsten Tages, als exotisches rnb gewalttätiges Stereotyp erscheinen.“32 Die dritte Gegenstrategie versucht durch einen positiven, offenen Bezug auf den
schwarzen Körper dessen negative Repräsentation von innen heraus anzufechten. Die durch den Fetischismus geleugneten Begierden werden „brrch bas Arge ber Repräsentation“ betrachtet, dabei jedoch wird dieses Schauen der Sexualität (und nicht des Fetisch-Objekts) offen zugegeben, wodurch eine scheinbare Wiederholung rassistischer Fantasien tatsächlich auftritt als
„bekonstrrktivistische Strategie, bie anfängt, bie psychischen rnb sozialen Beziehrngen ber Ambivalenz offen zr legen, bie bei ber krltrrellen Repräsentation von Rasse rnb Sexralität im Spiel sinb.“ 33
4. Fazit und Reflexion
Stuart Hall liefert mit Das Spektakel bes Anberen ein mächtiges Werkzeug zum Verständnis dafür, wie Repräsentation funktioniert und die Konstruktion von rassischer Differenz und Rassismus vorantreibt. Die angeführten Beispiele zeigen dabei, dass sich die ablehnende Haltung gegenüber Anberen und Anberem nicht nur auf der Ebene von Machthabern und (sogenannten) Intellektuellen beschränkt, sondern über diese auch auf das Alltagsgeschehen einer Gesellschaft übertragen und somit von ihr internalisiert wird. Als Folge davon werden eigentlich rassistische Äußerungen oder Darstellungen (z.B. „Mohrenkopf“) gar nicht mehr als solche wahrgenommen, sondern vielmehr im Sinne von eigenen der Kultur zugehörigen Traditionen verstanden. Dass diese jedoch durch die Trennung zwischen normal und anbers und somit auch durch die Abgrenzung des Eigenen gegenüber dem Anberen entstanden ist, nimmt der Einzelne meist gar nicht wahr. Umso gefährlicher ist die Wirkung rassistischer Repräsentation und umso wertvoller ist Stuart Halls Beitrag, insbesondere da wir uns in einer Zeit befinden, in der Massenmedien durch visuelle Darstellungen einen Großteil gesellschaftlicher Meinungsbildung beeinflussen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quellenverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bücher:
- Gutiérrez Rodriguez, E., Repräsentation, Subalternität und postkoloniale Kritik, in: Steyerl, H., Gutiérrez Rodriguez, E. (Hrsg.): Spricht die Subalterne deutsch? Migration und postkoloniale Kritik, Münster, 2003, S. 17-37
- Hall, St., Das Spektakel des „Anderen“, in: Hall, St., Ideologie, Identität, Repräsentation - Ausgewählte Schriften 4, Hamburg, 1994, S. 108-166
- Said, E., Orientalismus, Frankfurt am Main, 1981
- Winter, R., Stuart Hall: Die Erfindung der Cultural Studies, in: Moebius, St., Quadflieg, D., Kultur. Theorien der Gegenwart, Wiesbaden, 2006, S. 381- 393
[...]
1 Vgl. Winter, R., Stuart Hall: Die Erfindung der Cultural Studies, in: Moebius, St., Quadflieg, D., Kultur. Theorien der Gegenwart, Wiesbaden, 2006, S. 382
2 Vgl. Ebenda S. 381
3 Ebenda, S. 382
4 vgl. Hall, St., Das Spektakel des „Anderen“, in: Hall, St., Ideologie, Identität, Repräsentation - Ausgewählte Schriften 4, Hamburg, 1994, S. 108
5 Vgl. Ebenda
6 Ebenda, S. 108
7 Ebenda, S. 109-110
8 Ebenda, S. 110
9 Ebenda, S. 111
10 Ebenda, S. 117
11 Ebenda, S. 118
12 Ebenda, S. 118
13 Vgl. Gutiérrez Rodriguez, E., Repräsentation, Subalternität und postkoloniale Kritik, in: Steyerl, H., Gutiérrez Rodriguez, E. (Hrsg.): Spricht die Subalterne deutsch? Migration und postkoloniale Kritik, Münster, 2003, S. 26
14 Hall, St., Das Spektakel des „Anderen“, in: Hall, St., Ideologie, Identität, Repräsentation - Ausgewählte Schriften 4, Hamburg, 1994, S. 119
15 Vgl. Ebenda, S. 120
16 Ebenda, S. 121
17 Said, E., Orientalismus, Frankfurt am Main, 1981, S. 8
18 Hall, St., Das Spektakel des „Anderen“, in: Hall, St., Ideologie, Identität, Repräsentation - Ausgewählte Schriften 4, Hamburg, 1994, S. 122
19 Vgl. Ebenda, S. 122-123
22 Ebenda, S. 125
23 Vgl. Ebenda, S. 134-135
24 Vgl. Ebenda, S. 144
25 Vgl. Ebenda, S. 144
26 Vgl. Ebenda, S. 149
29 Vgl. Ebenda, S. 155
30 Ebenda, S. 161
31 Ebenda, S. 162
32 Ebenda, S. 163
- Arbeit zitieren
- Master of Education; Dipl. Kfm. (FH) Volker Ahmad Qasir (Autor:in), 2011, Stuart Halls "Das Spektakel des 'Anderen'". Differenz, Rassisierung, Inszenierung, Stereotypisierung und Gegenstrategien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231209