Die frühe Bildung von Kindern ist in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus geraten, wenn es um die Frage geht, wie wir mehr Chancengerechtigkeit und soziale Durchlässigkeit in unserer Gesellschaft erreichen können. Doch dies ist nur ein wichtiger Aspekt, der nötig ist, um Kindern eine bessere Lebensperspektive zu ermöglichen. Ein weiterer ist die außerordentliche Bedeutung des familiären Systems, das in Deutschland den Bildungsweg eines Kindes maßgeblich bestimmt. In der fachwissenschaftlichen Diskussion wird daher immer stärker betont, dass ein wirkungsvolles Konzept zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit unserer Kinder beide Ansätze berücksichtigen und sich sowohl die bestmögliche Förderung der Kinder als auch die ganzheitliche Unterstützung von Familien und die Verbesserung des familiären Zusammenlebens zum Ziel machen muss.
Auch in der Praxis ist diese Erkenntnis bereits angekommen, wie man an der Hochkonjunktur der Thematik Familienzentren erkennen kann. So gibt es bereits seit einigen Jahren in fast allen Bundesländern auf verschiedenen qualitativen und quantitativen Ebenen Bestrebungen, Zentren für Familien aufzubauen, auch wenn diese teilweise sehr unterschiedlich benannt werden. Die Ausgestaltung dieser Zentren ist sehr heterogen und die Entwicklung der Angebote richtet sich nur selten nach konkreten Standards, welche die Qualität und Wirksamkeit der Arbeit sicherstellen. So gibt es zwar in einzelnen Städten und Bundesländern Förderprojekte, die teilweise bestimmte Qualitätsstandards bereithalten, Doch vielerorts geschieht diese Entwicklung noch ungesteuert und konzeptlos, da einzelne Einrichtungen spüren, dass sie sich an die veränderten Bedarfe der Familien anpassen müssen, ohne das nötige Know-how und die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu haben. Die Folgen können von der Überlastung der Teams bis hin zum Scheitern der einzelnen Projekte reichen.
Die vorliegende Arbeit möchte daher einen Weg aufzeigen, wie sich Einrichtungen systematisch zu Familienzentren (weiter-)entwickeln können und ihnen konkrete Qualitätskriterien und Handlungsstrategien an die Hand geben, welche die Qualität und Professionalität der Arbeit sicherstellen und gleichzeitig eine flexible Ausrichtung an den jeweils unterschiedlichen Bedarfen und Strukturen der Sozialräume ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Gesellschaftlicher Wandel und Familie heute
2.1. Begriffsbestimmung: Familie
2.2. Herausforderungen und Lebenslagen von Familien
2.3. Notwendigkeit von frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sowie der Unterstützung von Familien
3. Familienzentren – theoretische Grundlagen
3.1. Begriffsbestimmung: Familienzentrum
3.2. Begründungszusammenhänge für Familienzentren
3.3. Was unterscheidet ein Familienzentrum von einer Kita?
3.3.1. Aufgabenfelder und Angebotsschwerpunkte von Familienzentren
3.3.2. Welche Ziele haben Familienzentren?
3.3.3. Was sind Zielgruppen (Gender, Race, Class, Disability)
3.4. Organisationsmodelle und Angebotsprofile von Familienzentren
3.5. Kooperation und Netzwerkarbeit: Das Familienzentrum als Knotenpunkt eines sozialräumlichen Gesamtnetzwerks für Familien
3.5.1. Die Notwendigkeit einer Gesamtstrategie
3.5.2. Zentrale Prinzipien und Elemente einer kommunalen Gesamtstrategie bzw. eines Gesamtkonzepts
3.5.3. Netzwerkarbeit im Rahmen eines Gesamtkonzeptes
3.5.4. Koordination und Gesamtverantwortung
3.5.5. Familienzentren als Netzwerkzentren
3.6. Qualitätsentwicklung und Evaluation
3.7. Rechtliche Grundlagen
3.8. Familienzentren im Spiegel der Forschung
3.8.1. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung der Familienzentren in Nordrhein-Westfalen
3.8.2. Familienzentren in Niedersachsen – Befragung zur Bestandsaufnahme
3.8.3. Evaluation zu den Wirkfaktoren der Familienzentren mit Early Excellence Ansatz in Hannover
4. Zwischenfazit
4.1. Konsequenzen für die Planung von Familienzentren
5. Qualitätskriterien und Maßnahmen/ Angebote von Familienzentren
5.1. Kriterienkataloge verschiedener Städte und Bundesländer
5.2. Bewertung der Kriterienkataloge
5.3. Berücksichtigung der Besonderheiten unterschiedlicher Zielgruppen und Sozialräume bei der Entwicklung maßgeschneiderter Qualitätskriterien
5.3.1. Der ländliche Raum
5.3.2. Zielgruppe: Gut situierte, bildungsnahe Familien
5.3.3. Zielgruppe: Sozial benachteiligte und bildungsferne Familien
5.3.4. Zielgruppe: Familien mit Migrationshintergrund
5.3.5. Zielgruppe: Familien mit Kindern mit Behinderung und/ oder sonderpädagogischem Förderbedarf
5.4. Mögliche Angebote eines Familienzentrums
5.5. Vorschlag für einen allgemeinen Qualitätskriterienkatalog für Familienzentren
5.5.1. Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit
5.5.2. Qualitätskriterien für den Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Kerngeschäft der Kindertageseinrichtung
5.5.3. Qualitätskriterien für Angebote und Maßnahmen von Familienzentren, die über den Kernbereich der Kindertagesstätten hinaus gehen
5.6. Maßgeschneiderte Qualitätskriterien entwickeln und anwenden
6. Das Verfahren zur Entwicklung von sozialräumlichen Gesamtkonzepten der Jugendhilfe im Allgemeinen und für Familienzentren im Besonderen
6.1. Was ist ein Konzept/ eine Konzeption?
6.2. Gliederungselemente eines Konzepts bzw. einer Konzeption
6.2.1. Bestandteile einer Bedarfsanalyse für Familienzentren in Sozial- räumen unterschiedlicher Größe
6.2.2. Methodische Beispiele: Partizipative Beratungsformate für Bedarfs- analysen und den Entwicklungsprozess von Gesamtkonzepten
7. Familienzentrum in Cuxhaven Ritzebüttel – Entwicklung eines Gesamtkonzepts
7.1. Der Beratungsprozess
7.1.1. Ausgangslage
7.1.2. Vorgehen
7.2. Die Konzeption
7.2.1. Anwendung der Qualitätskriterien auf Cuxhaven
8. Zusammenfassung und Ausblick
9. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die frühe Bildung von Kindern ist in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus geraten, wenn es um die Frage geht, wie wir mehr Chancengerechtigkeit und soziale Durchlässigkeit in unserer Gesellschaft erreichen können. Die hohen Erwartungen und Hoffnungen, die in diesen Bereich gesetzt werden, gründen auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass die ersten sechs Lebensjahre entscheidend sind für die weitere Entwicklung eines Kindes, und dass durch eine fehlende Förderung in dieser Zeit wichtige Potenziale verloren gehen. Dies hat nicht nur Konsequenzen für den weiteren Lebensweg des einzelnen Kindes, sondern führt kumulativ zu erheblichen volkswirtschaftlichen Einbußen und Problemen, wie Studien zum volkswirtschaftlichen Nutzen frühkindlicher Bildung demonstrieren.
Die frühe Förderung von Kindern ist jedoch nur ein wichtiger Aspekt, der nötig ist, um ihnen eine bessere Lebensperspektive zu ermöglichen. Ein weiterer ist die außerordentliche Bedeutung des familiären Systems, das in Deutschland den Bildungsweg eines Kindes maßgeblich bestimmt. In der fachwissenschaftlichen Diskussion wird daher immer stärker betont, dass ein wirkungsvolles Konzept zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit unserer Kinder beide Ansätze berücksichtigen und sich sowohl die bestmögliche Förderung der Kinder als auch die ganzheitliche Unterstützung von Familien und die Verbesserung des familiären Zusammenlebens zum Ziel machen muss.
Auch in der Praxis ist diese Erkenntnis bereits angekommen, wie man an der Hochkonjunktur der Thematik Familienzentren erkennen kann. So gibt es bereits seit einigen Jahren in fast allen Bundesländern auf verschiedenen qualitativen und quantitativen Ebenen Bestrebungen, Zentren für Familien aufzubauen, auch wenn diese teilweise sehr unterschiedlich benannt werden. Die Ausgestaltung dieser Zentren ist sehr heterogen und die Entwicklung der Angebote richtet sich nur selten nach konkreten Standards, welche die Qualität und Wirksamkeit der Arbeit sicherstellen. So gibt es zwar in einzelnen Städten und Bundesländern Förderprojekte, die teilweise bestimmte Qualitätsstandards bereithalten, Doch vielerorts geschieht diese Entwicklung noch ungesteuert und konzeptlos, da einzelne Einrichtungen spüren, dass sie sich an die veränderten Bedarfe der Familien anpassen müssen, ohne das nötige Know-how und die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu haben. Die Folgen können von der Überlastung der Teams bis hin zum Scheitern der einzelnen Projekte reichen.
Die vorliegende Arbeit möchte daher einen Weg aufzeigen, wie sich Einrichtungen systematisch zu Familienzentren (weiter-)entwickeln können und ihnen konkrete Qualitätskriterien und Handlungsstrategien an die Hand geben, welche die Qualität und Professionalität der Arbeit sicherstellen und gleichzeitig eine flexible Ausrichtung an den jeweils unterschiedlichen Bedarfen und Strukturen der Sozialräume ermöglichen.
In diesem Sinne sollen in Kapitel 2. und 3. zunächst die Lebenslagen von Familien vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels sowie die theoretischen Grundlagen von Familienzentren dargelegt werden. Hierzu gehören ein Vorschlag zur Begriffsbestimmung von Familienzentren, die Beschreibung möglicher Organisationsmodelle und Angebotsprofile, Grundlagen zur Netzwerkarbeit und zu Gesamtstrategien sowie zur Qualitätsentwicklung. Darüber hinaus soll ein Blick auf die rechtlichen Grundlagen und den derzeitigen Stand der Forschung zur Thematik Familienzentren geworfen werden.
Im Anschluss daran werden in Kapitel 5. die vorhandenen Qualitätskriterienkataloge der verschiedenen Städte und Bundesländer analysiert und zu einem eigenen Vorschlag für einen allgemeinen Qualitätskriterienkatalog für Familienzentren weiterentwickelt. In diesem Abschnitt sollen insbesondere auch die Besonderheiten der unterschiedlichen Zielgruppen und Sozialräume in ihrer Bedeutung für die Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots hervorgehoben werden.
In den Kapiteln 6. und 7. wird es dann konkret um die Entwicklung einer Konzeption gehen, die auf den zuvor entwickelten Qualitätskriterien aufbaut und auf die jeweils besonderen Bedarfe und Voraussetzungen des Sozialraums eingeht. Hierfür soll zunächst theoretisch erläutert werden, was unter einem Konzept bzw. einer Konzeption zu verstehen ist, wie dieses im Einzelnen aufgebaut sein sollte und wie eine systematische Bedarfsanalyse gestaltet und durchgeführt werden kann. In einem weiteren Schritt wird das zuvor beschriebene Vorgehen gemeinsam mit den Qualitätskriterien auf ein Praxisprojekt angewendet und es soll eine im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Konzeption für ein Familienzentrum in Cuxhaven Ritzebüttel vorgestellt werden. Dieses Praxisprojekt wurde von der Leuphana Universität Lüneburg wissenschaftlich begleitet und begann Anfang des Jahres 2012 mit einer umfassenden, partizipativ angelegten Bedarfsanalyse, auf Basis derer die hier vorgestellte Konzeption entwickelt und ein Projektantrag beim Landkreis Cuxhaven gestellt werden konnte.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, einen praxisrelevanten Vorschlag für ein systematisches und qualitätsgeleitetes Vorgehen zur Entwicklung von Familienzentren zu entwerfen. Hierfür soll ein breiter Bogen gespannt werden von den theoretischen Grundlagen bis hin zur konkreten Entwicklung einer sozialraumbezogenen Konzeption.
2. Gesellschaftlicher Wandel und Familie heute
Unsere heutige Gesellschaft befindet sich in einem ständigen Wandlungsprozess, der insbesondere durch Trends der Individualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen und -formen geprägt ist. „Ausdehnung von Privatheit, Cocooning (Einpuppen) in den Privathaushalt als urbane Rückzugsnischen, Individualisierung von Lebensrisiken, zunehmende Desorientierung bezüglich eigener Lebensläufe, Erweiterung weiblicher Handlungsräume, Wandel von Erwerbsbiographien, gesteigerte Zwänge der Arbeitswelt [...]“ (Zander & Dietz 2003: 7), demographische Entwicklungen, Traditionsabbrüche, Werte-pluralismus, Globalisierung, Schnelllebigkeit, wachsende Mobilitäts- und Flexibilitäts-ansprüche, Unsicherheiten in der Lebensführung sowie Ausdünnung natürlicher Netzwerke sind nur einige Beispiele heutiger gesellschaftlicher Entwicklungen.
Noch nie hat sich unsere Gesellschaft so rasant verändert wie sie es heute tut. Insgesamt haben die Veränderungsprozesse große Auswirkungen auf Familien und deren Lebenslagen und Bedarfe. Aufgrund der Geschwindigkeit des Wandels fehlen Eltern häufig Erfahrungen, auf die sie zurückgreifen können, sodass sie teilweise keinen eindeutigen Orientierungs- und Informationsvorsprung mehr gegenüber ihren Kindern haben; neue Lebensführungs-kompetenzen treten immer stärker in den Vordergrund. (Vgl. Rißmann & Remsperger 2011: 9 f.)
Was genau heute unter dem Begriff Familie verstanden wird und welche Auswirkungen der gesellschaftliche Wandel auf die Lebenslagen und Bedarfe von Familien hat, soll im folgenden Abschnitt näher erläutert werden.
2.1. Begriffsbestimmung: Familie
Es ist kaum möglich, den Begriff Familie in unserer Gesellschaft genau und eindeutig zu bestimmen, da seine Bedeutung das Ergebnis gesellschaftlicher Definitions- und Aushandlungsprozesse ist, die sich im Zuge gesellschaftlicher Wandlungsprozesse stetig verändern. Demnach ist das Verständnis von Familie ein Konstrukt, das von den zeitlichen und kulturellen Bedingungen und Systemen unserer Gesellschaft abhängig ist. die Vorstellungen von Familie in der breiten Öffentlichkeit sind teilweise stark individuell geprägt, orientieren sich in ihrem Denken jedoch insgesamt trotz gesellschaftlicher Veränderungsprozesse zum großen Teil am Leitbild der bürgerlichen Kernfamilie, also einer Haushaltsgemeinschaft von Eltern und ihren Kindern, im Idealfall auf Ehe gegründet. Nach Umfragen des Allensbacher Instituts für Demoskopie von 2004 sehen 57% der Befragten im Alter zwischen 18 und 44 Jahren die Zwei-Kind-Familie als ideale Familiengröße an. (Vgl. Wagenblass 2006: 5 ff.)
In der fachlichen und wissenschaftlichen Diskussion gibt es hingegen unterschiedliche Sichtweisen auf Familie, die hier kurz vorgestellt werden sollen.
Der soziologische Familienbegriff
Im soziologischen Kontext geht es bei der Definition von Familie nicht um die statistische Häufigkeit bestimmter Lebensformen, sondern um eine Abbildung der vielen verschiedenen Möglichkeiten familiären Lebens. Dies führt dazu, dass der Familienbegriff deutlich weiter gefasst wird:
„Als allgemeinste Formel kann Familie als Lebensform definiert werden, in der verschiedene Generationen aufeinander bezogen sind.“ (Wagenblass 2006: 10)
Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels hat auch ein Wandel der Ehe stattgefunden. So hat die Heiratsneigung in den letzten Jahren ab und die Scheidungsraten zugenommen, was zu einer Vielfalt an verschiedenen Familien- und Haushaltszusammensetzungen geführt hat.
Mögliche Lebensformen in unserer heutigen Gesellschaft:
- „Haushalte ohne Kinder mit den Merkmalsausprägungen Ehepaar
- Nichteheliche Lebensgemeinschaften
- Einpersonenhaushalte
- Zweigenerationenhaushalte mit den Ausprägungen Ehepaar mit Kind(ern)
- Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kind(ern)
- Alleinerziehende
- Haushalte mit verheirateten Kindern
- Drei- oder Mehrgenerationenhaushalte“ (Henschel 2011: 5)
Der politische Familienbegriff
Auch der politische Familienbegriff und die heutige Familienpolitik orientieren sich heute nicht mehr ausschließlich an der klassischen Familienform, die sich aus einem Ehepaar und ihrem Kind oder ihren Kindern zusammensetzt. So nimmt die Politik verstärkt auch andere Formen von Familie in den Blick, auch wenn diese Formen nicht immer den normativen Leitbildern einzelner Politiker entsprechen. Vom politischen Standpunkt aus wird Familie heute als ein Ort verstanden, „[...] an dem Kinder leben bzw. da, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft Verantwortung übernehmen [...]“ (Wagenblass 2006: 9). Die Dualität von Familie und Ehe, die auf politischer Ebene lange Zeit postuliert wurde, löst sich nach diesem Verständnis immer mehr auf. (Vgl. Wagenblass 2006: 8 f.)
Der psychologische Familienbegriff
Im Mittelpunkt des psychologischen Familienbegriffs stehen Aspekte der Beziehung und Bindung sowie die wechselseitige Verbundenheit der Mitglieder eines familiären Systems untereinander.
„Danach sind Familien als intime Beziehungssysteme zu verstehen, die sich durch Abgrenzung, Privatheit, Dauerhaftigkeit und Nähe von anderen sozialen Beziehungssystemen unterscheiden.“ (Wagenblass 2006: 12)
Der rechtliche Familienbegriff
Das deutsche Rechtssystem stellt im Grundgesetz die besondere Bedeutung der Familie heraus, indem es festschreibt, dass die Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung steht (Artikel 6 GG). Darüber hinaus ist jedoch in keinem Gesetzbuch eine einheitliche Definition von Familie zu finden, teilweise wird der Familienbegriff sogar wie im Sozialgesetzbuch II durch den weiter gefassten Begriff der Gemeinschaft ersetzt. (Vgl. Wagenblass 2006: 6 f.)
Der statistische Familienbegriff
Im Mikrozensus des statistischen Bundesamts wird der Familienbegriff stark an die Haushaltsstruktur gebunden. Das bedeutet, dass statistisch gesehen nur Menschen eine Familie bilden, die im selben Haushalt leben.
Definition von Familie nach dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes:
„Die Familie im statistischen Sinn umfasst im Mikrozensus alle Eltern-Kind-emeinschaften, das heißt Ehepaare, nichteheliche und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften sowie allein erziehende Mütter und Väter mit ledigen Kindern im Haushalt. Einbezogen sind in diesen Familienbegriff - neben leiblichen Kindern - auch Stief-, Pflege- und Adoptivkinder ohne Altersbegrenzung. Damit besteht eine statistische Familie immer aus zwei Generationen (Zwei-Generationen-Regel): Eltern/-teile und im Haushalt lebende ledige Kinder. Kinder, die noch gemeinsam mit den Eltern in einem Haushalt leben, dort aber bereits eigene Kinder versorgen, sowie Kinder, die nicht mehr ledig sind oder mit eine(m)/r Partner/in in einer Lebensgemeinschaft leben, werden im Mikrozensus nicht der Herkunftsfamilie zugerechnet, sondern zählen statistisch als eigene Familiebeziehungsweise Lebensform.“ (Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2012: o.S.)
Kritisiert wird an der statistischen Definition häufig die Fokussierung auf den Aspekt des gemeinsamen Haushalts und der räumlichen Nähe. Da haushaltsübergreifende Familienformen in diesem Konzept nicht berücksichtigt werden, sind weitere Definitionen entstanden wie bspw. das Konzept der Familie als Netzwerk. (Vgl. Zander & Dietz 2003: 8)
Familie als Netzwerk
Dieser Begriff stellt die Verantwortungs- und Fürsorgebereitschaft der einzelnen Familienmitglieder ins Zentrum, welche notfalls auch über größere Distanzen und mehrere Haushalte hinweg füreinander aufgebracht wird. So betont dieser Ansatz gerade auch die haushaltsübergreifende Bedeutung von Großeltern, Freunden und Nachbarn für die Bewältigung des Alltags und bezieht sich dabei auf die tatsächlichen Hilfebeziehungen und (Gegen-)Leistungen innerhalb der Familie. Es geht also primär um die Funktion, die Familie für sich und innerhalb der Gesellschaft erfüllt. Durch diese Akzentuierung berücksichtigt dieser Ansatz nicht nur kindererziehende, sondern auch krankenversorgende und pflegende Familien sowie getrennt lebende Paare, bei denen die Kindererziehung auf zwei Haushalte verteilt ist. Die klassische Kernfamilie ist dabei „[...] eher zu verstehen als emotionaler, fürsorglicher Ausgangspunkt und Organisationszentrale, um welche herum andere eingebunden werden. Probleme entstehen nun genau dort, wo der emotionale Kern versagt oder als Organisationszentrale überfordert ist“ (Zander & Dietz 2003: 9). Nach Zander und Dietz ist dies der Punkt, wo Familienpolitik ansetzen und Familien unterstützen muss. Es reiche jedoch nicht aus, nur in die Stützung der Kernfamilie zu investieren, so die Autoren. Auch die Netzwerkverbindungen müssen eingebunden werden, da sie mit ihrem stabilisierenden Charakter eine elementare Funktion für die ganze Familie innehaben. (Vgl. Zander & Dietz 2003: 8 f.)
In Bezug auf Familienzentren sind alle verschiedenen Sichtweisen auf Familie von Bedeutung und geben wichtige Hinweise für vielfältige Handlungsansätze. Da sich Familienzentren in ihren Angeboten immer an ihrem gesamten Sozialraum und den darin lebenden Menschen orientieren, ist es wichtig, dass sie alle tatsächlich vorhandenen Familien- und Lebensformen im Blick haben und sich auf die entsprechenden, jeweils individuellen Bedarfe einstellen. Dabei spielen insbesondere auch die Netzwerke eine Rolle, in denen sich Familien bewegen, da sie mit ihrer stützenden und entlastenden Funktion eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe übernehmen. Aufgrund zunehmender Tendenzen der Verinselung und Isolation von Kernfamilien dünnen diese natürlichen Netzwerke jedoch immer stärker aus. Eltern fühlen sich mit ihren Fragen und Belastungen zunehmend auf sich allein gestellt und es macht sich eine Verunsicherung in Erziehungsfragen breit, die sich quer durch alle soziale und Bildungsschichten zieht (vgl. Rißmann & Remsperger 2011: 10). Dementsprechend gilt es diese familiären Netzwerke zu stärken und gleichzeitig neue Netzwerkstrukturen zu schaffen, auf welche die Familien eines Sozialraums zurückgreifen können.
2.2. Herausforderungen und Lebenslagen von Familien
Wie oben dargelegt, hat die Individualisierung und Pluralisierung in unserer Gesellschaft dazu geführt, dass es heute kein klar umrissenes Bild von Familie, Elternschaft und Partnerschaft mehr gibt. Insgesamt nimmt die Heiratsneigung von Paaren in Deutschland ab sowie die Scheidungsraten zu und es ist eine Zunahme von Stief- bzw. Patchworkfamilien zu verzeichnen. Darüber hinaus ist Elternschaft heute kein klares, unhinterfragtes Lebensmodell mehr wie noch vor 30 Jahren, sondern nur noch eine Option unter vielen. (Vgl. Stange 2012c: 17)
Einhergehend mit den gesellschaftlichen Veränderungen in der Privat- und Arbeitswelt kommt es dazu, dass sich viele Eltern heute unter großem Druck erleben und einen höheren Unterstützungsbedarf haben als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. So ist bspw. durch den Wandel von Elternschaft als selbstverständliches Lebensmodell hin zu einer verantworteten Elternschaft der Druck größer geworden, nur noch dann Kinder zu bekommen, wenn man sie auch finanziell, materiell, zeitlich und emotional gut versorgen und ihnen eine glückliche Kindheit bieten kann. Sind einzelne dieser Faktoren nicht immer in ausreichendem Maße vorhanden, kommen Eltern schnell in die Lage, sich (vor sich selbst) für die Entscheidung zum Kind rechtfertigen zu müssen. Seinen Kindern jedoch gleichermaßen zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen zu können, fällt nicht immer allen Familien leicht, insbesondere für Alleinerziehende und Familien mit vielen Kindern birgt Elternschaft in Deutschland ein großes Armutsrisiko. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist deshalb ein wichtiges Thema und stellt viele Familien vor große Herausforderungen. In der Arbeitswelt wird immer mehr Leistung, Kurzfristigkeit, Flexibilität und Mobilität gefordert, was im direkten Gegensatz zu den Abhängigkeiten und Verpflichtungen zu stehen scheint, die das Leben mit Kindern mit sich bringt. Hier die richtige Balance zwischen Beruf und Familie zu finden, ist nicht immer einfach. Distanzfamilien, bei welchen ein Elternteil (zumeist der Vater) unter der Woche an einem anderen Ort arbeitet und dort in einem eigenen Haushalt lebt, gibt es immer häufiger. Vor dem Hintergrund der hohen Erwartungen der Arbeitswelt wird Elternschaft heute zunehmend als einschränkend empfunden. (Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard [Hrsg.] 2008: 3 ff.)
Hinzu kommt der gestiegene Anspruch unserer Gesellschaft an eine gelingende, partnerschaftliche Erziehung durch die Emanzipation des Kindes. Denn in den letzten Jahren wurde die gesellschaftliche Stellung des Kindes erheblich aufgewertet, sodass Eltern immer stärker vor die Aufgabe gestellt werden, für das Wohl ihres Kindes zu sorgen, ihm eine glückliche Kindheit sicherzustellen und es als gleichberechtigten Partner zu betrachten und zu beteiligen. Zudem führen die Erkenntnisse zur besonderen Bedeutung der ersten Jahre auf die weitere Entwicklung von Kindern zu dem Anspruch, dass Kinder von ihren Eltern möglichst früh und umfassend gefördert werden sollen. Diese gesellschaftliche Neudefinition des Kindes macht Elternschaft heute immer anspruchsvoller und voraussetzungsreicher und erhöht die Erwartungen an die Erziehungsleistung der Eltern immens. Die Diskrepanz zwischen der erzieherischen Praxis und dem Bedürfnis und Pflichtgefühl, in der Erziehung alles richtig machen zu wollen, verunsichert viele Eltern. So bringen alltägliche Aushandlungsprozesse mit den Kindern viele Mütter und Väter an ihre erzieherischen Grenzen und auch spezielle Förderangebote sind nicht immer für alle Familien finanzierbar. Die Flut an zur Verfügung stehenden Ratgebern sowie die Unübersichtlichkeit der vorhandenen Beratungs-, Bildungs- und Förderangebote macht eine Orientierung dabei nicht immer einfacher. (Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard [Hrsg.] 2008: 3 ff.)
Auch der Wandel der Kindheit an sich, welche sich immer stärker von der Straße in den häuslichen Bereich verlagert, hat große Auswirkungen auf die Lebenslagen von Familien. Eltern (insbesondere Mütter) treten zunehmend in die Rolle von Familienmanagern, um durch vielfältige Maßnahmen einer Verinselung ihrer Kinder entgegenzuwirken. Sie kümmern sich um die angemessene Förderung und eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung ihrer Kinder, ermöglichen ihnen vielfältige soziale Kontakte und stehen als Begleit-, Spiel- und Hausaufgabenpartner zur Verfügung. (Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard [Hrsg.] 2008: 3 ff.)
Der persönliche Anspruch, all dies leisten zu können, stellt insbesondere viele Mütter vor die Wahl zwischen Beruf und Familie. Zwar ist gesamtgesellschaftlich in den Paarbeziehungen ein Aufbrechen traditioneller Rollenverständnisse zu verzeichnen, Elternschaft bedeutet jedoch auch heute noch eine starke Retraditionalisierung der Elternrollen. So sind es immer noch zu einem sehr großen Teil die Mütter, die sich eine Auszeit vom Beruf nehmen und für den überwiegenden Teil der Erziehung zuständig sind, während die Väter als Hauptverdiener beruflich nur selten kürzer treten. Doch auch die Vaterrolle hat sich gewandelt und ist immer unbestimmter geworden. Zum einen werden in der Arbeitswelt weiterhin Verhaltensweisen gefordert, die als typisch männlich bezeichnet werden (Durchsetzungsvermögen, Zielstrebigkeit, Härte etc.), zum anderen werden sie im Privaten als liebe- und verständnisvoller Spiel- und Freizeit-Papa immer stärker in die Familienarbeit mit eingebunden. Mütter fühlen sich hingegen in ihrer Elternrolle häufig den widersprüchlichen Anforderungen der Gesellschaft ausgesetzt, auf der einen Seite dem kulturell stark verankerten Bild der „guten Mutter“ gerecht zu werden und andererseits den emanzipatorischen modernen Trends zu folgen und sich im Berufsleben selbst zu verwirklichen. (Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard [Hrsg.] 2008: 3 ff.)
In einer repräsentativen Querschnittsbefragung des Staatsinstituts für Familienforschung an der Universität Bamberg (ifb) wurden Eltern befragt, wie sie ihren Erziehungsalltag erleben, wie sicher sie sich in der Erziehung fühlen und welche Wünsche und Bedürfnisse sie hinsichtlich familienbildender und informierender Angebote haben. Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern die gewachsenen Anforderungen, die an sie gestellt werden, durchaus wahrnehmen und sich auch selbst als wichtigste Erziehungsinstanz begreifen. Dabei scheint die Unsicherheit in Erziehungsfragen stetig zuzunehmen. Der Anteil an Eltern, der in der Befragung von 2006 angab, sich in der Erziehung ihrer Kinder häufig oder immer unsicher zu fühlen, lag bei 12%, während er 2002 noch bei 5% lag. Gleichzeitig fiel der Prozentsatz an Eltern, die sich nie unsicher fühlen, im gleichen Zeitraum von 13 auf 7%. Der Anteil von Eltern, die sich selten oder manchmal unsicher fühlten, blieb hingegen stabil bei 35 (selten) bzw. 46% (manchmal). Darüber hinaus war festzustellen, dass sich Mütter im Vergleich zu Vätern häufiger unsicher fühlten und die Unsicherheit beim ersten Kind besonders groß war. Insgesamt hält die Mehrheit der Eltern eine Vorbereitung auf Elternschaft für grundsätzlich sinnvoll. (Vgl. Schmolka & Mühling 2007: 22 ff.)
Insbesondere bei konkreten Fragen oder in Situationen, in denen sie sich unsicher sind, tauschen sich Eltern gerne über Erziehungsfragen aus, bevorzugt mit Personen aus dem direkten sozialen Umfeld wie dem eigenen Partner oder der Partnerin, Verwandten und Freunden. Außerhalb des privaten Umfelds haben insbesondere ErzieherInnen und Lehrkräfte als AnsprechpartnerInnen eine wichtige Funktion. Die Rolle von Therapeuten nimmt ebenfalls zu, während Ärzte immer weniger zu Rate gezogen werden. Wichtiger geworden sind auch das Jugendamt sowie Mütter- und Familienzentren. Interessant ist, dass auch hier Unterschiede im ratsuchenden Verhalten zwischen den Geschlechtern sowie zwischen verschiedenen Familienformen ausgemacht werden konnten. Dies gibt einen wichtigen Hinweis darauf, dass es in der Arbeit mit Eltern verstärkt auf differenzierte und ressourcenorientierte Konzepte ankommt. (Vgl. Schmolka & Mühling 2007: 32 ff.)
Die am häufigsten genannten Themen, zu denen Eltern einen Orientierungs- und Bildungsbedarf angeben, sind Schule, konkrete Erziehungsfragen und -ziele, Jugendliche/ Pubertät, Ausbildung und berufliche Zukunft ihrer Kinder sowie allgemein Informationen und Beratung zum Thema Familie. Auch hier ist wieder ein Unterschied zwischen den Angaben der Geschlechter festzustellen: Mütter nennen insgesamt mehr Themen und richten ihre Aufmerksamkeit stärker auf die soziale und psychische Entwicklung ihrer Kinder, während sich Väter stärker für Themen der formalen Bildung und die Zukunftsperspektiven ihrer Kinder interessieren. Auffällig ist außerdem, dass Eltern mit einer höheren Bildung im Schnitt mehr Themen nennen, zu denen sie sich Informationen wünschen, als Eltern mit einem niedrigeren Bildungsniveau. Dies lässt vermuten, dass es ihnen insgesamt leichter fällt, ihren Informationsbedarf konkret zu benennen. (Vgl. Schmolka & Mühling 2007: 26 ff.)
Ausschlaggebende Faktoren für die Nutzung von Familienbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten sind die Passgenauigkeit, die Alltags- und Wohnortnähe sowie die Orientierung der Angebote am Alter und der Entwicklung der Kinder und den konkreten Bedarfen der Familien. Eltern müssen sich in ihrer jeweiligen Situation sowie in Ihrer Autonomie ernst genommen und mit ihrer Erziehungsleistung wertgeschätzt fühlen. Sie möchten auf Augenhöhe seriös und fundiert informiert und beraten werden, ohne von der Flut und Unübersichtlichkeit möglicher Angebote erschlagen zu werden. (Vgl. Stange et al. [Hrsg.] 2012: 317)
2.3. Notwendigkeit von frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sowie der Unterstützung von Familien
Die Ausführungen aus Kapitel 2.2. machen deutlich, dass die Erwartungen an Erziehung und Elternschaft steigen und Eltern immer mehr Verantwortung für die Entwicklung ihrer Kinder tragen müssen. Gleichzeitig wird in der Gesellschaft jedoch wenig Rücksicht auf die Belange von Eltern genommen. Viele Eltern haben einen wachsenden Bedarf an Unterstützung und Entlastung, der gesellschaftlich aufgefangen werden muss, wenn er sich nicht negativ auf die innerfamiliären Beziehungen sowie die Start- und Entwicklungschancen von Kindern auswirken soll. Denn die Familie hat durch ihre soziale Einbettung und ihre im Alltag stattfindenden Kommunikations- und Vermittlungsprozesse nach wie vor den größten Einfluss auf den Erfolg von Lern- und Bildungsprozessen bei Kindern. Der hohe Bedarf an einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und nicht zuletzt die vielfältigen Forschungsergebnisse aus der Hirnforschung, welche die außerordentliche Bedeutung der ersten Lebensjahre auf die weitere Entwicklung von Kindern bestätigen, tragen zusätzlich dazu bei, dass die Unterstützung von Familien bei der Bildung, Förderung, Erziehung und Betreuung ihrer Kinder immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Demzufolge brauchen wir Konzepte der Familienbildung, die Familien tatsächlich erreichen und ihnen dort passgenaue Unterstützung anbieten, wo sie Hilfe benötigen. Dabei müssen die Bedürfnisse und Wünsche, aber auch die Vorbehalte aller Eltern und Familien bei der Konzeption von Angeboten berücksichtigt werden. Sprich, es müssen vielfältige fachlich hochwertige, niederschwellige sowie alltags-, bedarfs- und sozialraumorientierte Angebote für Familien entwickelt und auf eine übersichtliche Art und Weise dargestellt werden.
3. Familienzentren – theoretische Grundlagen
3.1. Begriffsbestimmung: Familienzentrum
Der Begriff des Familienzentrums ist nur schwer einzugrenzen. Zum einen können sich in der Praxis Einrichtungen, die sich Familienzentrum nennen, sehr stark in ihrer Angebotsstruktur voneinander unterscheiden, zum anderen können Institutionen mit einer vergleichbaren Angebotsstruktur sehr unterschiedlich benannt werden. So existieren neben der Bezeichnung Familienzentrum ebenfalls Begriffe wie Eltern-Kind-Zentren, Häuser für Kinder und Familien, Kinder- und Familienzentren, Elternkompetenzzentren, Mütterzentren, Early-Excellence-Centres und so fort. Der Grund für diese vielfältigen Ausgestaltungen des Begriffs liegt in den sehr unterschiedlichen, jeweils individuell auf die örtlichen Bedarfe bezogenen, regionalen Entwicklungen im Praxisfeld der letzten 20 bis 30 Jahre (vgl. Diller & Schelle 2009: 11 ff.).
In der Praxis entwickeln sich Familienzentren auf der Grundlage von verschiedenen Institutionstypen wie bspw. Familienbildungsstätten, Mütterzentren oder Mehrgenerationen-häuser, die häufigste Form ist jedoch eine institutionelle Weiterentwicklung auf der Grundlage der Kindertagesstätte. Denn Tageseinrichtungen für Kinder besitzen unter den familienunterstützenden Institutionen einen besonderen Stellenwert, da sie zumeist die erste Bildungs- und Erziehungsinstitution im Leben eines Kindes sind und sich einer großen Akzeptanz seitens der Eltern erfreuen. Die Angebote finden auf freiwilliger Basis statt und werden in großem Umfang täglich in Anspruch genommen, rund 90 Prozent der Kinder in Deutschland besuchen vor ihrer Einschulung eine Kindertagesstätte. In der Regel können hier drei Jahre lang verlässliche Beziehungen aufgebaut und neue Kontakte wie etwa mit Nachbarn geknüpft werden. Die Vielfalt der Lebenslagen und Nationalitäten, die in den Einrichtungen ganz selbstverständlich aufeinander treffen, erleichtert die soziale Integration und gibt auch neu zugezogenen Familien die Möglichkeit, Anschluss zu finden und neue Menschen kennenzulernen. Darüber hinaus ermöglicht der tägliche Kontakt den pädagogischen Fachkräften, die Anliegen der Kinder und Eltern zeitnah und professionell aufzugreifen. Risikosituationen, Störungen der Entwicklung und Unterstützungsbedarfe können so frühzeitig wahrgenommen und bearbeitet werden (vgl. MGFFI NRW [Hrsg.] 2008: 7). Der Vorteil einer Kindertagesstätte als Grundlage für ein Familienzentrum liegt also in ihrer breiten Erreichbarkeit der Familien sowie in der Niederschwelligkeit, Wohnortnähe, Kontinuität und Regelmäßigkeit ihrer Angebote. (Vgl. Diller & Schelle 2009: 7, 10 f.)
Die ersten Familienzentren entstanden aus der Erkenntnis heraus, dass Eltern Bedarfe hatten, welche von den jeweiligen Kindertageseinrichtungen bisher nicht abgedeckt wurden. Beispiele hierfür sind ein erhöhter Beratungsbedarf in Erziehungsfragen, die Koordinierung der Arbeitszeiten der Eltern mit den Öffnungszeiten der Kindertagesstätte, die Unterstützung und Beratung bei sich verändernden Lebenssituationen und Familienkonstellationen sowie bei familiären Krisen und der Wunsch nach Austausch mit anderen Eltern. Da die versuchte Weitervermittlung der Eltern an andere Institutionen wie Erziehungsberatungsstellen oder die Familienbildung häufig erfolglos blieb, wurden zunehmend zusätzliche Angebote in die Einrichtungen geholt oder es wurde versucht, die Vermittlung anders zu gestalten. Auf diese Weise entstand eine neue konzeptionelle Sichtweise auf die Trias Kind – Eltern – Institution und der im Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) festgeschriebene familienergänzende Auftrag der Kindertagesstätten wurde neu in den Blick genommen sowie an die veränderten Lebenslagen von Kindern, Eltern und der ganzen Familie angepasst. Dies war der Beginn einer zukunftsweisenden Weiterentwicklung sowie der sozialräumlichen Öffnung der Kindertagesstätten. (Vgl. Diller & Schelle 2009: 12)
Nach Diller & Schelle ist der familienpolitische Auftrag von Familienzentren auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen:
„Kinder, Eltern und die ganze Familie brauchen institutionelle Unterstützungsangebote, die kooperativ organisiert und konzipiert sind. Eltern sollen nicht mehr verschiedene Institutionen aufsuchen müssen, sondern ein integriertes Angebot 'unter einem Dach' oder 'aus einer Hand' vorfinden.“ (Diller & Schelle 2009: 13)
Auf diese Weise werden Zugangshürden verringert und die Inanspruchnahme von Angeboten aus den Bereichen Kindertagesstätte, Familienbildung und Familienhilfe erleichtert. Die Förderung der Kinder und die Unterstützung der Eltern werden Hand in Hand entwickelt und gestaltet.
Die Angebotsstrukturen der heutigen Familienzentren sind hingegen aufgrund individueller Entwicklungen sehr unterschiedlich und orientieren sich immer an ihrem jeweiligen Sozialraum, der die Menschen durch seine (infra-)strukturellen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen in ihren Kontakten, ihrer Mobilität und ihrem Verhalten beeinflusst. Sozialräume können Wohnviertel, Nachbarschaften, Straßenzüge, Stadtviertel oder auch ganze Stadtgebiete sein. (Vgl. Diller & Schelle 2009: 20)
In einer vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) ins Leben gerufenen Expertenrunde zum Thema Familienzentren in Hannover wurde am 15.05.2012 auf der Basis der bisherigen Diskussion ein erster Entwurf für eine Definition von Familienzentren formuliert:
“Familienzentren in Niedersachsen sind Orte für Familien. Familien finden hierwohnortnah vielfältige, familienunterstützende Angebote, die an ihren jeweiligen Bedürfnissen und Bedarfen ansetzen und an deren Entwicklung sie beteiligt sind. Die passgenauen Angebote richten sich sowohl an die erzieherischen als auch persönlichen und beruflichen Kompetenzen der Eltern und Familien. Um diese Vielfalt zu ermöglichen, ist unterschiedliches fachliches Know-how notwendig. Dies geschieht sowohl im Rahmen von Netzwerken und Kooperationen als auch in Form multidisziplinärer Teams. In Familienzentren wird an den Ressourcen aller Beteiligten angesetzt und eine wertschätzende Grundhaltung bildet die Basis der Zusammenarbeit. Auch sind Familienzentren in den Sozialraum geöffnet und stehen somit allen Familien im Umfeld offen. Darüber hinaus sind Eltern intensiv in die Bildungsprozesse ihrer Kinder eingebunden, wobei Erziehungspartner-schaften eine wesentliche Voraussetzung der Zusammenarbeit von Eltern und pädagogischen Fachkräften bilden. Vor diesem Hintergrund ist jedes Familienzentrum einzigartig.” (Engelhardt/ nifbe 2012 [u.M.]: 1)
Diese Definition ist bereits sehr umfangreich und detailliert. Es werden folgende Grundzüge und Wesensmerkmale von Familienzentren benannt:
- Sozialräumliche Nähe und Vielfalt der familienunterstützenden Angebote
- Passgenaue, bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebote
- Partizipation
- Stärkung von Elternkompetenzen
- Interdisziplinäres fachliches Know-how durch multiprossionelle Teams
- Sozialraumorientierung, Netzwerkarbeit und Kooperation
- Ressourcenorientierung
- Wertschätzende Grundhaltung
- Öffnung in den Sozialraum (für alle Familien)
- Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
Die Betonung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften, welche eine gängige Begrifflichkeit im Bereich der Kindertageseinrichtungen darstellen, macht deutlich, dass in dieser Definition zuvorderst davon ausgegangen wird, dass Familienzentren den Bereich der Kindertagesbetreuung mit einschließen, sich also grundsätzlich aus einer Kindertagesstätte heraus entwickeln. Diese Form hat zwar, wie bereits dargelegt, besondere Vorteile, doch in Abhängigkeit von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort kann es ebenfalls sinnvoll sein, dass eine andere Einrichtungsform die Funktion eines Familienzentrums übernimmt. Somit ist die Funktion von Familienzentren ein zentraler, besonders hervorzuhebender Aspekt. Diese ergibt sich m. E. aus einer ganzheitlicheren Betrachtungsweise, welche Familienzentren als Teil eines Gesamtnetzwerks betrachtet und ihnen eine zentrale, koordinierende Rolle zuschreibt. Die Einrichtung wird so zum Knotenpunkt eines familienunterstützenden Netzwerks in den Kommunen (vgl. Diller & Schelle 2009: 13; MGFFI NRW [Hrsg.] 2008: 7). Eine Definition, die diesem Verständnis von einem Zentrum für Familien Rechnung trägt, könnte wie folgt aussehen:
Ein Familienzentrum ist eine Einrichtung, welche eng mit weiteren familienunterstützenden Diensten ihres Sozialraums kooperiert und so vielfältige und wohnortnahe Angebote für die ganze Familie unter einem Dach bzw. aus einer Hand vereint. Dabei nimmt es eine zentrale Stellung in einem sozialräumlichen Gesamtnetzwerk ein und koordiniert, vermittelt und bündelt die familienunterstützenden Angebote. Das Familienzentrum ist eine zentrale Anlaufstelle und Begegnungsstätte für Familien, die ihr Angebot nicht nur an einzelne Zielgruppen, sondern an alle Familien des jeweiligen Sozialraums richtet und von Menschen aller Altersgruppen in Anspruch genommen werden kann. Darüber hinaus folgt das Familienzentrum einem Ressourcen betonenden Ansatz, orientiert sich an den konkreten Bedarfen sowie den strukturellen Gegebenheiten des jeweiligen Sozialraums und beteiligt die Familien an den Prozessen, die sie betreffen.
Diese Definition soll im folgenden Verlauf als Arbeitsdefinition dienen.
3.2. Begründungszusammenhänge für Familienzentren
Für die Notwendigkeit von Familienzentren gibt es mehrere Begründungszusammenhänge, vier davon können als zentral betrachtet werden und sollen hier vorgestellt werden.
Der gestiegene Stellenwert des Elementarbereichs
Zunächst ist im Zusammenhang mit Familienzentren die große Bedeutung der ersten Lebensjahre auf die weitere Entwicklung von Kindern zu nennen, die auch in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion heute als unbestritten gilt (vgl. Stange 2012c: 16).
Diese Annahmen werden durch Studien wie die Bass-Studie von 2008 bestätigt. Dort wurde u.a. untersucht, wie sich der Krippenbesuch von Kleinkindern auf die Wahrscheinlichkeit auswirkt, später ein Gymnasium zu besuchen. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Wahrscheinlich durch einen Krippenbesuch von 36% auf 50% erhöht werden kann. Bei benachteiligten Kindern ist dieser Effekt sogar noch stärker ausgeprägt. Hier erhöht sich die Wahrscheinlichkeit um gut zwei Drittel (vgl. Fritschi & Oesch 2008: 6 ff.).
Auch volkswirtschaftliche Aspekte spielen eine große Rolle in der Diskussion um die Bedeutung des frühkindlichen Bereichs. Die Ergebnisse des Perry-Preschool-Projects haben bspw. gezeigt, dass eine qualitativ hochwertige frühkindliche Betreuung bei sozial benachteiligten Kindern in einer Kosten-Nutzen-Analyse zu sehr positiven Ergebnissen führt und sich deutlich rechnet. Die begleiteten Kinder haben höhere Schulabschlüsse erreicht, im Beruf mehr verdient und somit mehr Steuern bezahlt, konnten sich häufiger eine eigene Immobilie leisten, haben weniger Risikoverhalten gezeigt (z.B. Rauchen, Drogenkonsum etc.), sind deutlich seltener delinquent und/ oder straffällig geworden und haben einen gesünderen Lebensstil verfolgt. Die Lebenszufriedenheit ist insgesamt gestiegen. In der Konsequenz bedeutet das aus volkswirtschaftlicher Sicht:
- Geringere Bildungskosten (durch erfolgreichere und weniger problembelastete Bildungsbiographien)
- Geringere Kosten in Bezug auf Straftaten und Gewalt
- Geringere Kosten für das Gesundheitssystem
- Höherer Lebensstandard und damit verbundene positive volkswirtschaftliche Effekte (Steuereinnahmen, Kaufkraft etc.)
- Geringere gesellschaftliche und ökonomische Ungleichheit (vgl. Barnett 2011: 1 ff.)
Auch in der BASS-Studie haben die Autoren errechnet, welcher volkswirtschaftliche Nutzen durch den Besuch einer Krippe und die damit verbundene höhere Wahrscheinlichkeit eines Gymnasium-Besuchs zu erwarten wäre. Ergebnis war ein durchschnittliches Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1: 2,7.
„Anders gesagt: Durch den Krippenbesuch eines Kindes werden volkswirtschaftliche Nutzeneffekte ausgelöst, die rund dreimal so hoch wie die durch den Krippenbesuch entstandenen Kosten sind. Dies entspricht einer langjährigen Verzinsung der Investitionen in Form von Krippenkosten von jährlich 7.3 Prozent.“ (Fritschi & Oesch 2008: 10)
Diese Erkenntnisse haben große Auswirkungen auf den frühkindlichen Bereich der Bildung, Erziehung und Betreuung, da dieser sich immer stärker den Erwartungen stellen muss, familiäre und soziale Benachteiligungen auszugleichen und durch frühe Förderung der Kinder für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die Qualität der Einrichtungen stimmt, wie es bspw. in dem gezielten Förder-Programm des Perry-Preschool-Projects gegeben war. Denn insbesondere im Krippenbereich ist die Qualität der Krippen und der pädagogischen Interaktion der entscheidende Faktor dafür, ob sich der Besuch positiv oder auch negativ auf die Entwicklung sowie das Bindungs- und Sozialverhalten eines Kindes auswirkt (vgl. Wüstenberg 1992: 63, Lowe Vandell 2011: 3 ff.). Hinsichtlich der Qualität der außerfamiliären Kindertagesbetreuung in Deutschland gibt es insgesamt jedoch noch erhebliches Entwicklungspotential, wie die jüngsten Ergebnisse der Nubbek-Studie zeigen:
„Jeweils über 80 Prozent der außerfamiliären Betreuungsformen liegen hinsichtlich der pädagogischen Prozessqualität (KES-RZ, KRIPS-R, TAS-R) in der Zone mittlerer Qualität (Werte zwischen 3 und 5). Gute pädagogische Prozessqualität kommt dabei in jedem der Betreuungssettings in weniger als 10 Prozent der Fälle vor; unzureichende Qualität dagegen – mit Ausnahme der Tagespflege – in zum Teil deutlich mehr als 10 Prozent der Fälle […].“ (Tietze et al.[Hrsg.] 2012: 8)
Darüber hinaus ergibt ein Abgleich der Daten mit einer Studie aus der Mitte der 1990er Jahre, dass sich die Qualität der Betreuungseinrichtungen in den letzten 15 Jahren nicht verändert hat. In Anbetracht der großen Bedeutung des frühkindlichen Bereichs sind dies erschreckende Ergebnisse, die aufzeigen, dass erheblicher Handlungsbedarf zur Qualitätsverbesserung besteht. Nur wenn dies geschieht, können die großen Potentiale, die eine qualitativ hochwertige frühkindliche Betreuung insbesondere auch im Krippenbereich birgt, entfaltet und genutzt werden.
Familienzentren, die an Kindertageseinrichtungen gekoppelt sind, können durch ihre spezifische Organisationsform und Arbeitsweise einen wichtigen Beitrag zu einer wirksameren Prävention und frühen Förderung von Kindern leisten, da sie einen entscheidenden Vorteil haben: Sie richten sich an alle Familien des Sozialraums und können über spezielle Angebote für Kinder unter drei Jahren, wie bspw. Eltern-Kind-Gruppen, auch jene Kinder erreichen, die keine Krippengruppe besuchen. Darüber hinaus führt die starke Sozialraum- und Lebensweltorientierung von Familienzentren verstärkt zu wichtigen Kenntnissen über das soziale Umfeld und die Systeme, in denen sich Kinder bewegen. Diese Kenntnisse bieten wichtige Anknüpfungspunkte für eine individuelle Förderung und helfen den pädagogischen Fachkräften, die Kinder und deren Themen ganzheitlicher zu verstehen.
Der Faktor Eltern – die Bildungsbedeutung des familiären Systems
So wichtig der oben erklärte Einfluss von außerfamiliären Betreuungs- und Bildungseinrichtungen auf die Entwicklung von Kindern auch sein kann, die enorme Bedeutung der Familie und damit einhergehender Sozialschichteffekte darf nicht in den Hintergrund treten.
Ergebnisse der Nubbek-Studie haben gezeigt, dass der Bildungs- und Entwicklungsstand der untersuchten Kinder in allen getesteten Bereichen z.T. um ein vielfaches stärker mit den Merkmalen der Familie als mit den Merkmalen der außerfamiliären Betreuung zusammenhängt (vgl. Tietze et al. [Hrsg.] 2012: 11). Auch im Bereich Schule ist dieser Zusammenhang sichtbar. Begleituntersuchungen zu Pisa 2000 haben gezeigt, dass der Einfluss der Familie auf die getesteten Kompetenzen in den verschiedenen Fächern doppelt so groß war wie der Einfluss der Schule (vgl. Stange 2012c: 16). In den Ergebnissen der Bass-Studie wird der Einfluss der Eltern auf die Bildungsbiographie ihrer Kinder wie folgt beschrieben:
„Die Bildung der Eltern hat den signifikantesten und größten Einfluss auf die Einstufung in die Sek-I-Stufe: Kinder, deren Eltern höchstens einen Hauptschulabschluss haben, besuchen mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Gymnasium. Kinder von denen mindestens ein Elternteil einen gymnasialen Abschluss erworben hat, gehen dagegen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ins Gymnasium. Dies spiegelt wider, dass Bildung in Deutschland zu einem hohen Grad « vererbt» wird.“ (Fritschi & Oesch 2008: 5)
Diese Ergebnisse zeigen, dass Eltern der wichtigste Bildungsfaktor im Leben ihrer Kinder sind. Ist es also das Ziel frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung, Chancen-ungleichheiten abzubauen und bessere Lebens- und Entwicklungsbedingungen für Kinder zu schaffen, muss ihr gesamtes familiäres System in den Blick genommen und auch Eltern stärker unterstützt und begleitet werden. Elternbildungsprogramme, Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sowie integrierte Unterstützungsstrukturen für Familien allgemein gewinnen somit immer mehr an Bedeutung.
Der gewachsene Unterstützungsbedarf von Eltern
Der rasante gesellschaftliche Wandel hat große Auswirkungen auf die Lebenslagen und Bedarfe von Familien. Individualisierungsprozesse und steigende Scheidungsraten sorgen für eine zunehmende Pluralisierung der Lebensformen und den Wegbruch traditioneller Orientierungen. Die Anforderungen in der Berufswelt steigen und erfordern immer mehr Flexibilität und Mobilität, während sich gleichzeitig der wachsende Anspruch an eine gelingende Erziehung und glückliche Kindheit breit macht. Eltern sollen ihre Kinder sowohl emotional als auch materiell rundum versorgen können und ihnen eine bestmögliche Förderung in allen Entwicklungsbereichen sicherstellen. Gleichzeitig sind sie mit ihren Erziehungsfragen und Belastungen immer stärker auf sich allein gestellt, da ihre natürlichen sozialen und familiären Netzwerke ausdünnen und die strukturellen Rahmenbedingungen eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie insbesondere für Frauen noch immer schwierig machen. Demnach bedeutet Elternschaft auch heute noch eine deutliche Retraditionalisierung der Geschlechter- und Elternrollen. Viele Eltern geben an, dass sie in Erziehungsfragen verstärkt verunsichert seien und sich eine gezielte und bedarfsgerechte Unterstützung wünschten. Dies macht deutlich, dass es dringend an umfassenderen Unterstützungsstrukturen für Familien bedarf und frühkindliche Einrichtungen der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern immer stärker auch die Bedarfe von Eltern im Blick haben müssen. Familienzentren bieten hierfür das richtige Setting, da sie Eltern die Unterstützung zur Verfügung stellen können, die sie brauchen, ohne dass die Einrichtung in ihrem Kerngeschäft der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder überlastet und beeinträchtigt wird. (Siehe auch Kapitel 2.2.: Herausforderungen und Lebenslagen von Familien)
Die Resilienzforschung bestätigt die Notwendigkeit von sozial-ökologischen Netzwerkstrukturen
Im Hinblick auf die multifaktoriellen Bedingungen des Aufwachsens von Kindern liefert die Resilienzforschung wichtige Hinweise darauf, dass Bildungs- und Präventionsstrategien möglichst breit angelegt und unter Beteiligung möglichst vieler Partner im sozial-ökologischen Umfeld stattfinden sollten. Denn Kinder verfügen auch außerhalb ihrer Familien über entscheidende Quellen emotionaler und sozialer Unterstützung, wie bspw. Großeltern, Verwandte, Nachbarn, Geistliche, ErzieherInnen, LehrerInnen, Peer-Kontakte und positive Freundschaftsbeziehungen.
„Unterstützende Personen außerhalb der Familie trugen nicht nur zur unmittelbaren Problemreduzierung bei, sondern dienten gleichzeitig auch als Modelle für ein aktives und konstruktives Bewältigungsverhalten sowie für prosoziale Handlungsweisen.“ (Stange 2012c: 18)
LehrerInnen werden dabei als häufigste Vertrauensperson außerhalb der Familie benannt und der schulischen Umgebung kommt eine Funktion als Schutzfaktor zu, wenn sie spezifische Qualitäten erfüllt:
- Möglichkeiten des kooperativen Lernens und der Partizipation
- LehrerInnen sorgen sich um ihre SchülerInnen und zeigen ein aktives Interesse
- Enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Einrichtungen
- Verankerung von Schulsozialarbeit und weiteren Förderangeboten
- Organisation gemeinsamer außerschulischer Aktivitäten
- Wertschätzendes Schulklima
Diese Qualitäten sind analog auch auf Kindertageseinrichtungen übertragbar. Weitere Schutzfaktoren im sozialen Umfeld auf kommunaler Ebene sind der Zugang zu sozialen Einrichtungen und professionellen Hilfsangeboten, das Vorhandensein von prosozialen Rollenmodellen sowie von Normen und Werten in der Gesellschaft. (Vgl. Stange 2012c: 18 f.)
Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, dass Familien in ihrem Sozialraum in umfassende soziale Netzwerke eingebettet sind und ihre Kinder vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen Kontexten machen können. Da heutzutage jedoch die natürlichen Netzwerke von Familien immer stärker ausdünnen und Verwandte wie z.B. Großeltern häufig nicht mehr unmittelbar zur Unterstützung zur Verfügung stehen, müssen neue Wege zur Schaffung von Netzwerken und sozialer Einbindung gefunden werden. Familienzentren können dies leisten, da auch sie die oben genannten spezifischen Qualitäten erfüllen, sich darüber hinaus aber im Gegensatz zu Schule oder einzelnen Kindertageseinrichtungen nicht nur an bestimmte Familien, sondern an alle Menschen ihres Sozialraums wenden. Familienzentren sind Begegnungsstätten; sie bieten Familien vielfältige Möglichkeiten zur Knüpfung sozialer Kontakte und ermöglichen ihnen einen besonders niederschwelligen Zugang zu bedarfsgerechten und professionellen Präventions- und Hilfsangeboten.
3.3. Was unterscheidet ein Familienzentrum von einer Kita?
Wie im oberen Abschnitt dargestellt, muss ein Familienzentrum nicht gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder sein, in der Praxis entwickelt sich jedoch die Mehrzahl der Familienzentren aus einer Kindertagesstätte heraus, indem sie ihr Angebotsprofil für Familien erweitern und sich in den Sozialraum öffnen. Nach Diller und Schelle besteht des Spezifische der Familienzentren „[...] in einer erweiterten konzeptionellen Sichtweise auf die Trias 'Kind – Eltern – Institution'“ (Diller & Schelle 2009: 16). In diesem Sinne, so Diller und Schelle, wird der familienergänzende Auftrag der Kindertagesstätten neu ausbuchstabiert und an veränderte Lebenslagen von Kindern, Eltern und der ganzen Familie angepasst. Diese Abgrenzung von Familienzentren und Kindertagesstätten greift m. E. jedoch zu kurz, da sie in der Beschreibung der Trias den Sozialraumbezug und den Netzwerkgedanken von Familienzentren und damit ihre zentrale Rolle im sozialräumlichen Gesamtnetzwerk ausklammert. Die wichtigsten Punkte, in denen sich Familienzentren von Kindertagesstätten unterscheiden, sind folgende:
- Angebote der Elternbildung, -beratung und -unterstützung
- Angebote der Familienbildung, -beratung und -unterstützung (für alle Altersgruppen und Generationen – je nach Bedarf und Profilbildung)
- Öffnung in den Sozialraum (die Angebote richten sich an alle Familien des Sozialraums)
- Netzwerkarbeit, Kooperation und Koordination des sozialräumlichen Netzwerks für Familien (Träger übergreifend)
Um das inhaltliche Profil von Familienzentren näher darzustellen, sollen im Folgenden die Aufgabenfelder und Angebotsschwerpunkte sowie die Ziele und Zielgruppen von Familienzentren näher beschrieben werden.
3.3.1. Aufgabenfelder und Angebotsschwerpunkte von Familienzentren
Beziehungsgestaltung und Kommunikation zwischen Institution und Familie
Vertrauen, Akzeptanz und Wertschätzung sind erfolgskritische Faktoren und Voraussetzungen dafür, dass Familien das Angebot einer Einrichtung annehmen und erreicht werden. Anstatt Eltern mit Ratschlägen, Patentrezepten und Regeln gegenüber zu treten, zieht heute immer mehr das Verständnis von Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft in die Kindertageseinrichtungen ein, welches Wertschätzung und einen vertrauensvollen Umgang zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern signalisiert, anstatt letztere zu Objekten pädagogischer Belehrung zu degradieren. Diller & Schelle machen jedoch darauf aufmerksam, dass die Beziehungsdynamik zwischen Institution und Eltern von einer Komplexität und Ambivalenz geprägt ist, die Spannungsfelder mit sich bringt und zu Konflikten führen kann. Insbesondere unterschiedliche Wertorientierungen sind eine häufige Ursache von Konflikten, da die Themen Familie, Erziehung und Elternschaft stark emotional besetzt sind. Auch pädagogische Fachkräfte bewerten ihre eigenen biographischen Erfahrungen und die daraus erwachsenen Werthaltungen und inneren Bilder von Familie und Elternschaft oftmals höher als ihr Professionalisierungswissen aus der Ausbildung. Umso stärker sich diese Normen und Werte von jenen der Eltern unterscheiden, desto größer ist das Konfliktpotential sowie die Notwendigkeit eines reflektierten Umgangs der Fachkräfte mit den Eltern. Das bedeutet, dass Fachkräfte für den Aufbau von positiven Beziehungen insbesondere bei Eltern, die sich in ihren Einstellungen stark von den eigenen unterscheiden, einen professionsgeleiteten Umgang pflegen müssen. Aus diesem Grund bezeichnen Diller und Schelle das kommunikative Verhältnis bzw. die Partnerschaft zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften als asymmetrisch, denn letztere tragen die Verantwortung für die Gestaltung des Kommunikationsprozesses. (Vgl. Diller & Schelle 2009: 29 ff.)
"Sie kommunizieren in ihrer professionellen Rolle, die Eltern in ihrer Rolle als Privatpersonen. Dies hat z.B. eine wichtige Bedeutung bei Konflikten: Eltern 'dürfen' Ärger spontan äußern, Mitarbeiter/innen brauchen einen reflektierten Umgang mit ihren eigenen ärgerlichen Impulsen." (Diller & Schelle 2009: 32)
Fortbildungen und Supervisionen bieten einen guten Rahmen, um sich darüber auszutauschen, seine eigenen Werthaltungen und inneren Bilder von Familie und Elternschaft zu reflektieren sowie Kenntnisse und Kompetenzen in den theoretischen und praktischen Bereichen einer professionellen Kommunikation und Interaktion mit Eltern zu sammeln. (Vgl. Diller & Schelle 2009: 32)
Angebote für Familien in verschiedenen Bereichen und Lebenslagen
Diller und Schelle fassen die verschiedenen Angebotsfelder in Familienzentren in einer Tabelle zusammen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Vgl. Diller & Schelle 2009: 33)
Eine weitere Differenzierung möglicher Angebote und Angebotsschwerpunkte ist in Kapitel 5.5.3. (Qualitätskriterien für Angebote und Maßnahmen von Familienzentren, die über den Kernbereich der Kindertagesstätten hinaus gehen) nachzulesen.
Kooperation und Vernetzung im Sozialraum
Familienzentren nehmen in ihrem Sozialraum eine zentrale, koordinierende Rolle ein. Dabei kooperieren sie eng mit den weiteren familienunterstützenden Diensten ihres Sozialraums und bilden das Zentrum bzw. den Motor eines sozialräumlichen Netzwerks für Familien, das bedarfs- und sozialraumorientiert sowie niederschwellig arbeitet.
(Siehe auch Kapitel 3.5.: Kooperation und Netzwerkarbeit: Das Familienzentrum als Knotenpunkt eines sozialräumlichen Gesamtnetzwerks für Familien).
3.3.2. Welche Ziele haben Familienzentren?
Die Ziele von Familienzentren sind vielfältig. Das Landesprojekt Familienzentren NRW identifiziert sein übergeordnetes Ziel in der Zusammenführung von Bildung, Erziehung und Betreuung als Kernaufgabe der Kindertagesstätten mit Angeboten der Beratung und Hilfe für Familien, damit die Förderung der Kinder und die Unterstützung von Familien Hand in Hand entwickelt werden kann. Hinter diesem Ziel, so die Autoren der Handreichung von 2008, steht die Erfahrung, dass familienunterstützende Angebote besonders dann hilfreich sind, wenn sie aus einer Hand angeboten sowie wohnortnah und niederschwellig organisiert werden. Diese Angebotskombination hat gemäß dem nordrhein-westfälischen Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration (MGFFI NRW) folgende Ziele:
- „Sprachdefizite früher festzustellen und durch eine individuelle Förderung systematisch abzubauen,
- Stärken und Schwächen der Kinder früher zu erkennen und Eltern in Fragen der Erziehung, Bildung, Gesundheit etc. gezielter und bereits sehr früh Beratung anzubieten,
- Kindertageseinrichtungen zu Bildungs- und Erfahrungsorten für Kinder und ihre Eltern weiterzuentwickeln und damit auch Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken,
- Eltern bei der Überwindung von Alltagskonflikten dadurch zu unterstützen, dass ihnen Hilfen unmittelbar und ohne Hemmschwelle zugänglich gemacht werden,
- Zuwandererfamilien und Familien aus bildungsfernen Schichten besser anzusprechen,
- insgesamt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern,
- durch eine Öffnung der Angebotsstruktur – unter Einbeziehung der Familien – mehr Variabilität in den Betreuungszeiten zu schaffen und Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung von Tagesmüttern und -vätern zu bieten.“ (MGFFI NRW 2008: 7)
Diese Zielformulierungen machen deutlich, dass das MGFFI NRW größtenteils von Familienzentren ausgeht, die sich aus dem Kerngeschäft der Kindertageseinrichtung heraus entwickelt haben und ihren Schwerpunkt auf die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten sechs bzw. zehn Lebensjahren legen. Die familienunterstützenden Angebote haben in diesem Kontext eine dienende Funktion in Bezug auf die Kernaufgabe der Kindertagesstätten und erfüllen keinen Selbstzweck (siehe auch Kapitel 3.4. Organisationsmodelle und Angebotsprofile von Familienzentren). Erweitert man den Blickwinkel jedoch auf eine ganzheitlichere, stärker gemeinwesenorientierte und sozialraumbezogene Sichtweise, kommen weitere Ziele hinzu:
- Das Prinzip der Bildungs- und Erziehungspartnerschaften in Familienzentren führt zu einer Kommunikation auf Augenhöhe sowie zu gegenseitiger Wertschätzung, Akzeptanz und einem ressourcenorientierten Blick auf Eltern und ihre Kinder
- Eltern und Familien finden die alltagsnahe Unterstützung, die sie brauchen und werden in ihrer Erziehungs- und Selbsthilfekompetenz sowie in ihrer psychischen Stabilität gestärkt
- Durch die enge Kooperation und Netzwerkarbeit der einzelnen familienunter-stützenden Dienste mit dem Familienzentrum als Netzwerkzentrum entsteht ein integriertes Handlungskonzept, dass Synergien ermöglicht und die Ressourcen der einzelnen Netzwerkpartner gegenseitig nutzbar macht
- Das Familienzentrum ist ein Ort der Begegnung. Es bietet Familien vielfältige Kontaktmöglichkeiten und fängt das Wegbrechen natürlicher familiärer Netzwerke auf.
- Das Familienzentrum fördert die soziale Integration exkludierter und stigmatisierter Bevölkerungsschichten (Senioren, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, bildungsferne und sozial benachteiligte Familien etc.) und fördert den interkulturellen Dialog
- Das Familienzentrum sorgt für eine übersichtliche und bedarfsgerechte Angebotsstruktur und vermittelt Familien die Unterstützung, die sie brauchen
- Das Familienzentrum bietet vielfältige Partizipationsmöglichkeiten, fördert das soziale und gesellschaftliche Engagement der Bewohner und führt zu einer stärkeren Identifikation der Menschen mit ihrem Sozialraum
3.3.3. Was sind Zielgruppen (Gender, Race, Class, Disability)
Ein Familienzentrum muss mit seinem Konzept alle relevanten Gruppen seines Sozialraums erfassen, seine Arbeit jedoch gleichzeitig zielgruppendifferenziert akzentuieren. Ein erster wichtiger Bereich ist dabei die Differenzierung des Angebots nach Geschlecht im Sinne des Gender Mainstreaming: Da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt, müssen bei der Konzeptgestaltung gleichermaßen die unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Frauen und Männern in der Struktur der Einrichtung, der Gestaltung der Prozesse und Angebote sowie in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt werden. Somit ist es auch Aufgabe eines Familienzentrums, sich aktiv für die gesellschaftliche und soziale Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen. Ein weiterer Bereich, in welchem die familienunterstützenden Angebote differenziert werden müssen, ist das Lebensalter der Familienmitglieder innerhalb eines Sozialraums. So muss sichergestellt werden, dass es im Sinne einer Präventions- und Bildungskette eine vollständige Reihe von Präventions-programmen gibt, welche die gesamte Entwicklung von Kindern und Jugendlichen abdeckt. Hinzu kommen Angebote der Erwachsenenbildung sowie Generationen übergreifende Angebote. Ein dritter wichtiger Bereich sind die Lebenslagen von Familien. So muss das Angebot von Familienzentren auch die Milieus und die sozialstatistischen Besonderheiten wie Einkommen, Armut, Wohnen, Migration, Bildungspartizipation, Behinderung u.ä. berücksichtigen. (Vgl. Stange 2012d: 520)
In Kapitel 5.3. dieser Arbeit wird zwischen vier markanten Zielgruppen unterschieden, welche jeweils genauer beschrieben und in sich nach Milieu weiter differenziert werden:
- Gut situierte, bildungsnahe Familien
- Sozial benachteiligte und bildungsferne Familien
- Familien mit Migrationshintergrund
- Familien mit Kindern mit Behinderung und/ oder sonderpädagogischem Förderbedarf
Neben den zielgruppenspezifischen Besonderheiten gibt es auch sozialraumspezifische Besonderheiten, die bei der Konzeptgestaltung berücksichtigt werden müssen. So bestehen bspw. zwischen dem ländlichen und dem städtischen Raum erhebliche Unterschiede, was die Bedarfe und Lebenslagen von Familien sowie die örtlichen Strukturen und Ressourcen betrifft.
(Zu den Besonderheiten des ländlichen Raums siehe auch Kapitel 5.3.1.)
3.4. Organisationsmodelle und Angebotsprofile von Familienzentren
Es gibt unterschiedliche Formen und Modelle von Familienzentren, die nachfolgend kurz vorgestellt werden sollen. Da sich die Quellentexte aus Nordrhein-Westfalen fast ausschließlich auf Familienzentren beziehen, die sich aus einer Kindertageseinrichtung heraus entwickeln, steht diese Variante bei der Erklärung der Modelle im Vordergrund. Die unterschiedlichen Modelle sind jedoch auch auf andere Einrichtungstypen von Familienzentren zu übertragen.
Zunächst sollen folgende drei Grundformen von Familienzentren vorgestellt werden:
- Das Modell Unter einem Dach bzw. Zentrumsmodell
- Das Modell Galerie bzw. Kooperationsmodell
- Das Modell Lotse
Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Formen von Familienzentren, die quer zu den bereits genannten Modellen liegen und deshalb auch als Querschnittsformen zu bezeichnen sind:
- Das Verbundsystem und
- Die Kindertageseinrichtung Plus
Das Verbundsystem hat deshalb eine querliegende Dimension, da es sowohl aus Einrichtungen mit Galeriemodell als auch aus Einrichtungen mit Lotsen-Modell oder einer Mischung aus beidem bestehen kann. Die Kindertageseinrichtung Plus wird hingegen als Querschnittsform bezeichnet, da sie den Status Familienzentrum im eigentlichen Sinne und die damit verbundenen Funktionen im Sozialraum nicht vollständig erfüllen kann.
Zusätzlich zu den Organisationsformen können sich Familienzentren auch in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung unterscheiden. Zwei Profile von Familienzentren sind hier zentral und sollen ebenfalls im folgenden Abschnitt vorgestellt werden:
- Early Excellence Centres
- Lebensalter übergreifende Jugend- und Familienhilfe
Grundmodelle für Familienzentren
Modell Unter einem Dach bzw. Zentrumsmodell:
Bei diesem Modell werden alle Hilfs- und Beratungsangebote für Familien unter dem Dach der Kindertagesstätte von einem Träger, an einem Ort und unter einer umfassenden Leitung realisiert. Das bedeutet, das komplette Angebot des Familienzentrums findet in den Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung statt, wird i.d.R. von der Leitung der Einrichtung koordiniert sowie schwerpunktmäßig vom eigenen Personal begleitet bzw. durchgeführt. Diese Voraussetzungen ermöglichen ein ganzheitliches, verlässliches Konzept sowie ein professionelles, niederschwelliges Angebot auf hohem Standard. Vorbild für diesen Einrichtungstyp sind die stadtteilbezogenen Sozialzentren, die aus der Gemeinwesenarbeit heraus entstanden sind und sich überwiegend in sozial benachteiligten Stadtteilen oder Regionen finden. Ziel dieser Zentren ist es, auch Familien in schwierigen Lebenslagen eine umfassende und niederschwellige Unterstützung zu ermöglichen, die durch klassische Angebote oft nur schwer oder gar nicht erreicht werden. (Vgl. MGFFI NRW 2008: 9)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Modell Unter einem Dach / Zentrumsmodell (vgl. MGFFI NRW 2008: 8)
In Nordrhein-Westfalen ist das Zentrumsmodell unter den zertifizierten Familienzentren nur schwach vertreten, da die räumlichen, personellen, strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen von Kindertageseinrichtungen nicht so einfach zu erbringen sind. Auch größere Träger stoßen hier häufig an ihre Grenzen und haben nicht immer alle erforderlichen Angebote in ihrem Portfolio. Darüber hinaus setzt das Modell größere Sozialräume mit entsprechenden Fallzahlen voraus, was insbesondere im ländlichen Raum nicht immer gegeben ist und zu Abstrichen in der Alltagsnähe des Settings führt. Wenn, dann findet es sich am ehesten in sozial benachteiligten Regionen mit der Tradition einer integrierten und umfassenden Gemeinwesenarbeit. (Vgl. MGFFI NRW 2008: 16, Stange 2012a [u.M.]: o.S.)
Modell Galerie bzw. Kooperationsmodell
Das Familienzentrum hält hier verschiedenste Angebote unter dem Dach der Kindertageseinrichtung vor, die schwerpunktmäßig von externen Fachkräften in den Räumen der Einrichtung durchgeführt werden. Dabei sind die Anbieter jeweils selbst für ihre Angebote verantwortlich. Zusätzlich kann es ergänzende Angebote im unmittelbaren Umfeld geben. Insgesamt richten sich die Angebote nach den örtlichen Notwendigkeiten und den räumlichen Möglichkeiten der Einrichtung und werden punktuell bzw. stundenweise angeboten. An der Organisation der Angebotserstellung, -planung und -koordination sind immer mehrere Partner beteiligt. (Vgl. MGFFI NRW 2008: 14 f.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Modell Galerie / Kooperationsmodell (vgl. MGFFI NRW 2008: 15 f.)
Auch das Galerie-Modell ist unter den zertifizierten Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen eher selten zu finden, da auch hier schon tradierte und gewachsene Angebotskonzepte von Trägern vorhanden sein müssen, die weit über die klassischen Aufgaben von Kindertageseinrichtungen hinausgehen. (Vgl. MGFFI NRW 2008: 16)
Modell Lotse
Beim Modell Lotse vermittelt die Kindertageseinrichtung die Hilfesuchenden an ein räumlich nahe gelegenes Angebot weiter. Sie ist die erste Anlaufstelle für Familien mit Problemen und bildet das Zentrum bzw. den Motor eines Netzwerks von familienunterstützenden Diensten, die inhaltlich eng miteinander kooperieren und ihr Angebot aufeinander abstimmen. In anderen Worten: Die Tageseinrichtung organisiert „[...] einen Kooperationsverbund mit unterschiedlichsten Diensten, die eigenständig arbeiten und miteinander kooperieren“ (MGFFI NRW 2008: 11). Dabei schließt das Familienzentrum Kooperationsvereinbarungen mit seinen Partnern, um die benötigten Leistungen für Familien verlässlich sicherzustellen. Das Lotsen-Modell kann darüber hinaus auch mit Galerie-Modell kombiniert werden. Unter den zertifizierten Familienzentren in Nordrhein-Westfalen überwiegt Modell Lotse zahlenmäßig deutlich gegenüber den anderen Modellen, da es insbesondere von den räumlichen, strukturellen und personellen Ressourcen her auch von einer klassischen Kindertageseinrichtung umgesetzt werden kann. Auch bei diesem Modell ist jedoch die Netzwerksteuerung von zentraler Bedeutung und bedarf gesonderter personeller und finanzieller Ressourcen. (Vgl. MGFFI NRW 2008: 14 ff.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Modell Lotse (vgl. MGFFI NRW 2008: 12)
Querschnittsformen von Familienzentren
Verbundsystem
Bei einem Verbundsystem schließen sich mehrere Kindertageseinrichtungen in einem Sozialraum zu einem Verbund zusammen und bilden gemeinsam ein Familienzentrum. Darüber hinaus kooperieren die einzelnen Verbundeinrichtungen mit weiteren Partnern, die selbst keine Kindertagesstätten sind. Voraussetzung für die Zertifizierung in Nordrhein-Westfalen ist, dass bestimmte Grundleistungen von jeder Verbundeinrichtung vorgehalten werden, damit die erforderlichen Kernfunktionen für Familien in allen beteiligten Einrichtungen verfügbar sind. Die Größe eines solchen Verbunds ist in Nordrhein-Westfalen auf max. fünf Einrichtungen beschränkt, da
- "der sozialräumliche Bezug dadurch erhalten bleibt,
- die Angebotsstruktur für die Familien noch übersichtlich ist,
- die Verantwortungsstruktur noch überschaubar bleibt und
- das Zertifizierungsverfahren noch handhabbar ist." (MGFFI NRW 2008: 16)
Darüber hinaus müssen die Einrichtungen zu ortsteilbezogenen Gruppen zusammengefasst werden und alle Angebote des Verbunds müssen allen beteiligten Einrichtungen zugänglich sein. (Vgl. MGFFI NRW 2008: 16 f.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Verbundsystem (vgl. MGFFI NRW 2008: 17)
Da ein Netztwerk nicht ohne Netzwerksteuerung funktioniert, ist es bei diesem Modell besonders wichtig, dass eine der Verbundeinrichtungen die Leitfunktion und das Netzwerkmanagement übernimmt (Planeten-/ Trabantenmodell). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Einrichtung den anderen in einem hierarchischen Sinne übergeordnet ist, sondern nur, dass sie insgesamt dafür verantwortlich ist, die Übersicht zu behalten und die Fäden zusammenzuführen. Alle Verbundeinrichtungen arbeiten auf Augenhöhe. (Vgl. Stange 2012a [u.M.]: o.S.)
Kindertageseinrichtung Plus
Das Modell Kindertageseinrichtung Plus ist ein Modell zum Starten für Einrichtungen, die sich schrittweise weiterentwickeln und stärker für die ganze Familie öffnen möchten. In diesem Sinne werden in der Kindertagesstätte schrittweise Zusatzleistungen und punktuelle familienorientierte Angebote erbracht, soweit die Einrichtung dies mit eigenen Kräften und Ressourcen aktuell schaffen kann. Die Angebote werden i.d.R. von der Leiterin oder dem Leiter der Tageseinrichtung koordiniert und schwerpunktmäßig vom eigenen Personal begleitet bzw. durchgeführt. (Vgl. Diller 2006: 22 f.)
Tatsächlich befindet sich eine Vielzahl der Einrichtungen, die sich selbst als Familienzentrum bezeichnen, auf dem Niveau einer Kindertageseinrichtung Plus. Ein Vorteil dieser Organisationsform ist die enge inhaltliche und organisatorische Verzahnung der Angebote im Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder mit den Familien ergänzenden Angeboten der Einrichtung. Eine Gefahr kann jedoch sein, dass sich die Einrichtungen mit dem Projekt Familienzentrum insgesamt überheben und überfordern, da ihnen keine oder nur wenige zusätzliche Ressourcen und Kompetenzen für die familienorientierte Arbeit zur Verfügung stehen. Auch die zentrale Aufgabe der Netzwerkarbeit und -steuerung kann eine solche Einrichtung nicht ohne zusätzliche Ressourcen erfüllen.
Profile von Familienzentren
Neben den genannten Organisationstypen lassen sich Familienzentren auch nach ihrem inhaltlichen Profil unterscheiden. So entstehen die folgenden zwei Grundmuster:
Early Excellence Centre
Bei diesem Profilmuster konzentrieren sich alle Aufgaben und Ziele auf die Kernaufgabe der Kindertagesstätte, also der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in den ersten sechs bzw. zehn Lebensjahren, wenn man den Hort dazurechnet. Alle weiteren Angebote haben nur eine dienende Funktion in Bezug auf die Kernaufgabe bzw. einen direkten Einfluss auf diese. Am stärksten scheint dieses Profilmuster in den Organisationsmodellen Galerie und Kindertagesstätte Plus durch, z.T. ist es auch im Lotsen-Modell zu finden.
Ein Vorteil dieses Ansatzes liegt in seiner Profilbildung und der Fokussierung auf die Kernaufgaben der Kindertagesstätte. Da auch das Personal im Wesentlichen für diesen Bereich ausgebildet wurde, erleichtert dieser Fokus auch das Verständnis der Prozesse und es besteht weniger die Gefahr der Überforderung durch ein Einsteigen in Fachgebiete, für die man nicht kompetent qualifiziert wurde. Dennoch können auch familienorientierte Angebote, die der Kernaufgabe dienen, in bestimmten Bereichen deutlich über den eigentlichen frühkindlichen Bildungsprozess hinausgehen und in Zonen eindringen, die bisher anderen Professionen vorbehalten sind, was zu einer Zunahme der Komplexität der Prozesse sowie zu gelegentlicher Überforderung des Personals führen kann. Darüber hinaus kann durch die starke Abkoppelung von der Lebensalter übergreifenden Jugend- und Familienhilfe ein Spannungsverhältnis entstehen zu den in diesem Bereich bereits vorhandenen Systemen und Organisationen (z.B. zu den Sozialraumbüros). (Vgl. Stange 2012a [u.M.]: o.S.)
Lebensalter übergreifende Jugend- und Familienhilfe
Das Profilmuster der Lebensalter übergreifenden Jugend- und Familienhilfe versteht sich als Angebot, dass die ganze Familie, also auch Geschwister, Eltern und andere Familienmitglieder in Fragen unterstützt, die z.T. über die eigentliche Kernaufgabe der Kindertagesstätte hinausgehen, wie z.B. Schuldnerberatung oder die Kooperation mit der ARGE. Diese Aufgaben werden auch dann wahrgenommen, wenn sie keinen unmittelbaren Einfluss auf die Kernfunktion haben. Am häufigsten findet sich dieses Profilmuster in den Organisationsformen Unter einem Dach sowie im Lotsen-Modell, teilweise auch im Galerie-Modell. Besondere Vorteile sind die starke Sozialraumorientierung, die Professionalität durch gemischte Teams sowie niederschwellige Hilfen aus einer Hand. Darüber hinaus kann durch die Integration der Hilfen zur Erziehung eine relativ sichere Finanzierung erreicht werden. Eine Gefahr kann jedoch sein, dass sich die Einrichtungen zu stark von der frühkindlichen Bildung entfernen und die universelle Prävention, die allen Familien und nicht nur den Problemfällen zugute kommt, durch den hohen Anteil an selektiven, indizierten Interventions-Maßnahmen zu kurz kommt. (Vgl. Stange 2012a [u.M.]: o.S.)
3.5. Kooperation und Netzwerkarbeit: Das Familienzentrum als Knotenpunkt eines sozialräumlichen Gesamtnetzwerks für Familien
In Kapitel 3.1. wurde bereits die Notwendigkeit genannt, dass Familienzentren in einem größeren Gesamtzusammenhang zu betrachten sind und ein systemischer, ganzheitlicher Blick an die Stelle einer rein einrichtungsbezogenen Sichtweise treten muss. Denn Familienzentren erfüllen eine wichtige Funktion in ihrem Sozialraum: Sie sind der Knotenpunkt eines sozialräumlichen Gesamtnetzwerks für Familien. Was genau ein Gesamtnetzwerk ausmacht, wie und von wem es gesteuert werden sollte und welche Rolle Familienzentren in diesem Zusammenhang einnehmen, soll im Folgenden näher erläutert werden.
3.5.1. Die Notwendigkeit einer Gesamtstrategie
Im Praxisfeld der familienunterstützenden Dienste gibt es eine große Vielfalt an spannenden Angeboten, Konzepten und Programmen, sodass es in der Summe in vielen Regionen an unterschiedlichen Angeboten für Eltern, Kinder und Familien häufig nicht mangelt. In diesem ausdifferenzierten System unterschiedlicher Träger und Institutionstypen fehlt es jedoch insgesamt deutlich an Struktur und Verbindung der einzelnen Initiativen untereinander, sodass diese häufig aneinander vorbei arbeiten und wenig aufeinander bezogen sind. Viele Akteure agieren isoliert auf so genannten operativen Inseln und ihre Dienstleistungen werden funktions- und hierarchiebezogen zerstückelt. Die Versäulung der Angebotsstruktur, gegenseitige Abschottung, abgrenzende Zuständigkeiten und fehlende Transparenz zwischen den verschiedenen Ressorts, Trägern und Institutionen sind die Folge der mangelnden Kooperation und es kommt zu Kommunikationsschwierigkeiten, Widersprüchen, Interessensunterschieden und Informations-verlusten. Nicht zu Schweigen von den vermeidbaren, zusätzlichen Kosten, die durch Angebotsdoppelungen und Überschneidungen sowie durch fehlende Synergieeffekte verursacht werden. Darüber hinaus wird die Lösung komplexer, multidimensionaler Problemlagen, die eine umfassende und differenzierte Gesamtreaktion erfordert, durch die Konzentration auf isolierte Einzelansätze verhindert. (Vgl. Stange 2012c: 31 ff.; Diller & Schelle 2009: 26)
Ein weiteres Problem ist die Unübersichtlichkeit der verschiedenen Angebote und die daraus resultierende Orientierungsunsicherheit vieler Familien. Sie finden sich in dem unübersichtlichen Angebotssystem nur schlecht zurecht und finden entweder gar nicht oder nur mit großem Aufwand oder Glück das Angebot, das sie tatsächlich brauchen. Allein diese Umstände können für viele Hilfesuchende eine Hürde darstellen, die zum Abbruch oder gar zur Verhinderung der Suche führt, insbesondere dann, wenn Sprachbarrieren eine Orientierung zusätzlich erschweren. Doch nicht nur den Familien, auch den einzelnen familienunterstützenden Akteuren fehlt es häufig an einer Gesamtübersicht und Kenntnis der möglichen Angebote vor Ort, sodass Familien oftmals nicht umfassend und bedarfsgerecht beraten und weitervermittelt werden können. So entstehen Fehleinschätzungen der unübersichtlichen Lage, die wiederum zu Fehlentscheidungen und -handlungen sowie zur Wahl falscher Strategien und Methoden führen. (Vgl. Stange 2012c: 31 ff.)
Das Kernproblem dieser Situation ist, dass das Gesamtsystem in seiner Struktur, sowie in seiner Rechtslage für viele Akteure schwer zu durchschauen ist, da die rechtlichen und finanziellen Einzelsysteme und Akteure sehr heterogen, schwer verständlich und wenig aufeinander bezogen sind. (Vgl. Stange 2012c: 31 ff.)
Bereits in den 1980er und 90er Jahren wurden Vernetzung und Kooperation als Erfolgskriterien für effektives Arbeiten verstanden und eine systematische Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren angeregt und auch in der wissenschaftlichen Diskussion herrscht Konsens über die Bedeutung des Kooperationsgedankens. Durch eine systematische Kooperation sollen „[...] die Verinselung der einzelnen Angebotssäulen gelockert und die unterschiedlichen Stärken der Einrichtungen gemeinsam genutzt werden können“ (Diller & Schelle 2009: 26). In der Praxis haben diese Erkenntnisse jedoch noch keine Breitenwirksamkeit erreicht und die Erwartungen der 80er und 90er Jahre wurden nicht flächendeckend umgesetzt. Nach wie vor herrscht ein starkes Säulendenken vor mit einer Fixierung der Akteure auf die jeweils eigene Säule (Jugendhilfebereich – Kita-Bereich – Schule – Sozialhilfesystem). (Vgl. Stange 2012c: 31 ff.; Diller & Schelle 2009: 26)
Die dargestellte Situation macht deutlich, dass es regionale Gesamtstrategien braucht, welche die verschiedenen familienunterstützenden Angebote im Sozialraum koordinieren und aufeinander abstimmen sowie Synergien zwischen den Aktivitäten der einzelnen Institutionen, Einrichtungen und Dienste ermöglichen. Die kreative Nutzung ganzheitlicher Erkenntnisse und integrierter Handlungsstrategien sowie die Bündelung von Ressourcen und deren gegenseitige intelligente Nutzung lassen mittelfristige (finanzielle) Entlastungen entstehen, wie Stange in seinem Plädoyer für intelligentere Netzwerkstrukturen und Gesamtkonzepte deutlich macht:
„Wir haben ja bereits alles, was wir brauchen! Wir müssen auch nicht zusätzliche Kosten verursachen, können im Gegenteil Kosten sparen. Wir müssen 'lediglich' intelligente Netzwerkstrukturen und Gesamtkonzepte aufbauen und steuern, die sich zu einer Kommunalen Bildungs- und Präventionskette von 0 – 18 (27) verdichten!“ (Stange 2012d: 526)
Wichtig dabei ist, dass die Gesamtkonzepte optimal an die lokalen Bedingungen angepasst sind und eine maßgeschneiderte Profilbildung stattfindet. Dies bedeutet, dass die jeweiligen Strukturen und Problemlagen vor Ort genau analysiert werden müssen und darauf aufbauend gemeinsam entschieden werden sollte, was das Wichtige und Richtige ist. Die gesamte Vielfalt und Widersprüchlichkeit des Feldes muss geordnet und in einen Gesamtzusammenhang gebracht werden. (Vgl. Stange 2012d: 519)
Da nicht davon auszugehen ist, dass sich die strukturellen Verhältnisse der Teilsysteme zueinander fundamental ändern lassen, muss eine nachhaltig zu verankernde Netzwerkstrategie entwickelt werden, welche die Kooperationen und Beziehungen der einzelnen Teilsysteme zueinander in markanter Weise weiterentwickelt. Wichtige Voraussetzungen für ein gelingendes Zusammenspiel der einzelnen Akteure, Einrichtungen und Institutionen sind eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung sowie die Formulierung von und die Fokussierung aller Beteiligten auf gemeinsam geteilte Ziele und auf das zu entwickelnde Gesamtkonzept. (Vgl. Stange 2012c: 31 ff.)
3.5.2. Zentrale Prinzipien und Elemente einer kommunalen Gesamtstrategie bzw. eines Gesamtkonzepts
Stange spricht im Kontext von Gesamtstrategien von drei zentralen Säulen, die jeweils für sich ein großes, rechtlich und finanziell besonders abgegrenztes und abgesichertes System darstellen:
- Der Kernbereich der Kinder- und Jugendhilfe
- Kindertagesstätten
- Schulen
Da sich diese großen, in sich geschlossenen Systeme in ihren Strukturen nicht (kurzfristig) umfassend ändern lassen, müssen die drei Säulen durch Netzwerkarbeit, Kommunikation und Kooperation stärker miteinander verknüpft sowie gemeinsame Themen und Aufgaben gestaltet werden. Auf diese Weise werden die Ressourcen der einzelnen Teilsysteme für alle nutzbar gemacht, Synergien ermöglicht und es kann effektiv auf gemeinsam geteilte Leitziele hingearbeitet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Die Drei Säulen einer Gesamtstrategie nach Stange (vgl. Stange 2012d: 522)
Der Aufbau von Familienzentren ist ein sinnvoller Weg, um diese drei Säulen noch stärker miteinander zu verbinden und gleichzeitig auch Leistungen und Angebote anderer Systeme mit einzuspeisen, wie bspw. des Sozialhilfesystems, des Jobcenters oder des Gesundheitswesens. So können auch Angebote wie Sozial-, Schuldner- und Rechtsberatung, Weiterbildungen, Ernährungs- und Gesundheitsberatung, aber auch kinderärztliche Untersuchungen und Babykurse in dem besonders niederschwelligen Setting des Familienzentrums für alle Familien zugänglich gemacht werden. (Vgl. Stange 2012d: 525)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Netzwerkverhältnis der Unterstützungsstrukturen für Familien nach Stange (vgl. Stange 2012c: 34)
Die obere Abbildung von Stange macht deutlich, welche Vielfalt an sozialen und bildungsbezogenen Teilsystemen sich auf Familien und Kinder auswirkt und in einem Gesamtnetzwerk für Familien zu berücksichtigen und einzubeziehen ist. All diese Teilsysteme müssen im Sinne eines integrierten Handlungskonzepts zusammenarbeiten und sich gemeinsam auf zentrale, systemübergreifende Ziele verständigen.
Darüber hinaus muss in einer Gesamtstrategie die Vielfalt der (Einzel-)Akteure wie Elternarbeiter, Eltern und Kinder, Kooperationspartner und Stakeholder mit ihren jeweils unterschiedlichen Zugängen und Aktionsfeldern erfasst und berücksichtigt werden. Auch die unterschiedlichen Ausgangslagen, Anlässe und Interessenlagen der einzelnen Akteure sind zu beachten und es muss eine Methoden- und Themendifferenzierung innerhalb des Gesamtsystems ermöglicht werden. (Vgl. Stange 2012d: 520)
Mit Blick auf die Zielgruppen muss eine Gesamtstrategie alle relevanten Gruppen erfassen, ihr Konzept jedoch gleichzeitig zielgruppendifferenziert akzentuieren. Das bedeutet, die familienunterstützenden Angebote müssen hinsichtlich Geschlecht (Gender Mainstreaming), Lebensalter und Lebenslage (Milieus, sozialstatistische Besonderheiten wie Einkommen, Armut, Wohnen, Migration, Bildungspartizipation etc.) differenziert werden, gleichzeitig aber alle Geschlechter, Lebensalter und Lebenslagen in angemessener Weise berücksichtigen. (Vgl. Stange 2012d: 520)
In einem Gesamtkonzept muss die systemische Vielfalt geordnet, systematisiert, organisiert und gesteuert werden. Dies erfolgt auf verschiedenen Ebenen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb 7: Planungsebenen in kommunalen Gesamtsystemen nach Stange (vgl. Stange 2012c: 35)
Der Erfolg und das Gelingen von familienunterstützenden (Präventions-)Maßnahmen darf nicht einfach allein in die Verantwortung der einzelnen konkret handelnden Institutionen gelegt werden. Vielmehr muss auf allen der oben dargestellten Ebenen analytisch, konzeptionell und umsetzungsorientiert agiert werden. Aufgabe der übergeordneten Ebenen ist es dabei, fachlich und wissenschaftlich angemessene Konzepte zu entwickeln und die erforderlichen Strukturen, Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. (Vgl. Stange 2012c: 35 f.)
3.5.3. Netzwerkarbeit im Rahmen eines Gesamtkonzeptes
Stange plädiert dafür, dass sich ein Gesamtkonzept für Familien auf die drei zentralen Säulen Kernbereich der Jugendhilfe, Kindertagesstätten und Schulen konzentriert, diese Säulen jedoch zielgruppendifferenziert konzipiert sein und sich netzwerkartig gegenüber vielfältigen Kooperationen öffnen sollten. Der rein einrichtungsbezogene Blick muss erweitert werden um einen systemischen, ganzheitlichen Blick. Was dabei entsteht, ist ein breit gefächertes Unterstützungssystem für Familien, welches Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Einrichtungen ermöglicht und auch im Gemeinwesen neue Impulse setzt. Stange formuliert daraus den Grundsatz der Hilfen aus einer Hand:
„Es geht um die umfassende Vernetzung sämtlicher Hilfe- und Unterstützungssysteme, um ganzheitliche Hilfen aus einer Hand. Und es geht um eine systematische Gemeinwesenorientierung, den sozialräumlichen Ansatz bei der Kooperation von Bildung und Prävention. Es geht um integrierte Handlungskonzepte, um eine Kultur der Kooperation statt Konkurrenz zwischen allen familien- und kindbegleitenden Diensten 'vor Ort'.“ (Stange 2012d: 526)
In einem Gesamtnetzwerk geht es jedoch nicht um eine allgemeine permanente Kooperation fester Partner zur Gesamtpalette der ständig anfallenden Themen, sondern um eine themenbezogene Netzwerkarbeit. Diese geht über die einzelfallorientierte Hilfe hinaus, sie stellt den Rahmen für die Kooperation vieler verschiedener Individuen und Akteure zur Verfügung. Hier befinden sich alle Beteiligten in einer Win-win-Situation und können einen relevanten Beitrag leisten. Darüber hinaus handelt es sich bei kommunalen Gesamtsystemen um eine Mischung aus einem hierarchischen und einem heterarchischen Netzwerk, da zum einen die öffentliche Verwaltung in Form von Jugendamt, Schulen, Kreisverwaltung etc. zum Netzwerk gehört, zum anderen aber auch freie Träger und Akteure, die nicht in formelle Hierarchien eingebunden sind. Für das Netzwerkmanagement ergeben sich daraus besondere Anforderung an die Koordination und Steuerung des Gesamtnetzwerks, welche wiederum besondere Ressourcen und Kompetenzen erfordern. (Vgl. Stange 2012d: 526 f.)
Nach Hawkins & Catano gehören folgende Elemente zu einer umfassenden lokalen Präventionsstrategie im Sinne einer Präventions- und Bildungskette:
- „eine gemeinsame Definition des Problems
- eine verbindende Vision des angestrebten Wandels
- eine vollständige Reihe von Präventionsprogrammen, welche die gesamte Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erfassen (Präventionskette)
- ein hohes Maß an Koordination und Kooperation unter Professionellen aus sozialen Diensten und Einrichtungen sowie beteiligten Bewohnern
- Fähigkeit zur Mobilisierung von persönlichen und finanziellen Ressourcen“ (Hawkins & Catano 1992, zit. Nach Stange 2012d: 527)
Es muss eine lokal maßgeschneiderte Strategie entwickelt werden, die zum Profil der relevanten Risiko- und Schutzfaktoren des jeweiligen Sozialraums passt, denn diese Profile sehen je nach Sozialraum, Stadtteil oder Gemeinde ganz unterschiedlich aus und erfordern wiederum unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in den Handlungsstrategien. Demnach muss zunächst ein Gebietsprofil entwickelt und ein Konsens über die Gewichtung bzw. Priorisierung der gemeinsamen Ziele hergestellt werden. Im Anschluss daran können in einem Abgleich des identifizierten Bedarfs mit der Ist-Situation Bedarfslücken festgestellt und ein strategischer Stadtteil-Plan entwickelt werden, der klare Zielbeschreibungen enthält. Wichtig dabei ist, dass der Stadtteil-Plan auf den vorhandenen Ressourcen und Strukturen aufbaut und kontinuierlich evaluiert wird (strategisches Monitoring). Stange schlägt hier ein Qualifizierungs-Konzept mit Trainingsmodulen, Handbüchern, Checklisten und Materialien zur Selbstevaluation als festen Bestandteil von Gesamtkonzepten vor. (Vgl. Stange 2012d: 527)
3.5.4. Koordination und Gesamtverantwortung
Viele Bündnisse auf lokaler Ebene bezeichnen sich selbst als Netzwerk, auch wenn sie diesen Status formal gesehen nicht haben. Denn gemäß Stange gibt es unterschiedliche Qualitäten im Verhältnis einzelner Akteure zueinander, die auch als Niveaus oder Entwicklungsstufen interpretiert werden können:
- Koexistenz: Die verschiedenen Präventions- und Bildungsangebote werden separat und nebeneinander her geplant.
- Koordination: Es gibt eine verbindliche Ordnung, in der Aktivitäten abgeglichen, Informationen ausgetauscht und Termine abgesprochen werden, ohne dass sich die grundlegenden Strukturen und Hierarchien ändern. Auf diese Weise entsteht ein gewisser Grad an Optimierungsdruck und Verbindlichkeit.
- Kooperation: Sehr unterschiedliche und selbstständige Partner arbeiten zusammen, indem sie gleichberechtigt kommunizieren und verhandeln sowie Absprachen im Konsens treffen. Die beteiligten Partner übernehmen dabei selbst die Steuerung des Gesamtprozesses sowie die Überwachung der gemeinsamen Aktivitäten und Vereinbarungen.
- Netzwerke: Diese Bündnisse, Zusammenschlüsse, Allianzen etc. werden von gemeinsamen Zielen kooperativ gesteuert und verfügen über eigene, partizipative Steuerungselemente, die flexibel, aber planvoll sind. Das Vorgehen ist gleichzeitig offen und situativ. Stange spricht von einer neuen „[...] Kultur der Kommunikation und Zusammenarbeit mit koproduktiven Interaktions- und Kommunikationsverbünden auf gleicher Augenhöhe und ohne Hierarchien“ (Stange 2012d: 528).
Die Vorteile eines Netzwerks liegen für Stange auf der Hand:
- Orientierung an gemeinsamen Zielen
- Systematische Bündelung der Ressourcen und Kompetenzen im Netzwerk
- Innovationsorientierung
- Nutzen für die beteiligten Partner (vgl. Stange 2012d: 528).
Die Planung und Steuerung solcher Netzwerke ist jedoch aufgrund ihrer Struktureigenschaften objektiv schwer zu realisieren. Zum einen bestehen sie aus den rechtlich abgesicherten Bereichen der Verwaltung und Politik (Ausschüsse, Kreistag, Stadtrat etc.). Zum anderen haben sich jedoch vielerorts ergänzende und vermittelnde Zwischenstrukturen gebildet, die über keine harte rechtliche Substanz und Evidenz verfügen wie bspw. lokale Bündnisse für Familien, Netzwerke Früher Hilfen, Familien-Service-Büros oder auch Familienzentren. Das Problem dieser Bündnisse ist jedoch häufig, dass sie sich bei dem Versuch, neue Organisationsstrukturen aufzubauen, nicht an den bereits vorhandenen Strukturen orientieren und diese nicht integrieren. Stange wirft in diesem Zusammenhang die Frage auf, warum bei diesen Bündnissen nicht auf die bereits vorhandenen, rechtlich und gesetzlich abgesicherten Instrumente der Kinder- und Jugendhilfe zurückgegriffen wird. Er schlägt vor, dass diese Netzwerke unter die Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII fallen könnten und ihnen somit entsprechende Steuerungsressourcen von Seiten der öffentlichen Jugendhilfe zuständen (Gesamtverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe nach § 79 SGB VIII). Auch der in § 80 SGB VIII so stark hervorgehobene Stellenwert der Jugendhilfeplanung ist in der Praxis laut Stange oft kaum zu erkennen und verliert an Bedeutung, obwohl sie als zentrales und wichtiges Instrument zur Planung und Steuerung von sozialräumlichen Gesamtstrategien genutzt werden könnte. (Vgl. Stange 2012d: 528 ff.)
Doch auch wenn es gelingt, ein Gesamtkonzept zu entwerfen, es kann nur greifen, wenn es entsprechend gut implementiert und umgesetzt wird. Stange stellt deshalb 17 verschiedene Prinzipien auf, die für die Effektivität und Effizienz von Gesamtkonzepten von Bedeutung sind:
- Ein Gesamtkonzept muss auf der normativen, der strategischen und der operativen Ebene zielgesteuert sein und normative Vorgaben machen (von den Leitzielen bis zu den Mittler- und Handlungszielen).
- Ein Gesamtkonzept muss lebensphasenstrukturierend gedacht werden, also entlang der Biografie von Kindern und Jugendlichen alle Lebensphasen abbilden. Dabei kann es innerhalb des Gesamtnetzwerks zur Bildung von Schwerpunkt-Netzwerken kommen, die einzelphasenorientiert arbeiten. Familienzentren, die nach dem Early Excellence Ansatz arbeiten und somit ihren Schwerpunkt auf die frühen Jahre richten, können als institutionelle Knotenpunkte solcher Schwerpunkt-Netzwerke fungieren und sie somit effizient und kraftvoll strategisch gestalten. Auch diese Netzwerke müssen sich jedoch auf sinnvolle und transparente Weise in ein kommunales Gesamtnetzwerk einordnen.
- Das Gesamtnetzwerk braucht ein starkes politisches und öffentliches Mandat und muss von der politischen Kommune bzw. der Verwaltung in ausreichendem Maße gestärkt und abgesichert werden.
- Für die Steuerung des Gesamtnetzwerks sind Gremien wie Steuerungsgruppen, Ressort übergreifende Arbeitsgruppen o.ä. zu empfehlen. Um wirkungsvoll zu sein, müssen sie jedoch durch relevante Personen wie EntscheiderInnen, wichtige InformationsträgerInnen oder bedeutende InteressenvertreterInnen besetzt werden, die einen echten Einfluss auf den Prozess haben.
- Alle beteiligten Netzwerke und Bündnisse müssen sämtliche relevanten Akteure, Organisationen und Sozialraum-Schlüsselpersonen umfassen.
- Die Mitglieder des Gesamtnetzwerks müssen davon überzeugt sein, dass es ihnen einen wirklichen Nutzen und Veränderung bringt. Ein unverbindliches Kommunizieren ohne Konsequenzen ist zu vermeiden.
- Es braucht eine umfassende und vollständige Stakeholder-Analyse, um versteckte Widerstände und Konflikte aufzudecken und zu entschärfen.
- Auch in Netzwerken mit flachen Hierarchien braucht es eine effektive Steuerung, der gesonderte Ressourcen zur Verfügung stehen (Netzwerkmanagement, Netzwerkbüro etc.).
- Für das Netzwerkmanagement ist es von Vorteil, wenn es über zu verteilende Ressourcen verfügt und die Kooperationspartner davon profitieren.
- Die Transparenz aller Prozesse hat einen großen Einfluss auf die effektive und motivierende Arbeit des Netzwerks (Informationsfluss, Einflussmöglichkeiten, Kommunikation und Kooperation auf Augenhöhe etc.).
- Es besteht die Gefahr der Verflachung, wenn das Gesamtkonzept nur unvollständig oder reduziert umgesetzt wird.
- Für die Umsetzung des Gesamtkonzepts müssen die erforderlichen Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
- Die Implementation des Programms muss mit einer Qualifizierung und Schulung der beteiligten Akteure einher gehen, um die Umsetzungstreue sowie die langfristig tragende Motivation der Teams zu sichern.
- Es muss geklärt werden, auf welcher der möglichen sozialräumlichen Ebenen gedacht und gehandelt wird. Auf der Kreisebene und der Ebene der kleinräumigen Sozialräume darunter müssen sinnvolle Einheiten gebildet werden, was nicht immer einfach ist. Um wirklich alltagsnahe und lebensweltliche Sozialraumkonzepte zu realisieren, müssen Stadtteile in Quartiere und Kiez-Bezirke untergliedert werden. Insbesondere in ländlichen Gebieten ist es wichtig, bei der Sozialraumbildung nicht nur politische und verwaltungsmäßige Grenzen, sondern auch pragmatische Gesichtspunkte wie etwa ausreichende Fallzahlen zu berücksichtigen.
- Das jeweils besondere Gebietsprofil ist die Grundlage für die Planung des Gesamtkonzepts und muss entsprechend berücksichtigt werden.
- In Präventions- und Bildungsketten muss die besondere Rolle der Eltern transparent und offen gehandhabt werden. Ihnen muss vermittelt werden, „[...] dass es im Interesse aller Kinder in Präventions- und Bildungsketten um sozialökologische Entwicklung mit vielen Lernpartnern geht und auch nicht nur um formelle Bildung, sondern auch um non-formales und informelles Lernen“ (Stange 2012d: 533).
- Um das Ganzheitliche und das Gesamt in dem Konzept auch nachhaltig tragfähig zu halten, braucht es einen Partei, Institutionen, Organisationen, Verbände und Sozialraum übergreifenden Konsens. (Vgl. Stange 2012d: 530 ff.)
Zur übergeordneten Steuerung von Gesamtnetzwerken schlägt Stange zwei Steuerungsschwerpunkte vor, die sich allein schon aus rechtlichen Gründen nicht gegenseitig ersetzen oder vertreten können und jeweils über einen normierten Kooperationsauftrag verfügen: Die Öffentliche Jugendhilfe und die Schulverwaltung auf Kreisebene.
Die zentrale Koordinations- und Steuerungsfunktion der Öffentlichen Jugendhilfe liegt für Stange auf der Hand, da sie gesetzlich für alle Leistungen und Angebote für Kinder, Jugendliche (bis 27 Jahre) und Familien von der Geburt der Kinder an zuständig ist und die gesetzliche Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII inne hat. Auch die Kindertagesstätten fallen in ihren Zuständigkeitsbereich. Darüber hinaus kooperiert sie im Bereich der vorgeburtlichen Betreuung von Eltern bereits mit dem Gesundheitswesen und im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen für behinderte Kinder (SGB XII) mit der Sozialhilfe. Für Stange ist die Gesamtsteuerung und Koordination die natürliche Aufgabe der Jugendhilfeplanung, welche ihm zufolge jedoch vielerorts an einem schleichenden Bedeutungsverlust leide und mit einem viel zu schwachen politischen Mandat ausgestattet sei. Demnach müsse die Jugendhilfeplanung im Sinne einer zentralen Regiestelle oder eines Gesamt-Netzwerkmanagements auf Kreis- bzw. gesamtstädtischer Ebene wiederbelebt und mit zusätzlichen Ressourcen für die Koordination und Steuerung ausgestattet werden. Darüber hinaus plädiert Stange für zusätzliche, dezentralisierte Netzwerkbüros von Seiten der Öffentlichen Jugendhilfe auf sozialräumlicher Ebene, die außerhalb des Jugendamtes niederschwellig arbeiten und mit eigenen räumlichen und personellen Ressourcen ausgestattet sind. Diese Netzwerk- oder auch Sozialraumbüros brauchen einen hohen Grad an Selbstständigkeit und Kompetenzen im operativen Bereich und müssen gleichzeitig in enger Kooperation mit der oberen Planungsebene der Jugendhilfeplanung und der sonstigen Sozialplanung zusammenarbeiten. Im Kontext von Familienzentren kann es z.B. sinnvoll sein, dass ein Mitarbeiter des Jugendamts ein Büro in den Räumen des Familienzentrums hat und von dort aus das sozialräumliche Netzwerk steuert. (Vgl. Stange 2012d: 534)
Die Steuerungsverantwortung des schulischen Bereichs sieht Stange auf Seiten der Schulverwaltung auf Kreisebene, da diese für die Sicherstellung eines ausreichenden schulischen Gesamtangebots zuständig ist. Dabei ist ein starkes rechtliches und politisches Mandat für die Gesamtsteuerung und die Entwicklung von geeigneten Koordinations- und Steuerungselementen für Stange nur herstellbar,
„[...] indem die zentrale Steuerungsfunktion in der Zuständigkeit der Kreisverwaltung […] in Form der Schulverwaltung verbleibt und nicht auf nachgeordnete Vernetzungsgremien übertragen wird. Die Instrumente zur Organisation Lokaler Bildungslandschaften, z.B. Bildungsbüros, sollten sich hier unterordnen und auf sozialräumlicher Ebene operative Koordinations-funktionen übernehmen“ (Stange 2012d: 535).
Die beiden Steuerungsschwerpunkte Jugendhilfe und Schulverwaltung auf Kreisebene müssen eng und kontinuierlich zusammenarbeiten und sich an einem gemeinsamen, übergreifenden Gesamtkonzept orientieren. Darüber hinaus müssen die gewählten Kooperationsformen und Vernetzungsinstrumente mit einem starken politischen und rechtlichen Mandat sowie mit zusätzlichen Ressourcen für die Koordination und Steuerung ausgestattet sein, um ihre Aufgabe effektiv und wirkungsvoll erfüllen zu können. Auf der nächst tieferen Ebene müssen dann die weiteren Ressorts wie das Gesundheitswesen und die Sozialhilfe sowie Stadtplanung, Kultur, Verkehr und Arbeitsverwaltung integriert werden, die aufgrund ihrer geringeren Bedeutung in Bezug auf Umfang, Einfluss, Finanzen und Personal keine Steuerungsfunktion für sich in Anspruch nehmen können. Denn in den jeweiligen Vernetzungsgremien müssen auch sie wahrnehmbar vertreten sein. (Vgl. Stange 2012d: 535)
3.5.5. Familienzentren als Netzwerkzentren
Familienzentren nehmen in sozialräumlichen Netzwerken eine besondere Rolle ein. Auf welcher Ebene sie sich in Bezug auf ein kommunales Gesamtnetzwerk bewegen, hängt u.a. davon ab, ob sie sich wie beim Early Excellence Ansatz auf Familien mit Kindern in den ersten 10 Lebensjahren konzentrieren oder ob sie einen Lebensalter übergreifenden und stärker gemeinwesenorientierten Ansatz wählen.
Familienzentren mit einem Early Excellence Ansatz bzw. einer Schwerpunktsetzung im frühpädagogischen Bereich nehmen eine zentrale und koordinierende Position in einem Schwerpunkt-Netzwerk ein, welches sich wiederum in ein sozialräumliches Gesamtnetzwerk einfügt. Dieses sozialräumliche Gesamtnetzwerk befindet sich auf der Ebene, die direkt unter der des kommunalen Gesamtnetzwerks liegt und ist gleichzeitig Teil dieses kommunalen Gesamtnetzwerks.
Familienzentren mit einem Lebensalter übergreifenden, gemeinwesenorientierten Ansatz sind hingegen prädestiniert dafür, als Ort der sozialräumlichen Gesamtsteuerung der familienunterstützenden Dienste, also als Knotenpunkt des sozialräumlichen Gesamtnetzwerks zu fungieren.
In beiden Fällen müssen besondere Ressourcen und Kompetenzen für die Steuerung des jeweiligen Netzwerks zur Verfügung stehen. Wer das Netzwerkmanagement in den Familienzentren personell übernimmt, muss anhand der jeweiligen Strukturen und Gegebenheiten vor Ort geklärt werden. Eine Möglichkeit ist hier, dass im jeweiligen Familienzentrum ein dezentralisiertes Netzwerkbüro eines Jugendamt-Mitarbeiters eingerichtet wird, sodass dieses auch auf sozialräumlicher Ebene seiner Gesamtverantwortung und Steuerungsfunktion gerecht werden kann.
3.6. Qualitätsentwicklung und Evaluation
Wie in anderen sozialen Kontexten auch, setzt sich die Qualität in Familienzentren aus den drei zentralen Qualitätsdimensionen Struktur-, Ergebnis- und Prozessqualität zusammen. Dabei bezeichnet Strukturqualität die äußeren Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Arbeitsprozesse, die Prozessqualität die Aktivitäten und Handlungen, die zur Leistungserbringung eingesetzt werden und die Ergebnisqualität die Qualität der Leistung bzw. der Arbeitsergebnisse. Diese drei Qualitätsdimensionen sind in allen Qualitätsentwicklungs- und -managementverfahren zu finden, auch wenn sie nicht immer gleich bezeichnet werden (vgl. Diller & Schelle 2009: 129). Bezieht man die drei Qualitätsdimensionen auf ein Familienzentrum, kann das wie folgt aussehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Qualitätsdimensionen eines Familienzentrums (vgl. Diller & Schelle 2009: 129)
Strukturqualität: Gesetzlicher Rahmen, Einrichtungskultur, Zufriedenheit der Mitarbeiter
Prozessqualität: Fachlichkeit und Professionalität, Umsetzung der Trias Bildung, Betreuung, Erziehung
Ergebnisqualität: Zufriedenheit der Eltern und Kinder, Effektivität, Effizienz
Nach Diller und Schelle kommt im Familienzentrum jedoch noch eine vierte, die konzeptionelle Qualitätsdimension hinzu. Diese setzt sich zusammen aus den in der Konzeption festgeschriebenen Angaben zu den Prozessen, den erwarteten Ergebnissen, den handlungsleitenden Richtlinien und Arbeitsprinzipien sowie dem Leitbild und dem Menschenbild der Einrichtung. (Vgl. Diller & Schelle 2009: 130)
Bei der Messung von Qualität sowie bei der Evaluation der Arbeitsprozesse und des Angebots gibt es bestimmte Bezugsgrößen, die herangezogen werden können. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Kundenzufriedenheit. Da jedoch im sozialrechtlichen Bereich die Kunden, also die Eltern und Kinder nicht immer in der Lage sind, angemessen über die Arbeit einer Kita oder einer anderen sozialen Einrichtung zu entscheiden, müssen die Fachlichkeit und die Professionalität im Arbeitsfeld die entscheidenden Bezugsgrößen darstellen. Bei der Evaluation des Angebots eines Familienzentrums können nach Diller neun verschiedene Indikatoren für dessen Wirksamkeit herangezogen werden:
- „Die Inanspruchnahme des Angebots.
- Die subjektive Zufriedenheit der Nutzer mit dem Programmangebot. Da Familien das Angebot freiwillig in Anspruch nehmen, ist ihre subjektive Zufriedenheit ein zentraler Indikator.
- Die Bereitschaft der Eltern, zusätzliche Unterstützungsangebote gegebenenfalls auch an anderen Orten in Anspruch zu nehmen.
- Die Beteiligung an Aktivitäten im Gemeinwesen
- Die Wirksamkeit der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen.
- Die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen.
- Weiterentwicklung des professionellen Selbstverständnisses.
- Entwicklungsfortschritte der Kinder
- Mittelfristige Senkung der Jugendhilfekosten z.B. bei Fremdunterbringung, sozialpädagogischer Familienhilfe, Kosten für 'Hilfen zur Erziehung'. Diese Effekte können aber erst mittel- und langfristig deutlich werden. Kurzfristig könnte auch ein Ansteigen der Fallzahlen ein Erfolgsfaktor sein, z.B. wenn Eltern sich trauen, erforderliche Erziehungsberatung erstmalig in Anspruch zu nehmen.“ (Diller 2006: 70)
Insgesamt haben sich im Bereich der Kindertagesstätten in den letzten Jahren flächendeckend fachlich begründete Qualitätsmaßstäbe etabliert, die verhindern, dass Qualität jeweils willkürlich, individuell und interessenabhängig bestimmt wird. Diese Qualitätsstandards oder auch Qualitätskriterien müssen sich gleichermaßen nach den allgemeinen Kriterien der Fachlichkeit und Professionalität in allen Qualitätsdimensionen richten als auch einrichtungs- und sozialraumspezifische Besonderheiten berücksichtigen. Auch im Bereich der Familienzentren gibt es auf der Ebene einzelner Bundesländer und Städte, wie bspw. in Nordrhein-Westfalen oder Hannover Vorstöße, um einheitliche Qualitätskriterien zu formulieren und zu etablieren. Diese Kriterien fallen jedoch je nach Land, Stadt oder Region in Art und Umfang noch sehr unterschiedlich aus.
Für Kindertagesstätten ist z.T. gesetzlich festgeschrieben, dass der Träger die Qualität seiner Einrichtungen sichern und weiterentwickeln muss, wie bspw. in § 22a SGB VIII. Nach welchen Kriterien und nach welchen Verfahren er dies tut, bleibt jedoch ihm überlassen, was in der Praxis zu einer großen Vielfalt unterschiedlicher Verfahren geführt hat. Hier eine Auflistung von national eingesetzten Qualitätsentwicklungsverfahren für Kindertagesstätten:
- „Kindergarten Skala – Revidierte Fassung (KES-R)
- Nationale Qualitätsinitiative im System der Kindertagesbetreuung
- KTK Gütesiegel des Caritas Bundesverbandes e.V.
- Das PARITÄTISCHE QUALITÄTSSYSTEM: PQS Sys
- QM in Kindertageseinrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO-QM)
- QM in evangelischen Kindertageseinrichtungen: Bundes-Rahmenhandbuch
- Aufbau eines QM-Systems (z.B. nach EFQM) nach den Grundsätzen eines umfassenden Qualitätsmanagements (Total Quality Management)
- Analyse der Prozesse, Erarbeitung eines QM-Handbuches und Strukturierung der betrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation nach den Vorgaben der Bezugsnorm DIN ISO 9000 ff., meist verbunden mit einer entsprechenden Zertifizierung
- Einrichtungsspezifische Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung von Fachlichkeit ohne Bezugnahme auf spezielle Konzepte der Qualitätsentwicklung durch Besprechungen, Berichte, Dienstanweisungen, Supervisionen etc. und durch Bezugnahme auf Konzepte des Sozialmanagements, wie der Organisations- und Personalentwicklung
- Qualitätsentwicklung durch Mischformen verschiedener Ansätze“ (Diller & Schelle 2009: 134)
Für den Fall, dass sich ein Familienzentrum aus einer Kindertageseinrichtung heraus entwickelt, kann das bereits vorhandene Qualitätsentwicklungsverfahren aus der Kita häufig beibehalten werden, da sich die Grundprozesse i.d.R. nicht sehr stark voneinander unterscheiden. Allerdings kann das Handbuch nicht eins zu eins übernommen, sondern muss für die spezifischen Aufgaben eines Familienzentrums weiterentwickelt werden. Auch die Konzeption muss überarbeitet werden, da sie die Grundlage für die handlungsleitenden Fragen ist: „Welche neuen Arbeitsschritte sind in einem Familienzentrum relevant? Welche Schlüsselprozesse verändern sich, welche kommen neu hinzu?“ (Diller & Schelle 2009: 137). So wird sich bspw. bei einer Weiterentwicklung einer Kita zum Familienzentrum sicherlich der Schlüsselprozess Zusammenarbeit mit Eltern verändern und der Schlüsselprozess Netzwerkarbeit und Kooperation mit anderen Institutionen hinzukommen. (Vgl. Diller & Schelle 2009: 137)
Zentral für die Qualitätsentwicklung in Familienzentren ist, dass die Weiterentwicklung der Konzeption sowie die Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots nicht einmalig stattfinden, sondern einen vielschichtigen, systematischen und permanenten Prozess darstellen, der eine ständige Reflexion und Evaluation erfordert, in Abstimmung mit Eltern und Kooperationspartnern. Für diesen Qualitätsentwicklungsprozess gibt es vielfältige Werkzeuge, die in unterschiedlichen Verfahren ihre Anwendung finden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9: Werkzeuge des Qualitätsmanagments (vgl. Diller & Schelle 2009: 135)
Die jüngsten Ergebnisse der Nubbek-Studie zeigen jedoch, dass es nicht ausreicht, ein Qualitätsentwicklungsverfahren zu haben und anzuwenden, wenn es nicht mit der entsprechenden Kompetenz und Konsequenz durchgeführt wird. Denn obwohl es seit Jahren Vorgaben zur Qualitätssicherung in Kindertagesstätten gibt, hat sich in den letzten 15 Jahren an der Qualität unserer Kitas nicht viel verändert. (Vgl. Tietze et al. [Hrsg.] 2012: 8)
Ein Qualitätsentwicklungsverfahren wird nur dann positive Wirkungen zeigen, wenn das gesamte Team eingebunden, engagiert und zu Veränderungen und Innovationen bereit und in der Lage ist. Das bedeutet auch, dass Veränderungen und Erweiterungen der Angebote und Aufgaben von entsprechenden Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen begleitet werden müssen.
3.7. Rechtliche Grundlagen
Im achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) lassen sich eindeutige Angaben finden, welche die Förderung der Erziehung in der Familie, die Zusammenarbeit und Kooperation der verschiedenen familienunterstützenden Dienste sowie die Gesamtverantwortung und Planungsverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe vorschreiben. Diese gesetzlichen Vorgaben unterstreichen die wichtige Rolle und die Grundprinzipien von Familienzentren in besonderem Maße. Denn Familienzentren können durch ihr spezifisches Profil und ihre Organisationsform einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass diese gesetzlichen Vorgaben in einem effizienten, integrierten und ganzheitlichen Rahmen umgesetzt werden, ohne dass weiterhin viele wichtige Ressourcen, Kompetenzen und Synergien verloren gehen bzw. ungenutzt bleiben. Im Folgenden werden einige ausgewählte Paragraphen des SGB VIII vorgestellt, die für das Angebot und die Organisation von Familienzentren von besonderer Bedeutung sind.
Allgemeine Förderung von Kindern und der Erziehung in der Familie (§§ 16, 22 SGB VIII)
In § 16 des SGB VIII steht geschrieben, dass Familien in der Erziehung ihrer Kinder allgemein gefördert werden sowie in ihrer Erziehungsverantwortung und Elternkompetenz gestärkt werden sollen. Dies soll geschehen durch zielgruppendifferenzierte Angebote der Familienbildung und -beratung, durch die Partizipation von Eltern in den Erziehungseinrichtungen, durch die Förderung von Selbst- und Nachbarschaftshilfe sowie durch die Vorbereitung junger Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern. Auch Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung gehören laut Gesetz zu den zu erbringenden Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. (Vgl. § 16 SGB VIII)
Auch in § 22 des SGB VIII wird darauf hingewiesen, dass in Kindertagesstätten die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützt werden soll und bei der Förderung der Kinder die jeweilige Lebenssituation zu berücksichtigen ist. (Vgl. § 22 SBG VIII)
Das Gebot der allgemeinen Förderung von Familien wird von Familienzentren in den Mittelpunkt aller Bemühungen gerückt und neu ausbuchstabiert. Es ist der zentrale Auftrag von Familienzentren und geht in diesem Kontext weit über das hinaus, was Kindertagesstätten mit ihren Mitteln bisher im Rahmen ihrer Elternarbeit leisten können und konnten. Darüber hinaus kann das integrierte und niederschwellige Angebot von Familienzentren aus einer Hand auch Familien erreichen, die mit den herkömmlichen Mitteln der Eltern- und Sozialarbeit nur schwer erreicht werden können. Familienzentren tragen demnach zur verbesserten und breiteren Umsetzung des gesetzlichen Auftrags der Kinder- und Jugendhilfe bei.
Kooperation und Vernetzung (§§ 22a, 81 SGB VIII)
In § 22a SGB VIII wird deutlich gemacht, dass die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen sowohl mit Eltern und Tagespflegepersonen als auch mit Schulen und anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen, insbesondere der Familienbildung und -beratung, zusammenarbeiten sollen. Darüber hinaus soll bei der Integration und Inklusion von Kindern mit Behinderung mit den Trägern der Sozialhilfe kooperiert werden. (Vgl. § 22a SGB VIII)
Laut § 81 SGB VIII haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt. Hierzu zählen laut Gesetz insbesondere die Träger von Sozialleistungen nach dem Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften, Sechsten und dem Zwölften Buch sowie Träger von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, die Familien- und Jugendgerichte, die Staatsanwaltschaften sowie die Justizvollzugsbehörden, Schulen und Stellen der Schulverwaltung, Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie sonstige Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens, die Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Suchtberatungsstellen, Einrichtungen und Dienste zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, die Stellen der Bundesagentur für Arbeit, Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die Polizei- und Ordnungsbehörden, die Gewerbeaufsicht und Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und der Forschung. (Vgl. § 81 SGB VIII)
Auch in diesem Kontext sind Familienzentren ein mehr als geeignetes Mittel, um den gesetzlichen Auftrag der Kooperation und Vernetzung in vollem Umfang zu erfüllen, da sie durch ihre zentrale Funktion als Knotenpunkt und Motor eines sozialräumlichen Netzwerks die systematische Kooperation von familienunterstützenden Diensten sowie die gegenseitige Nutzung von Kompetenzen und Ressourcen sicherstellen.
Planungs- und Gesamtverantwortung der öffentlichen Jugendhilfe (§§ 79, 79a, 80 SGB VIII)
Nach § 79 SGB VIII haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gesamt- und Planungsverantwortung für die Erfüllung aller im SGB VIII genannten Aufgaben und sie müssen die Vollständigkeit und Qualität dieser Angebote im Rahmen einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung sicherstellen (vgl. § 79a). Des Weiteren müssen sie gewährleisten, dass die zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen zur Verfügung stehen und diese die verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung berücksichtigen. (Vgl. § 79 SGB VIII)
Der § 80 des SGB VIII gibt an, welche Bereiche in der Jugendhilfeplanung berücksichtigt werden müssen. Dies umfasst das Feststellen des Bestands an Einrichtungen und Diensten (Sozialraum- bzw. Institutionenanalyse), die Ermittlung des Bedarfs junger Menschen und ihrer Familien unter Berücksichtigung ihrer Wünsche, Bedürfnisse und Interessen (Bedarfsanalyse), sowie die ausreichende und rechtzeitige Planung der Vorhaben, die notwendig sind, um dem Bedarf, den Bedürfnissen und den Interessen von Familien Rechnung zu tragen. Auch ein unvorhergesehener Bedarf muss entsprechend befriedigt werden können. Insgesamt sollen die Einrichtungen und Dienste so geplant werden, dass sie die Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und fördern; die Angebote sollen vielfältig, wirksam und aufeinander abgestimmt sein. Darüber hinaus soll die Jugendhilfeplanung mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen abgestimmt werden. Die Träger der freien Jugendhilfe sind in allen Phasen der Jugendhilfeplanung frühzeitig zu beteiligen. (Vgl. § 80 SGB VIII)
Wie in Kapitel 3.5. bereits erläutert, zeigt ein Blick in die Praxis, dass diese gesetzlichen Vorgaben nicht immer und überall zufriedenstellend erfüllt werden, insbesondere wenn es um die Kooperation der verschiedenen Einrichtungen und Dienste sowie um ein wirksames, aufeinander abgestimmtes Gesamtangebot geht. Wie auch Stange deutlich macht, wäre es wünschenswert, dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe ihre Aufgabe der Jugendhilfeplanung wieder aktiver und umfassender wahrnehmen und im Rahmen von Gesamtkonzepten eine zentrale Koordinations- und Netzwerkfunktion erfüllen. In diesem Kontext braucht es Familienzentren, die auf sozialräumlicher Netzwerk-Ebene eine zentrale Stellung einnehmen und im Sinne des oben genannten Auftrags ein bedarfsgerechtes, niederschwelliges und aufeinander abgestimmtes sozialräumliches Gesamtangebot koordinieren.
3.8. Familienzentren im Spiegel der Forschung
Die Forschung zur Thematik Familienzentren steht noch sehr weit am Anfang und es gibt bislang lediglich vereinzelt aussagefähige Evaluationen zu den Projekten einzelner Städte, Regionen und Bundesländer. Insgesamt ist es schwierig, so komplexe Systeme wie Familienzentren und (Gesamt-)Netzwerke auf ihre genauen Wirkfaktoren hin zu überprüfen, da so viele verschiedene Komponenten und Interventionen berücksichtigt werden müssen, dass kaum festzustellen ist, welches der angewandten Programme tatsächlich hilft. So konnte bislang bspw. noch nicht wissenschaftlich belegt werden, dass sich die stärkere Berücksichtigung des familiären Systems in Familienzentren tatsächlich auf die kognitive Entwicklung der Kinder auswirkt.
Schaut man sich jedoch einzelne Komponenten der Arbeit in Familienzentren an, wird deutlich, dass insbesondere Programme der Elternarbeit und der Eltern- bzw. Familienbildung nachweisbar positive Effekte zeigen. Allerdings sind die Rahmenbedingungen, in denen bestimmte Maßnahmen wirken oder auch nicht wirken, sehr heterogen und nicht immer kausal abzuleiten. In einer Meta-Analyse von Layzer et al. aus 665 Studien, die sich auf insgesamt 260 verschiedene Elternprogramme bezogen, konnten bestimmte Grundvoraussetzungen bestimmt werden, unter welchen die Maßnahmen besonders wirksam waren. So profitierte die Eltern-Kind-Interaktion bspw. stärker von Programmen, „die frühzeitig ansetzen, professionelles Personal haben, Gruppenarbeit anbieten anstatt nur auf Hausbesuche zu rekurrieren, gegenseitige Unterstützung der Eltern fördern und auch Angebote für die Kinder einbeziehen“ (Stange 2012c: 20). Insgesamt erzielte ein kombiniertes Vorgehen die besten Ergebnisse. (Vgl. Stange 2012c: 19 f.)
Für die Wirkungsevaluation von komplexeren Programmen wie Familienzentren, größere kommunale Systemen, Gesamtkonzepte oder Netzwerke bedarf es hingegen noch an geeigneten Forschungsstrategien. Dennoch können sich auch in diesem Kontext durchaus Hinweise und plausible Richtungsaussagen treffen lassen, indem mithilfe einfacher, treffsicherer Indikatoren bestimmte Veränderungen im Gesamtsystem erfasst werden. So konnte bspw. festgestellt werden, dass sich durch das komplexe gemeinwesenorientierte Präventionsprogramm Communities that Care (CTC) in den USA das delinquente Verhalten sowie der übermäßige Alkoholmissbrauch von Jugendlichen deutlich reduziert hatte. Auch das Praxis-Präventionsmodell Monheim für Kinder (Mo.Ki) zeigte positive Effekte, indem die Teilnahme an kinderärztlichen U-Untersuchungen innerhalb von vier Jahren von 76% auf 95% anstieg, der Sprachförderbedarf der Kindern von 59% (2007) auf 27% (2009) sank, die Übergangsquoten im sozial stark benachteiligten Berliner Viertel zur Hauptschule um 11 % sanken und zum Gymnasium um 7,5% stiegen sowie die Fälle in der stationären Heimerziehung von über 50 auf ca. 30 Fälle zurückgingen. In Dormagen schlug sich das dortige, vielschichtig gestaltete Netzwerk früher präventiver Hilfen für Eltern und Kinder in den Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung nieder. So stieg der finanzielle Aufwand im letzten geprüften Jahr in Dormagen nur um rund 7% an, während der Anstieg landesweit rund 27,5% betrug (Stand 2011). (Vgl. Stange 2012c: 21)
Auch wenn diese Ergebnisse keine konkreten Aussagen zu Familienzentren ermöglichen, zeigen sie doch, dass es Hinweise zur Wirksamkeit von netzwerkartigen Gesamtangeboten gibt, welche in ihren Angebots- und Netzwerkstrukturen große Ähnlichkeiten mit Familienzentren aufweisen bzw. Familienzentren in ihre Gesamtstruktur integriert haben. Darüber hinaus gibt es jedoch noch einzelne Evaluationen, die konkretere Aussagen zu Familienzentren im Besonderen treffen. Diesbezüglich sollen im Folgenden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung der Familienzentren in Nordrhein-Westfalen, die Ergebnisse einer Befragung zur Bestandsaufnahme der Familienzentren in Niedersachsen sowie eine Studie zu den Wirkfaktoren der Familienzentren mit Early Excellence Ansatz in Hannover vorgestellt werden.
3.8.1. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung der Familienzentren in Nordrhein-Westfalen
Im Jahre 2006 hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines Pilotprojekts begonnen, die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren zu fördern. Ziel des Ministeriums ist es, in Nordrhein-Westfalen bis Ende 2012 insgesamt ca. 3000 Familienzentren aufzubauen. Während der Pilotphase nahmen 251 Einrichtungen am Zertifizierungsverfahren teil, wovon 26 Beispiel-Familienzentren für eine zweijährige qualitative Untersuchung durch die Pädagogische Qualitäts-Informations-Systeme gGmbH (PädQUIS) unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Tietze ausgewählt wurden. In diesem Sinne wurden Dokumente ausgewertet sowie Interviews geführt mit den Leitungen, den Teams sowie den VertreterInnen der Kooperationspartner, Träger, Jugendämter und Jugendhilfeausschüsse. Die Ergebnisse liefern vielfältige Erkenntnisse über den Prozess der Weiterentwicklung zum Familienzentrum, die Wirkung sowie den Stellenwert der Familienzentren und ihrer Angebote im Sozialraum, aber auch über mögliche Schwierigkeiten und Knackpunkte bei der Umsetzung. (Vgl. MGFFI NRW 2009: 4 ff.)
Kooperation und Vernetzung:
In Nordrhein-Westfalen konnte festgestellt werden, dass die Familienzentren seit Beginn der Pilotphase ihre Zusammenarbeit mit Kooperationspartner signifikant ausgebaut haben und dies zunehmend auch mit Kooperationsverträgen absichern. So hatten die Piloteinrichtungen zum Erhebungszeitpunkt 2008 im Durchschnitt mit 4.3 Kooperationspartnern eine feste Zusammenarbeit vereinbart, während es bei anderen Kindertageseinrichtungen nur 0.9 Kooperationspartner waren. Insgesamt haben sich die Familienzentren gegenüber ihrem Sozialraum weiter geöffnet und auch die Kenntnisse der Teams sind zu dem Sozialraum, in dem sie tätig sind, präziser und detaillierter geworden. Darüber hinaus geben die Leitungskräfte an, dass der Ausbau des Netzwerks ihre Arbeit abwechslungsreicher und interessanter gemacht habe.
Eine große Herausforderung bestand für die Familienzentren jedoch darin, die Bedarfe des eigenen Sozialraums richtig einzuschätzen Dies wurde insbesondere dadurch erschwert, dass zum einen verlässliche Daten fehlten und zum anderen die Teams nicht dafür qualifiziert waren, Sozialraumanalysen richtig zu deuten und daraus die entsprechenden Bedarfe von Familien abzuleiten. (Vgl. MGFFI NRW 2009: 15 ff.)
Verbünde
Insgesamt wird die Verbundstruktur von den beteiligten Einrichtungen sowie von VertreterInnen aus den Jugendämtern und der Jugendhilfepolitik als positiv bewertet, da so eine Angebotsvielfalt entsteht, die allen Interessen gerecht werden kann und die Ressourcen der einzelnen Verbundeinrichtungen für alle nutzbar gemacht werden. Dennoch ist anzumerken, dass die pädagogische Arbeit insbesondere in den großen Verbünden mit einem erheblichen internen Koordinierungsaufwand verbunden ist, der in Nordrhein-Westfalen zum Teil zur Vernachlässigung regelmäßiger Leitungstreffen führte. (Vgl. MGFFI NRW 2009: 28 f.)
Managementtätigkeiten der Leitungskräfte
Die Mehrheit der Leitungskräfte bewertet die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern als positiv und interessant, gleichzeitig ist sie jedoch sehr zeitaufwändig und setzt die Leitungen in ihrer Arbeit unter einen größeren zeitlichen Druck als zuvor. Zudem zeichnen sich qualitative Veränderungen in der Arbeit der Leitungskräfte ab und immer häufiger verstehen sie sich selbst als ManagerIn ihrer Einrichtung, ohne sich dafür angemessen qualifiziert zu fühlen. Hinzu kommen neue Aufgaben- und Aktionsfelder, mit denen sie zuvor nicht konfrontiert waren und in welche sie sich neu einarbeiten müssen. In diesem Zusammenhang ist die Nachfrage nach Managementseminaren für Leitungskräfte enorm gestiegen. Nach Aussage der Leitungen geht mit der Ausweitung ihrer Aufgaben jedoch auch eine steigende Anerkennung ihrer Arbeit seitens der Kooperationspartner, der öffentlichen Jugendhilfe sowie der Politik einher. (Vgl. MGFFI NRW 2009: 23)
Externe Unterstützung bei der Weiterentwicklung
Die wichtigsten externen Hilfen bei der Weiterentwicklung zum Familienzentrum waren nach Angaben der Einrichtungen der ersten Ausbauphase die Fachberatung, trägerinterne Arbeitskreise sowie Fortbildungsveranstaltungen. Zudem wurde knapp ein Drittel der befragten Einrichtungen durch eine Koordinierungsstelle beim Jugendamt unterstützt. Die Träger halfen ihren Einrichtungen eher weniger mit konkreten Hilfen, hatten nach Angaben der Leitungen jedoch eine motivierende Wirkung, da sie ihre Wertschätzung für die Arbeit der Familienzentren zum Ausdruck brachten. Auch das kommunale Engagement zum Thema Familienzentren nimmt in Nordrhein-Westfalen zu und immer mehr Stimmen aus der Kommunalpolitik zeigen sich interessiert. Da die Verantwortung für die Auswahl weiterer Familienzentren seit Anfang der ersten Ausbauphase bei den Jugendämtern liegt, setzen auch sie sich immer intensiver mit diesem Thema auseinander und nehmen verstärkt Steuerungsfunktionen wahr, um die Jugendhilfelandschaft unter Einbezug der Familienzentren aktiver zu gestalten. So wurden bspw. Steuerungsmodelle zur Unterstützung von Familienzentren entwickelt, die insbesondere dann eine entlastende Wirkung zeigten, wenn Koordinationsstellen beteiligt waren. Die Unterstützung der kommunalen Steuerungsmodelle konzentriert sich auf fünf zentrale Instrumente: Fortbildungsangebote für alle, Coaching während des ersten Jahres, personelle Besetzung von Koordinierungsstellen, Bezuschussung von Beratungsleistungen, Integration von Einrichtungen, die nicht Familienzentrum werden. (Vgl. MGFFI NRW 2009: 16, 27 f.)
Motivation und Selbstvertrauen der Teams
Da sich ein großer Teil der Piloteinrichtungen selbst für das Pilotprojekt beworben hatte, war die Motivation der Teams von Beginn an überdurchschnittlich hoch und viele der Einrichtungen boten bereits vor dem Projekt mehrere familienunterstützende Angebote an. Durch die Weiterentwicklung zum Familienzentrum und die damit einhergehenden neuen Aktivitäten und speziellen Aufgaben, die von einzelnen Teammitgliedern übernommen wurden, hat jedoch noch eine zusätzliche Kompetenzerweiterung stattgefunden, die insgesamt zu einem deutlich gestiegenen Selbstvertrauen geführt hat. Spezielle Aufgaben der einzelnen MitarbeiterInnen waren dabei größtenteils die Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern, die Beratung der Eltern in erzieherischen Bereichen sowie die Planung und Organisation von Bildungsangeboten. (Vgl. MGFFI NRW 2009: 24)
Zufriedenheit der Eltern
Nach einer Befragung von über 2000 Eltern konnte in Nordrhein-Westfalen ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Quantität familienunterstützender Angebote im Familienzentrum und der Zufriedenheit der Eltern mit der Einrichtung festgestellt werden. Demnach waren Eltern in Einrichtungen besonders zufrieden, die in den Gütesiegel-Ergebnissen hohe Werte erzielt hatten und demnach vergleichsweise viele Angebote für Familien vorhielten. Der größte Bedarf an familienunterstützenden Angeboten war bei alleinerziehenden und/ oder in Vollzeit berufstätigen Müttern zu verzeichnen. Gleichzeitig konnte festgestellt werden, dass insbesondere Mütter mit einem einfachen Bildungsniveau als auch Mütter mit hohem Bildungsniveau einen großen Bedarf anzumelden hatten. Dabei bezogen sich die Erwartungen seitens der bildungsferneren Familien eher auf die Förderung ihrer Kinder sowie auf konkrete Unterstützung in der Erziehung, während Familien mit einem hohen Bildungsniveau viel Wert auf Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf legten. Insgesamt wurden am häufigsten gemeinsame Aktivitäten für Eltern und Kinder, interkulturelle Angebote sowie ein warmes Mittagessen für die Kinder in Anspruch genommen. Selten wurden hingegen Vermittlungsdienste für Tagespflege und Babysitter genutzt. (Vgl. MGFFI NRW 2009: 17)
Beratungsleistungen im Familienzentrum
Die Verknüpfung von Familienzentren mit Beratungsleistungen wurde von den Einrichtungen selbst als besonders effektiv eingestuft, da so die Schwelle der Inanspruchnahme der Beratung gesenkt und auch verstärkt Familien mit Problemlagen erreicht werden konnten, die für die Beratungsstellen sonst nur schwer zu erreichen waren. Auch die ErzieherInnen berichten, dass sie von dem professionellen Austausch mit den Beratungsstellen profitieren. Als niederschwellige Angebote bewährt haben sich insbesondere regelmäßige, offene Beratungs-Sprechstunden von externen BeraterInnen in den Räumen der Familienzentren. Nach Aussage der Befragten konnten so bereits mit wenigen Beratungseinheiten erhebliche pädagogische Wirkungen erzielt werden. Viele Einrichtungen stellen zudem fest, dass durch das wachsende Vertrauen auch eine gewollte Bedarfsweckung stattfindet, gleichzeitig befürchten sie jedoch, dass es aufgrund mangelhafter Infrastrukturen zu Versorgungsengpässen kommen könnte. (Vgl. MGFFI NRW 2009: 19 ff.)
Familienbildung im Familienzentrum
Insbesondere in der Familienbildung hat die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zu einem deutlichen quantitativen Zuwachs an Angeboten geführt. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass Angebote der Familienbildung von Familien nur dann angenommen werden, wenn sie bedarfsgerecht auf sie zugeschnitten sind und auch das Wohnumfeld bei der Themen- und Methodenwahl entsprechend berücksichtigt wird. Bei familienbildenden Angeboten ist es deshalb besonders wichtig, dass sie auf der Basis einer sorgfältigen Sozialraum- und Bedarfsanalyse entwickelt werden. Auch Zuwanderungsfamilien können durch niederschwellige, auf sie zugeschnittene Angebote sehr gut erreicht werden. Eine flexible Handhabung der Tageszeiten, die Absenkung bzw. die Aufhebung von Teilnehmergebühren sowie die stärkere Berücksichtigung von Einzelterminen anstelle von Kursreihen sind hier die wichtigsten Faktoren, die eine Absenkung der Schwelle zur Inanspruchnahme der Angebote bewirken, insbesondere bei Familien mit Bildungsbenachteiligung. Ein weiterer wichtiger Faktor dafür, dass ein Angebot wahrgenommen wird, ist die Öffentlichkeitsarbeit von Familienzentren. Der Ausbau eines guten Informations- und Werbesystems ist jedoch ein Bereich, an welchem die befragten Einrichtungen nach eigener Einschätzung noch arbeiten müssen. (Vgl. MGFFI NRW 2009: 22 f.)
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf konnte in den untersuchten Einrichtungen eine vergleichsweise dynamische Entwicklung verzeichnet werden, da sich in den sehr offen gestalteten Abfragen der gewünschten Betreuungszeiten überraschend viele Eltern für eine Veränderung der Öffnungszeiten und Ferienregelungen ausgesprochen hatten. Dies führte teilweise zur Einführung von Notfallbetreuung, die in einzelnen Fällen auf nicht angemeldete Kinder aus der Nachbarschaft ausgeweitet wurde. (Vgl. MGFFI NRW 2009: 25)
3.8.2. Familienzentren in Niedersachsen – Befragung zur Bestandsaufnahme
Auch in Niedersachsen ist ein starker Trend dahingehend zu verzeichnen, dass sich viele Einrichtungen mit der Thematik Familienzentren auseinandersetzen. Nach Angaben des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) gibt es derzeit in Niedersachsen ca. 135 Familienzentren, sowie 150 Einrichtungen, die sich auf dem Weg zum Familienzentrum befinden. Diese Entwicklungen werfen viele Fragen auf, denen sich eine vom nifbe ins Leben gerufene Expertenrunde widmen möchte. Als Grundlage für die Arbeit der Expertenrunde wurde im Herbst 2011 eine Bestandserhebung mittels Online-Fragebögen durchgeführt, an welcher insgesamt 428 Kindertageseinrichtungen (zu 88,6%), Familienbildungsstätten, Mehrgenerationenhäuser und Beratungseinrichtungen in Niedersachsen teilnahmen und einen vollständig ausgefüllten Fragebogen zurückschickten. (Vgl. Engelhardt/ nifbe 2012: 1, 15)
Aus den Ergebnissen wurde deutlich, dass aus dem Selbstverständnis der verschiedenen Einrichtungen bisher keine klare Definition für Familienzentren abzuleiten ist. Bezüglich der Kernaufgaben von Familienzentren besteht hingegen weitgehende Einigkeit darüber, dass ein Familienzentrum familienunterstützende, wohnortnahe Angebote für Eltern und Kinder aus dem sozialen Umfeld anbieten sowie Eltern intensiv in die Bildungsprozesse ihrer Kinder einbeziehen sollte. Dabei wird der Early Excellence Ansatz von der Mehrheit der Kindertageseinrichtungen als eine geeignete konzeptionelle Grundlage für Familienzentren betrachtet. (Vgl. Engelhardt/ nifbe 2012: 14)
Insgesamt ist eine Konzentration von Familienzentren auf den städtischen Raum zu verzeichnen, wobei die hohe Anzahl an Einrichtungen, die sich im ländlichen Raum auf dem Weg zum Familienzentrum befinden, deutlich macht, dass diese Thematik auch hier zunehmend aufgegriffen wird. In sozial benachteiligten Regionen ist die Konzentration von Familienzentren besonders hoch, ca. 86% der Familienzentren sowie der Einrichtungen auf dem Weg dorthin befinden sich in sozial benachteiligten Sozialräumen, knapp 45% in gemischten und rund 22% in eher gut situierten Regionen. (Vgl. Engelhardt/ nifbe 2012: 3 f.)
Beweggründe für das große Interesse an der Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen bestehen zum Großteil darin, dass sie sich anpassen möchten an die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen und einen gestiegenen Bedarf an familienunterstützenden Angeboten, aber auch an einer besseren, interdisziplinären Vernetzung wahrnehmen. (Vgl. Engelhardt/ nifbe 2012: 14)
Gleichzeitig beziffern über 80% der Befragten Einrichtungen einen notwendigen Bedarf an Fortbildung und Begleitung bei der Weiterentwicklung zum Familienzentrum. Dies gilt insbesondere für die Bereiche „Kooperationen und Netzwerke gestalten (60,6%), Organisationsentwicklung, Veränderungen gestalten (57,7%), integrierte Familienarbeit (54,9%) sowie Gesprächsführung/ Rhetorik (47,9%)“ (Engelhardt/ nifbe 2012: 11). Auch der Prozessbegleitung wird ein hoher Stellenwert beigemessen, über 70% der befragten Einrichtungen sehen einen Bedarf an der Begleitung durch die Fachberatung und einem regelmäßigen Austausch mit anderen Familienzentren. Darüber hinaus werden Fachtagungen, Materialien und Handreichungen als eine wichtige Unterstützung betrachtet. Vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs an Begleitung durch die Fachberatung wirft das nifbe die Frage auf, ob diese tatsächlich ausreichend auf die Thematik Familienzentren vorbereitet sind. (Vgl. Engelhardt/ nifbe 2012: 15)
Bei der Frage nach den wichtigsten Kooperationspartnern nimmt die Grundschule eine zentrale Stellung ein, gefolgt von Beratungsstellen, Familienbildung, Gesundheitsbildung, anderen Kindertageseinrichtungen sowie Familien-Service-Büros. Auffällig ist jedoch, dass die Erwachsenenbildung in der Bewertung der Einrichtungen noch hinter der Kooperation mit Sportvereinen liegt. (Vgl. Engelhardt/ nifbe 2012: 10, 15)
Hinsichtlich der Ressourcen ist beachtlich, dass 73% der befragten Einrichtungen in Niedersachsen keine zusätzlichen finanziellen Mittel oder personelle Ressourcen für die Arbeit im bzw. die Weiterentwicklung zum Familienzentrum zur Verfügung haben. Bei den übrigen 27% setzen sich die Ressourcen überwiegend aus zusätzlicher Fachberatung, ehrenamtlichen Helfern, Spenden, kostenpflichtigen Angeboten, ideeller Unterstützung und Know-how sowie durch den Träger finanziertes Material und Fortbildungen zusammen. (Vgl. Engelhardt/ nifbe 2012: 15)
3.8.3. Evaluation zu den Wirkfaktoren der Familienzentren mit Early Excellence Ansatz in Hannover
Von April 2010 bis April 2011 wurden in Hannover insgesamt 19 Familienzentren wissenschaftlich evaluiert, die nach dem Early Excellence Ansatz arbeiten. Ziel des Projekts war es, Erkenntnisse zu gewinnen zu den Wirkfaktoren in bildungsrelevanten und netzwerkbildenden Bereichen, zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Einrichtungen (trotz gemeinsamer, trägerübergreifender Qualitätsstandards) sowie zu förderlichen Rahmenbedingungen für die Gestaltung gemeinsamer Erziehungsverantwortung von Familien und Fachkräften. Mithilfe von Fragebögen wurden alle 19 LeiterInnen bzw. KoordinatorInnen der Familienzentren, 181 ErzieherInnen und 683 Familien befragt. Zusätzlich fanden Gruppeninterviews mit insgesamt 22 Netzwerkpartnern statt. Die Einrichtungen werden dabei zu einem Großteil von Kindern in Lebenslagen mit multiplen Risikofaktoren besucht. So liegt der Anteil der Eltern, die beitragsbefreit sind, in den Einrichtungen bei knapp 65%, der Anteil an Alleinerziehenden bei knapp 25% sowie der Anteil an Eltern mit Migrationshintergrund bei rund 72%. (Vgl. Detert et al. 2012 [u.M.]: 2, 7)
Die Vorstellung davon, was ein Familienzentrum ausmacht und welche Rolle ihm zukommen soll, fiel in den Einrichtungen unterschiedlich aus. Am häufigsten wurden hier Ideen vom Familienzentrum als Ort informeller Kontakte und Partner der Eltern, als Bildungseinrichtung mit besserer Förderung der Kinder oder auch als Chance zur Erreichung besonderer Zielgruppen und zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern genannt. (Vgl. Detert et al. 2012 [u.M.]: 6)
Die untersuchten Einrichtungen waren zum Erhebungszeitpunkt bereits unterschiedlich lange Teil des Projekts, was jedoch statistisch gesehen wenig Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Vier Variablen können hierbei jedoch als signifikant bezeichnet werden: Mit der Dauer der Projektlaufzeit steigt ebenfalls die Wertschätzung im Team, das Engagement der Kollegen, eine positive Sicht auf Kinder und Eltern sowie Kenntnisse der Teams über die Netzwerke. (Vgl. Detert et al. 2012 [u.M.]: 4)
Mehr als die Hälfte der befragten ErzieherInnen geben an, dass sie unmittelbar nach Beginn der Umwandlung zum Familienzentrum bereits Veränderungen wahrnehmen konnten. So bestätigen sie, dass der Austausch und die Zusammenarbeit intensiver sowie das Team professioneller, engagierter und ressourcenorientierter geworden seien. Zudem hätten sich die Elterngespräche verändert und die sozialarbeiterischen Tätigkeiten hätten zugenommen. Besonders hervorgehoben wurde in diesem Kontext immer wieder der veränderte positive Blick und die generelle Haltungsänderung gegenüber den Familien, wie es im Konzept des Early Excellence Ansatz zentral sind. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit Eltern geben die ErzieherInnen an, dass sich der Kontakt zu den Eltern verbessert habe, mehr Eltern als früher erreicht würden, Eltern und Kinder engagierter geworden seien, sowie dass die Eltern vielfältiger und individueller unterstützt werden könnten. Zudem glaubt etwa die Hälfte der LeiterInnen, dass sie mit ihren Angeboten bereits 80% der Eltern erreichen, wobei etwa 30% der Familien von den ErzieherInnen als schwer erreichbare Klientel benannt werden. Hierzu zählen laut Aussagen der ErzieherInnen insbesondere Horteltern, Väter und erwerbstätige Eltern. Sprachbarrieren werden hingegen selten als Hindernis für die Inanspruchnahme von Angeboten gesehen. (Vgl. Detert et al. 2012 [u.M.]: 5 ff.)
Als wichtigste Angebote nennen die Erzieherinnen die Erziehungsberatung und das Elterncafé, gefolgt von musischen Angeboten, Themenabenden für Eltern sowie Angeboten für Väter und Kinder. Die wichtigsten Themen, über welche sich Eltern und ErzieherInnen austauschen sind Berichte über die Entwicklung des Kindes, Organisatorisches sowie Fragen zur Erziehung. Teilweise sei es schwer, so die ErzieherInnen, den Eltern das Bildungskonzept des Early Excellence Ansatzes näherzubringen, wenn diese ein überwiegend auf schulischem Lernen basiertes Verständnis von Bildung an den Tag legten. (Vgl. Detert et al. 2012 [u.M.]: 7 ff.)
Zwischen der Angebotsnutzung und veränderten Erziehungskompetenzen der Eltern konnte kein signifikanter Zusammenhang hergestellt werden. Erstaunlich war jedoch, dass insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund angaben, stark von den Angeboten des Familienzentrums zu profitieren. So bekamen sie seit Besuch des Familienzentrums mehr Kontakte zu anderen Eltern, unternahmen viel mehr mit ihrem Kind, veränderten teilweise die Erziehung, besuchten viele Veranstaltungen für sich allein und lernten viel für sich sowie über die Entwicklung des eigenen Kindes. (Vgl. Detert & Rückert 2012 [u.M.]: o.S.)
Die Aufgaben, mit denen sich die pädagogischen Fachkräfte in ihrem Familienzentrum konfrontiert sehen, sind vielfältig und reichen von vermehrter Elternarbeit über gemeinwesenorientierte Aufgaben bis hin zu Vernetzungstätigkeiten. Fortbildungsbedarf besteht laut Angaben der Befragten überwiegend in den Bereichen Elternarbeit/ -bildung, Organisationsentwicklung und Psychohygiene sowie bei dem speziellen Beobachtungssystem des Early Excellence Ansatzes. (Vgl. Detert et al. 2012 [u.M.]: 5; Detert & Rückert 2012 [u.M.]: o.S.)
Die Vernetzung der Familienzentren in ihren Sozialräumen war bereits vor Projektbeginn weit ausgeprägt. So arbeiten die Einrichtungen im Durchschnitt mit 14,7 Kooperationspartnern manchmal und mit 8,5 oft oder sehr oft zusammen. Wie auch in Nordrhein-Westfalen wird die Schule als der wichtigste Kooperationspartner genannt, wobei sich die Zusammenarbeit überwiegend auf die Gestaltung des Übergangs oder die Zusammenarbeit im Hort konzentriert und jeweils von sehr unterschiedlicher Qualität gezeichnet ist. Eine Entlastung der ErzieherInnen durch Kooperationen ist insgesamt jedoch nicht festzustellen und auch die Delegation bestimmter Aufgaben findet selten statt. Lediglich knapp 10% der Befragten fühlen sich durch Vernetzung entlastet, obwohl sich im Vorfeld mehr als die Hälfte eine solche Entlastung erhofft hatte. Das Forschungsteam zieht daraus den Schluss, dass sich die Familienzentren stärker auf SMART-Ziele beschränken sollten, die ihrem spezifischen Verständnis von Familienzentren sowie ihren persönlichen, fachlichen und materiellen Ressourcen entsprechen. Andernfalls, so die Autoren, sei die Überforderung der MitarbeiterInnen sowie das Scheitern des Projekts vorprogrammiert. (Vgl. Detert et al. 2012 [u.M.]: 9 ff.)
4. Zwischenfazit
Die Thematik Familienzentren erfährt heute immer mehr Aufmerksamkeit und befindet sich in einer rasanten bundesweiten Entwicklung. Vielerorts werden Modellprojekte aufgelegt oder Einrichtungen entwickeln sich aus eigener Motivation heraus weiter, weil sie merken, dass sie auf die veränderten Bedarfe von Familien reagieren müssen. Denn durch den rasanten gesellschaftlichen Wandel, die gewachsenen Anforderungen an Erziehung und das Wegbrechen natürlicher familiärer Netzwerke fühlen sich immer mehr Eltern unter Druck und teilweise überfordert. Das angestrebte Ideal, in der Erziehung alles richtig machen zu wollen kollidiert nicht selten mit der alltäglichen Realität und den Anforderungen im Beruf. Auch die Erkenntnisse aus der Forschung machen deutlich, dass die Erfahrungen aus den ersten Lebensjahren sowie das familiäre System, in welchem Kinder aufwachsen, für ihre Entwicklung entscheidend sind. Frühe präventive Hilfen für Familien bekommen dadurch eine entscheidende Rolle zugewiesen.
Ein Blick in die Praxis zeigt jedoch, dass familienunterstützende Angebote oftmals nebeneinander existieren und kaum miteinander verknüpft sind, wodurch vielfältige Ressourcen und mögliche Synergien verloren gehen. Ein ganzheitliches und effektives Reagieren auf komplexe Problemlagen wird so unmöglich. Es muss also ein Umdenken stattfinden weg von der Konzentration auf Einzelstrategien und einzelne Säulen hin zu einer ganzheitlichen, integrierten Handlungsstrategie und zu Gesamtkonzepten. Das Jugendamt sowie die Schulverwaltung auf Kreisebene nehmen hier eine zentrale Rolle ein. Nach Stange ist es ihre Aufgabe, die Steuerungsfunktion von Gesamtnetzwerken zu übernehmen und die Jugendhilfe- und Schullandschaft aktiver zu gestalten und zu verknüpfen. Doch auch Familienzentren sind ein wichtiger Teil von Gesamtnetzwerken, indem sie als Netzwerkzentrum auf sozialräumlicher Ebene fungieren und ein bedarfsgerechtes, niederschwelliges und ganzheitliches Unterstützungsangebot für Familien sicherstellen und koordinieren.
Auf welche Art und Weise Familienzentren diese Aufgabe wahrnehmen, kann ganz unterschiedlich aussehen. So gibt es verschiedenste Organisationsmodelle und Angebotsprofile vom Sozialzentrum bis zur Kindertageseinrichtung Plus, vom Early Excellence Ansatz bis zu Lebensalter übergreifenden Modellen. Ein Grund für die Unterschiedlichkeit zwischen den Familienzentren ist die starke Ausrichtung an den vorhandenen Bedarfen und den strukturellen Voraussetzungen des jeweiligen Sozialraums, ein anderer ist der unterschiedliche Zugang zu finanziellen, materiellen, räumlichen und personellen Ressourcen und Kompetenzen.
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluationen machen deutlich, dass subjektiv bereits nach kurzer Zeit Veränderungen im Team sowie in der Zusammenarbeit mit Eltern und Kooperationspartnern wahrzunehmen sind. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass durch die Umwandlung zum Familienzentrum eine starke Tendenz zur Mehr- und Überbelastung der Teams besteht, wenn nicht in ausreichendem Maße zusätzliche Ressourcen und Kompetenzen zur Verfügung stehen. Rund 73% der niedersächsischen Familienzentren erhalten keine zusätzlichen finanziellen oder personellen Ressourcen, sie müssen all ihre Angebote aus eigener Kraft stemmen. So scheint es voraussehbar, dass diese Einrichtungen selbst bei größtem Engagement kaum über das Modell der Kindertageseinrichtung Plus hinauswachsen können. Auch ist fraglich, wie Familienzentren ohne zusätzliche personelle Ressourcen für die Koordinierungsarbeit ihre zentrale Rolle im sozialräumlichen Netzwerk erfüllen können.
Ein weiterer Faktor, der die Weiterentwicklung zu einem qualitativ hochwertigen Familienzentrum erschwert ist, dass es an einer klaren Definition fehlt, was genau unter einem Familienzentrum zu verstehen ist sowie an einheitlichen Qualitätskriterien, an denen sich Einrichtungen mit dem Ziel Familienzentrum orientieren können. Auch wenn es diesbezüglich Vorstöße einzelner Städte und Bundesländer gibt, besteht bundesweit noch ein erheblicher Entwicklungs- und Forschungsbedarf zur Bestimmung von Qualität in Familienzentren.
4.1. Konsequenzen für die Planung von Familienzentren
Für die Planung von Familienzentren haben die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln vielfältige Konsequenzen. Um den Grundsatz der Bedarfs- und Sozialraumorientierung zu erfüllen, ist zunächst eine systematische Bedarfsanalyse mit integrierter Sozialraum- und Lebensweltanalyse durchzuführen, auf deren Basis anschließend ein Konzept entwickelt werden kann, das konkrete Qualitätskriterien und Handlungsstrategien bereithält. Da die betroffenen Bewohner und Einrichtungen wichtige Experten für ihre eigene Lebenswelt sind, sollten diese partizipativ an der Konzeptentwicklung beteiligt werden. Wichtig ist auch die Integration des Konzepts in den kommunalen Gesamtzusammenhang sowie die Ausrichtung an den strukturellen Gegebenheiten und Ressourcen vor Ort.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die finanzielle Absicherung des Projekts, da ein Familienzentrum für die Erfüllung seiner zentralen Funktionen nicht ohne zusätzliche Ressourcen und Kompetenzen auskommt. Zentral sind hier m. E. die Schaffung einer Koordinierungsstelle sowie die Fort- und Weiterbildungen des pädagogischen Personals für die erweiterten Aufgaben in einem Familienzentrum.
Auch ein funktionierendes Qualitätsmanagement muss im Familienzentrum verankert werden, damit die Qualität der Arbeit und der Konzeption stetig evaluiert und weiterentwickelt werden kann. In diesem Sinne ist das Formulieren von zentralen Qualitätskriterien unerlässlich. Damit dies jedoch nicht willkürlich und interessengeleitet geschieht, brauch es auch in Familienzentren übergeordnete Kriterien, über welche in der Fachöffentlichkeit ein Konsens hergestellt wird. Einzelne Städte, Regionen und Bundesländer haben bereits daran gearbeitet, jeweils für sich eigene Qualitätskriterien für Familienzentren zu entwerfen. Im folgenden Abschnitt sollen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sowie die Stärken und Schwächen dieser Kriterienkataloge näher untersucht werden, damit auf dieser Basis ein eigener Vorschlag für einen Regionen übergreifend gültigen Kriterienkatalog für Familienzentren entwickelt werden kann.
In einem weiteren Abschnitt soll dann das Verfahren zur Entwicklung einer geeigneten Konzeption auf der Basis der zuvor entworfenen Qualitätskriterien sowohl theoretisch als auch anhand eines konkreten Praxisprojekts näher erläutert werden.
5. Qualitätskriterien und Maßnahmen/ Angebote von Familienzentren
In einzelnen Bundesländern und Städten in Deutschland wird bereits eine flächendeckende Entwicklung von Einrichtungen zu Familienzentren gefördert und vorangetrieben. So gibt es bspw. in Nordrhein-Westfalen eine landesweite Förderung für Einrichtungen, die das Gütesiegel Familienzentrum NRW tragen und dafür einen umfangreichen Kriterienkatalog erfüllen müssen. Darüber hinaus gibt es in Hessen, Hamburg und Thüringen eine landesweite Förderung von Familienzentren bzw. Eltern-Kind-Zentren, wie sie in Hamburg und Thüringen genannt werden. Rheinland-Pfalz stellt derzeit eine Landesförderung von rund 45 Häusern der Familie bereit , die Bundesländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen hingegen haben ihre landesweiten Modellprojekte für Familienzentren bereits abgeschlossen. In Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen und dem Saarland gibt es bisher noch keine landesweite Förderung, hier wurden jedoch einzelne Modellprogramme im Kitabereich auf den Weg gebracht. So gibt es z.B. in Niedersachsen verschiedene Pilotprojekte einzelner Regionen: Hannover fördert im gesamten Stadtgebiet Familienzentren, die sich am Early Excellence Ansatz orientieren und auch in den Regionen Osnabrück und Emsland gibt es erste Modellprojekte für Familienzentren im ländlichen Raum. Darüber hinaus arbeitet eine Expertenrunde unter der Leitung des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) derzeit daran, eine einheitliche Definition sowie Gütekriterien für Familienzentren in Niedersachsen zu entwickeln. Keine direkte Förderung von Familienzentren gibt es hingegen in Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Bayern, diese Länder unterstützen jedoch landesweit verschiedene Familienbildungs- und Selbsthilfe-Angebote, was wiederum auch Familienzentren zugutekommen kann. (Vgl. Schlevogt 2012: 1ff.)
Nach dieser Auflistung der Bemühungen einzelner Länder wird deutlich, dass bereits in vielen Regionen die Notwendigkeit von Familienzentren erkannt wurde. Dennoch gestaltet sich die Festlegung konkreter und Regionen übergreifender Gütekriterien als schwierig und wurde erst von wenigen Ländern wie Nordrhein-Westfalen in Angriff genommen.
Im Laufe dieses Kapitels soll geklärt werden, welche Qualitätskriterien es bereits gibt, welche Schwierigkeiten bei der Formulierung allgemeiner Kriterien auftreten und woran sich ein jeweils passgenauer Kriterienkatalog orientieren muss. Bevor dann im Anschluss ein eigener Entwurf für einen allgemeinen Qualitätskriterienkatalog entwickelt wird, sollen zunächst die Zielgruppen von Familienzentren näher betrachtet werden. Denn das Wissen um die Zielgruppen und ihrer besonderen Lebenslagen, Risiken und Bedürfnisse ist elementar für die Entwicklung eines zielgruppendifferenzierten und bedarfsgerechten Angebots und bestimmt maßgeblich die Anwendung der Qualitätskriterien auf den eigenen Sozialraum mit.
5.1. Kriterienkataloge verschiedener Städte und Bundesländer
Nordrhein-Westfalen:
Zu Beginn des Jahres 2006 hat die nordrhein-westfälische Landesregierung das Pilotprojekt Familienzentrum NRW auf den Weg gebracht. Dort haben sich in einer einjährigen Pilotphase 251 Einrichtungen zu Familienzentren weiterentwickelt, um das Land in seinem ambitionierten Vorhaben zu unterstützen, das kinder- und familienfreundlichste in ganz Deutschland zu werden. Zur Zertifizierung der Einrichtungen hat die Pädagogische Qualitäts-Informations-Systeme gGmbH (PädQUIS) unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Tietze ein Qualitätssiegel entwickelt. Das Land unterstützt Einrichtungen mit diesem Siegel mit jährlich 13.000 Euro. (Vgl. MGFFI NRW [Hrsg.] 2007: 1)
Die Qualitätskriterien des Gütesiegels Familienzentrum NRW sind eingeteilt in jeweils vier Leistungs- und vier Strukturbereiche. Die Leistungsbereiche
- Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien,
- Familienbildung und Erziehungspartnerschaft,
- Kindertagespflege sowie
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
beschreiben die inhaltlichen Angebote des Familienzentrums, wohingegen die Strukturbereiche
- Sozialraumbezug,
- Kooperation und Organisation,
- Kommunikation sowie
- Leistungsentwicklung und Selbstevaluation
erfassen, wie eine Einrichtung die Voraussetzungen für ein passgenaues Angebot schafft. Die einzelnen Leistungs- und Strukturbereiche setzen sich wiederum zusammen aus Basis- und Aufbauleistungen. In Abhängigkeit davon, wie viele Basis- und Aufbauleistungen eine Einrichtung in dem jeweiligen Bereich erfüllt, bekommt es eine bestimmte Anzahl von Punkten, die es zur Erreichung einer Gesamt-Mindestanzahl von Punkten und somit zur Verleihung des Gütesiegels braucht. (Vgl. MGFFI NRW [Hrsg.] 2007: 3f.)
Hannover:
In Hannover gibt es heute insgesamt 21 Familienzentren, die von der Landeshauptstadt gefördert werden und nach dem Early Excellence Ansatz arbeiten. Der Entwicklungsprozess der Familienzentren begann im Jahr 2002 aufgrund der Initiative der Kindertageseinrichtung Gronostraße, welche in Zusammenarbeit mit der FLUXUS-Elternwerkstatt die Konzeption Von der Kita zum Familienzentrum erarbeitete, um ihre bereits praktizierten Elternbeteiligungs- und Elternbildungsangebote konzeptionell abzusichern. 2004 stellte die Einrichtung einen Projektantrag, um die neue Konzeption umsetzen zu können und überzeugte damit die entsprechende Fachabteilung sowie den Rat der Stadt. Es wurde das Forum Familienzentrum als wichtiges Austausch-, Beratungs- und Entwicklungsgremium etabliert und ein Träger übergreifendes Corporate Designs für die Familienzentren Hannover entwickelt. Das Forum Familienzentrum ist ein verpflichtender Zusammenschluss der Leitungen, KoordinatorInnen und Fachberatungen der Familienzentren Hannover. Um eine Entscheidung über weitere Standorte von Familienzentren treffen zu können, hat das Forum spezielle Vergabekriterien entwickelt, welche die genauen Voraussetzungen, die Bedingungen für den Prozess sowie bestimmte Erwartungen definieren. In den nachfolgenden Jahren wurden immer mehr Einrichtungen in die Förderung aufgenommen, welche jährlich jeweils 40.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen, um eine Halbtagsstelle zur Koordination der Netzwerkarbeit und der Elternbildungsangebote sowie benötigte Sachmittel finanzieren zu können. Darüber hinaus wurde ein Träger übergreifendes Fortbildungsprogramm zum Early Excellence Ansatz für das pädagogische Personal entwickelt, welches 2008 und 2009 bereits in Teilen umgesetzt werden konnte. In der Konzeption Von der Kindertageseinrichtung zum Familienzentrum werden umfangreiche Ziele genannt, die sich auf bildungspolitische, familienpolitische und gesundheitspolitische Bereiche sowie auf die Arbeit in Netzwerken beziehen.
Vor diesem Hintergrund wurden folgende Qualitätsbereiche der hannoverschen Familienzentren festgelegt und in der Konzeption näher ausgeführt:
- Ausrichtung der pädagogischen Arbeit und Haltung nach dem Early Excellence Ansatz
- (Früh-)kindliche Entwicklung und Bildung, orientiert an den Bildungsbereichen im Bildungsprogramm des Landes Berlin:
- Körper, Bewegung und Gesundheit
- Soziale und kulturelle Umwelt
- Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien
- Bildnerisches Gestalten
- Musik
- Mathematische Grunderfahrungen
- Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen
- Zusammenarbeit mit Eltern, Beteiligung und Elternbildung aufbauend auf der Förderung der drei Säulen:
- persönliche Kompetenz von Eltern
- erzieherische Kompetenz von Eltern
- berufliche Kompetenz von Eltern
- Anforderungen an das pädagogische Personal
- Persönliche Kompetenzen
- Erzieherische Kompetenzen
- Berufliche Kompetenzen
- MitarbeiterInnen-Motivation
- Strukturelle Voraussetzungen
- Sozialraumbezug
- Vernetzung und Kooperation mit anderen Institutionen im Stadtteil (sozialräumliches Netzwerk auf- und ausbauen)
- Trägerübergreifende Zusammenarbeit/ Kooperationsverbund
- Qualitätsentwicklung und -sicherung
- Evaluation und wissenschaftliche Begleitung
- Fortbildungsprogramm – basierend auf dem Early Excellence Ansatz
(Vgl. Engelhardt & Schenk 2010: 4 ff.; 30 ff.)
Berliner Modell – Early Excellence Centre Ansatz
Die Heinz und Heide Dürr Stiftung in Berlin hat sich im Jahre 2000 dazu entschieden, einen Schwerpunkt im Bereich der frühkindlichen Bildung zu setzen. Im Zuge dessen hat sie in Zusammenarbeit mit dem Pestalozzi-Fröbel-Haus ein Modellprojekt initiiert, das nach dem englischen Vorbild des Early Excellence Centre Ansatz (EEC-Ansatz) arbeitet und auf den Prinzipien der Chancengleichheit bei der Bildung der Kinder sowie der Partizipation der Eltern aufbaut. Da es heute deutschlandweit immer mehr Einrichtungen gibt, die sich am EEC-Ansatz orientieren, hat die Fachberatung des Pestalozzi-Fröbel-Hauses Qualitätskriterien entwickelt, die als Orientierungshilfe dienen sowie den fachlichen Diskurs und den Austausch über Praxiserfahrungen bereichern und befördern sollen. (Vgl. Karkow & Kühnel 2008: 1)
Bei der Entwicklung einer Einrichtung zum EEC ist zunächst die Auseinandersetzung mit den zwei grundlegenden pädagogischen Inhalten des EEC-Ansatzes erforderlich: Dem Bildungsverständnis bzw. den Erkenntnissen, wie Kinder lernen und den pädagogischen Strategien, welche die Entwicklung von Haltungen gegenüber Kindern und Familien implizieren, die das Lernen von Kindern erleichtern. (Vgl. Karkow & Kühnel 2008: 8)
Darüber hinaus beschreibt der Kriterienkatalog drei fachliche Grundbausteine der Arbeit nach dem EEC-Ansatz:
- Modul 1: Beobachtung, Dokumentation und individuelle Förderung
- Modul 2: Zusammenarbeit mit Familien
- Modul 3: Öffnung in den Stadtteil für junge Familien
Jedes dieser Module ist wiederum in einzelne Bereiche eingeteilt, die sehr genau beschrieben und durch einen Leitsatz auf den Punkt gebracht werden. Darüber hinaus gibt es zu jedem Bereich einen speziellen Evaluationsbogen zur Reflexion der eigenen Arbeit und Sicherung der Qualität. Auch die konzeptionellen Rahmenbedingungen orientieren sich an drei Grundsätzen, welche jeweils mit einem Leitsatz beschrieben und anhand eines Evaluationsbogens überprüfbar gemacht wurden: Die Offene Arbeit, Das Prinzip der BezugserzieherInnen sowie die Raumgestaltung und Materialausstattung. (Vgl. Karkow & Kühnel 2008: 58)
Über die fachlichen Inhalte und konzeptionellen Rahmenbedingungen hinaus legt der EEC-Ansatz sein besonderes Augenmerk auf die „Umsetzung einer fundamentalen Haltungsänderung der pädagogischen Fachkräfte gegenüber Kindern und Familien“ (Karkow & Kühnel 2008: 4). Diese besondere Haltung, auch ethischer Code genannt, orientiert sich an den zentralen Grundsätzen einer positiven Grundeinstellung gegenüber Kindern, Familien und MitarbeiterInnen, einer konsequenten Ausrichtung der Arbeit auf die Wünsche und Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien sowie dem Aufbau einer Vertrauensbasis gegenüber den Familien. Darüber hinaus versuchen die Fachkräfte, eine gemeinsame Sprache mit den Familien zu entwickeln und erstellen eine ausführliche Dokumentation ihrer pädagogischen Arbeit, die allen Beteiligten zur Verfügung steht. (Vgl. Karkow & Kühnel 2008: 4 f.)
Thüringen:
Im Oktober 2009 haben sich SPD und CDU in Thüringen in einem Koalitionsvertrag darauf verständigt, landesweit Kindertagesstätten zu Eltern-Kind-Zentren mit einem niederschwelligen Beratungsangebot ausbauen zu wollen. Ein Konzeptionsbericht und Strategiepapier von 2011 nennt vier Grundvoraussetzungen für die Entwicklung einer Kindertageseinrichtung zum Eltern-Kind-Zentrum:
- Ausrichtung der Angebote am Sozialraum
- Aufbau einer verbindlichen Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Diensten, deren Tätigkeit den Aufgabenbereich des Eltern-Kind-Zentrums berührt
- Bekanntmachung des Angebots durch zielgruppenorientierte Kommunikation
- Sicherstellung der Qualität des Angebots durch Leistungsentwicklung und Selbstevaluation
Für die Phase der Weiterentwicklung sowie für die Etablierung der Angebote müssen bestimmte Rahmenbedingungen als Mindeststandards erfüllt werden. So bedarf es einer offenen Grundhaltung der Leitung, des pädagogischen Fachpersonals und des Trägers, einer Verankerung des Familienzentrums im Trägerkonzept, der Einbindung der Einrichtung in die Jugendhilfeplanung sowie personeller und räumlicher Ressourcen. Darüber hinaus wird die Einrichtung einer Koordinierungsstelle für die Vernetzungsaufgaben, eine Finanzierungsgrundlage, die Planungssicherheit für mindestens ein Jahr ermöglichst, Qualifizierungsmaßnahmen und ein standortübergreifender Erfahrungsaustausch sowie ein Berichtswesen zur Dokumentation der Inanspruchnahme des Familienzentrums vorausgesetzt. (Vgl. Rißmann & Remsperger 2011: 32)
Im Vorfeld des gemeinsamen Beschlusses von SPD und CDU hat das Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit bereits im März 2004 fachliche Empfehlungen für Familienzentren in Thüringen herausgegeben. In diesen Empfehlungen werden Grundprinzipien, Angebote und Aufgaben sowie Rahmenbedingungen von Familienzentren näher definiert.
Grundprinzipien:
- Selbsthilfeorientierung
- Lebensweltorientierung/ Lebensphasenorientierung
- Prävention
- Partizipation
- Integration
- Niederschwelligkeit
- Gemeinwesenorientierung
- Kooperation/ Vernetzung
- Bedürfnisorientierung
Angebote und Aufgaben:
- Familienbildung
- Unterstützung und Anregung von Familienselbsthilfe
- Familienentlastende Angebote
- Familienbezogene Informationen und Vermittlung von Beratungsangeboten
- Begegnung und Kontakte
- Vertretung von Familienbelangen
Rahmenbedingungen:
- Räumlichkeiten
- Zugänglichkeit
- Finanzierung
- Personal
- Qualitätsentwicklung
(Vgl. MSFG TH 2006: 156ff.)
Hessen:
Das hessische Förderprogramm Etablierung von Familienzentren in Hessen unterstützt Einrichtungen, „die eine ganzheitliche familienbezogene Infrastruktur entwickeln oder weiterentwickeln sowie Vernetzungs- und Kooperationsprozesse auf vertraglicher Basis initiieren“ (Internetauftritt des Hessischen Sozialministeriums: Familienzentren). Seit dem Jahr 2012 können Förderanträge eingereicht und für einen Zeitraum von maximal drei bis fünf Jahren 12.000 Euro pro Jahr und Einrichtung gewährt werden. Voraussetzung ist die Erfüllung der im September 2011 in Kraft getretenen Fach- und Fördergrundsätze zur Etablierung von Familienzentren mit Beginn des Bewilligungszeitraums. Diese Grundsätze sehen folgende Mindestleistungen vor:
- „[...] Regelmäßige, ganzheitliche familienbezogene Angebote an mindestens 3 Tagen der Woche regelmäßig zu familienfreundlichen Öffnungszeiten
- […] Angebote zur Kinderbetreuung am Standort oder Zusammenarbeit mit einer Kindertageseinrichtung und Schule […]
- […] Breite Angebote bzw. Vernetzung mit Angeboten der Familienbildung […]
- […] Arbeit auf der Basis des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes […]
- […] Zusammenarbeit mit weiteren Angeboten im Stadtteil [...]“ (Internetauftritt des Hessischen Sozialministeriums: Fach- und Fördergrundsätze zur Etablierung von Familienzentren)
Darüber hinaus muss eine systematische Kooperation und Abstimmung der Angebote von Kitas mit Schulen und anderen Institutionen gegeben sowie qualifizierte pädagogische bzw. soziale Fachkräfte und entsprechende Räumlichkeiten vorhanden sein. Auch muss eine Öffnung der Angebote für alle Familien im Sozialraum geschehen. Über die Mindestleistungen hinaus gibt das Hessische Sozialministerium weitere Empfehlungen und Vorschläge zur Ausweitung und Weiterentwicklung des Angebots sowie des Netzwerks. Hier verweist es auf mögliche Beratungsangebote, die Gestaltung des Übergangs Kita – Grundschule, Generationen übergreifende Angebote, den Early Excellence Ansatz, berufliche Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Zusammenarbeit mit Ärzten, Gesundheits-diensten und der Frühförderung. (Vgl. Internetauftritt des Hessischen Sozialministeriums: Fach- und Fördergrundsätze zur Etablierung von Familienzentren)
Rheinland-Pfalz
Das Landesprogramm Häuser der Familien baut auf dem Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser auf und erweitert dieses um die spezifische Ausrichtung, nicht nur Treffpunkt für verschiedene Generationen zu sein, sondern „[...] vielmehr zu einem Kristallisationskern für vielfältige Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote für Familien“ (Internetauftritt des MIFKJF RP) zu werden. Die Häuser der Familien sind aus verschiedenen Einrichtungen wie Kindergärten, Familienbildungsstätten, Jugendzentren oder Senioreneinrichtungen entstanden; in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt gibt es mindestens eines. Beginnend im Jahre 2006 sind bis 2010 insgesamt 45 Häuser der Familien entstanden, gefördert über jeweils drei Jahre mit jährlich bis zu 25.000 Euro. Darüber hinaus wird die Entwicklung der Einrichtungen wissenschaftlich begleitet und beratend unterstützt. Nachdem die ersten 36 Häuser von 2006 bis 2009 ihre Anschubfinanzierung erhalten hatten, wurde das landesweite Ausbauprogramm Haus der Familie ins Leben gerufen, im Zuge dessen folgende Förderkriterien erarbeitet wurden:
- Räumliche und örtliche Zusammenfassung unterschiedlicher Angebote für Familien unter einem Dach
- Integration und konzeptionelle Abstimmung familienbezogener Angebote und Leistungen
- Das Haus der Familie als Bestandteil eines aktiven Gemeinwesens
- Komm- und Gehstrukturen aufbauen und qualifiziert vermitteln
- Das Haus der Familie als Bestandteil kommunaler Planungs- und politischer Willensbildungsprozesse
- Lotsenfunktion des Hauses der Familie
- Verbindung mit anderen Landesprogrammen (vgl. MASGFF RP 2010: 2ff.)
Darüber hinaus hat das damalige Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz, heute Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, im Jahre 2009 jeweils eine spezifische Handreichung für Häuser der Familien im ländlichen Raum sowie für Häuser der Familien mit und für Migrantinnen und Migranten in Auftrag gegeben, um auf die unterschiedlichen Strukturen und Bedarfe verschiedener Zielgruppen und Sozialräume aufmerksam zu machen. Doch auch die Zusammenarbeit der Häuser der Familien mit der jeweiligen Kommune wurde vom Ministerium thematisiert, indem es einen eigenen Leitfaden für die Kooperation mit der Kommune erstellen ließ. (Vgl. ism Februar 2009; ism März 2009; ism 2010)
Die ersten Einrichtungen des Programms, deren dreijährige Anschubfinanzierung bereits abgelaufen ist, können seit 2011 an einem wiederum dreijährigen Zertifizierungsverfahren mit einer jährlichen Förderung von bis zu 5.000 Euro teilnehmen. Auf diese Weise soll die modellgetreue Umsetzung sowie die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Landes-programms sichergestellt werden. (Vgl. Internetauftritt des MIFKJF RP)
Emsland:
Unter dem Motto Emsland – Kinderland sind im gesamten Landkreis Emsland bis heute 25 Familienzentren entstanden. Den Anstoß hierfür gab es bereits 2005 durch den Zusammenschluss von Landkreis, Kirchen, Politik, Gemeinden, Wirtschaft, Verbänden und Vereinen zur sogenannten Großen Koalition für Kinder, gefolgt vom Förderprojekt Familien mit Zukunft. Bis zu sieben verschiedene Bausteine sind Teil der Familienzentren im Emsland, die in den einzelnen Einrichtungen jeweils bedarfsgerecht und flexibel einzusetzen sind. Darüber hinaus wird die Einrichtung einer Koordinierungsstelle in den einzelnen Familienzentren als Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf der Prozesse und Angebote sowie für die Vernetzung mit anderen Institutionen betrachtet. Die sieben Bausteine bilden gemeinsam mit der Koordination und aufbauend auf den Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangeboten von Kindertagesstätte und Schule ein emsländisches Familien-zentrum. Die Bausteine setzen sich wie folgt zusammen:
- Tagespflege/ Tagespflegevermittlung
- Ferienbetreuung
- Neue flexible Formen der Betreuung/ Ad-hoc-Betreuung
- Projekt Emsland – Kinderland (flexibles Beaufsichtigungsangebot am Nachmittag für Kinder im Alter von drei bis ca. sieben Jahren)
- Ehrenamt/ Mehrgenerationenbegegnungen
- Hort
- Bildungs- und Beratungsangebote für Familien (Vgl. Internetauftritt der Familienzentren im Emsland)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 10: Aufbau der Familienzentren im Emsland
Landkreis Osnabrück:
Seit Februar 2012 fördert der Landkreis Osnabrück flächendeckend zunächst 30 Kindertageseinrichtungen in ihrer Entwicklung zu Familienzentren. In Anlehnung an das Gütesiegel Familienzentrum NRW wurde ein abgespeckter, auf den ländlichen Raum zugeschnittener Kriterienkatalog entwickelt und in einer Broschüre herausgegeben. Ähnlich wie in NRW wird auch in diesem Kriterienkatalog zwischen A. Leistungen des Familienzentrums und B. Struktur des Familienzentrums unterschieden. Zu den Leistungen und Strukturen der Familienzentren gehören folgende Inhalte:
A. Leistungen:
- Bereithalten von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Kinder und Familien
- Bereitstellen von aktuellen Verzeichnissen und Vermittlung von passenden Angeboten in der Umgebung
- Entwicklungsgespräche auf der Basis von qualitativen Beobachtungs-verfahren
- Förderung der Familienbildung
- Aktuelles Verzeichnis von Angeboten in der Umgebung
- Elternkurse (mind. ein Kurs pro Jahr)
- Offenes Elterncafé
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Schriftliche Informationsmaterialien zum Thema Kindertagespflege
- Kooperation mit Familienservicebüro
- Bedarfsabfrage
- Ausweitung der Betreuungszeiten in Absprache mit der Kommune
B. Struktur des Familienzentrums:
- Ausrichtung des Angebots am Sozialraum
- Lenkungsgruppe
- Aufbau einer verbindlichen Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Diensten, deren Tätigkeit den Aufgabenbereich des Familienzentrums berührt
- Bekanntmachung des Angebots durch zielgruppenorientierte Kommunikation
- Sicherung der Qualität des Angebots durch Leistungsentwicklung und Selbstevaluation
(Vgl. Landkreis Osnabrück [Hrsg.] o.J.: 1ff.)
5.2. Bewertung der Kriterienkataloge
Vergleicht man die einzelnen Kriterienkataloge der verschiedenen Städte und Bundesländer, fällt auf, dass sie sich in ihrem Umfang und ihrer Differenziertheit zum Teil sehr stark voneinander unterscheiden. Einige der Kriterienkataloge sind sehr differenziert und geben eine genaue Orientierungshilfe mit konkreten Angebotsvorschlägen und Vorgaben, z.B. die Kataloge aus Nordrhein-Westfalen oder auch aus Berlin. Andere nennen wiederum lediglich Schwerpunkte und überlassen die genaue Ausgestaltung des Angebots den jeweiligen Einrichtungen vor Ort, so z.B. Thüringen und Hessen. Diese starken Schwankungen in Umfang und Differenziertheit machen deutlich, dass die Formulierung von Sozialraum übergreifenden Qualitätskriterien ein schwieriger Balanceakt ist. Denn auf der einen Seite sollte ein Kriterienkatalog möglichst alle wichtigen Bereiche abdecken, um eine hohe Qualität und Vollständigkeit des Angebotsprofils von Familienzentren sicherzustellen. Auf der anderen Seite muss ein Katalog jedoch genügend Spielraum lassen, damit sich die Einrichtungen an den konkreten Bedarfen, Strukturen und Gegebenheiten ihres Sozialraums orientieren sowie eigene, für sie wichtige Schwerpunkte setzen können.
Im Folgenden sollen die gemeinsamen Kernelemente der Kataloge benannt sowie zentrale Kritikpunkte zu ihrem Inhalt geäußert werden.
Gemeinsame Kernelemente
Inhaltlich unterscheiden sich die Kriterienkataloge in einigen Aspekten, doch es gibt bestimmte Kernelemente, die in fast allen Modellen genannt werden und somit als zentral betrachtet werden können:
- Familienbildung
- Beratung und Unterstützung von Familien
- Zusammenarbeit mit und Beteiligung von Eltern – Erziehungspartnerschaften
- Bildung, Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Sozialraumbezug, Bedarfsorientierung und Öffnung in den Stadtteil
- Kooperation und Vernetzung mit anderen Einrichtungen und Diensten im Sozialraum
- Qualitätsentwicklung und (Selbst)Evaluation
- Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen der pädagogischen Fachkräfte
- Rahmenbedingungen: Räumlichkeiten, Finanzierung, Personal
Darüber hinaus wurden in mindestens zwei der Kriterienkataloge folgende Punkte genannt:
- Kindertagespflege/ Kindertagespflegevermittlung
- Betonung einer besonderen, pädagogischen Haltung – Offenheit
- Koordinierungsstelle/ Lenkungsgruppe
Geringe Berücksichtigung der Selbsthilfeorientierung
Fast alle Modelle betonten und berücksichtigen einen wichtigen Punkt wenig, der für die Arbeit von Familienzentren ganz zentral ist: die Selbsthilfeorientierung der Angebote. Denn wenn Familienzentren den Anspruch erfüllen wollen, Familien darin zu unterstützen, ihre Lebenssituation selbstständig und selbstbestimmt bewältigen zu können und mehr Sicherheit und Selbstvertrauen im familiären Miteinander zu gewinnen, ist die Selbsthilfeorientierung der Angebote sowie die Förderung von Selbsthilfeinitiativen ein zentraler, Qualität beeinflussender Aspekt und sollte auch als solcher explizit genannt werden.
Unzureichende Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensalter
Darüber hinaus wird in keinem der vorgestellten Kriterienkataloge eine Differenzierung der Angebote nach Lebensalter vorgenommen. So gibt es beispielsweise weder einen eigenen Qualitätsbereich für Familien mit Kindern unter drei Jahren noch für Grundschulkinder oder das Jugendalter. Im Gütesiegel Familienzentrum NRW werden in den Qualitätsbereichen Beratung und Unterstützung von Familien, Kindertagespflege und Vereinbarkeit von Familie und Beruf lediglich sporadisch einzelne Angebote für Kinder unter drei Jahren genannt wie bspw. Eltern-Kind-Kurse oder Betreuungsangebote für unter Dreijährige. Grundschulkinder und Senioren werden jeweils nur einmal erwähnt im Bereich Sozialraumbezug, Angebote für Jugendliche kommen gar nicht vor. Ähnlich sieht es im Berliner Modell des EEC-Ansatzes und in Hannover aus. Hier liegt der Fokus insbesondere auf der Unterstützung von Familien mit Kindern in den ersten 10 Lebensjahren. Auch Lebensalter und Generationen übergreifende Angebote und Konzepte werden insgesamt wenig berücksichtigt. Wenn jedoch ein Familienzentrum in einem Umfeld entsteht, in dem ein starker Bedarf an der Einbindung anderer Altersgruppen wie z.B. Jugendlichen und Senioren besteht, findet dieses Familienzentrum in den oben vorgestellten Kriterienkatalogen keine angemessene Orientierung für den Entwurf eines qualitativ hochwertigen, Lebensalter übergreifenden Angebots. Ein hochwertiger Kriterienkatalog muss demnach beides leisten: Er muss zum einen die Möglichkeit geben, einen besonderen Fokus auf bestimmte Alters- und Zielgruppen legen zu können, wenn dies erforderlich ist, und er muss zum anderen in jedem wichtigen (Alters-)Bereich eine angemessene Orientierung geben und entsprechende Qualitätsstandards zur Verfügung stellen.
Zu grobe Einteilung der Kategorien
Ein weiteres Problem bei den oben dargestellten Konzepten ist, dass in sehr großen Kategorien gedacht wird. So sind beispielsweise beim Gütesiegel Familienzentrum NRW die einzelnen Qualitätsbereiche sehr weit gefasst und schließen zum Teil andere, ebenfalls wichtige Aspekte mit ein. So werden im Qualitätsbereich Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien auch Eltern-Kind-Gruppen für Familien mit unter Dreijährigen, Entwicklungsscreenings und Maßnahmen zur Sprachförderung genannt. Hinter diesen Angeboten verbergen sich jedoch enorm wichtige und große Bereiche, die für sich genommen nicht noch einmal aufgegriffen und näher ausgeführt werden:
- Angebote für Familien mit Kindern unter drei Jahren
- Maßnahmen zur Früherkennung und frühe Hilfen
- individuelle Förderung von Kindern mit Teilleistungsschwächen
Da diese wichtigen Bereiche im Gütesiegel Familienzentrum NRW jedoch nicht vollständig, sondern nur in Form von einzelnen Angeboten unter weiteren genannt werden, besteht die Gefahr, dass sie komplett wegfallen, wenn ein Familienzentrum genügend andere Angebote aus dem selben Qualitätsbereich vorhält. Auf diese Weise würden einzelne Zielgruppen nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Modelle greifen zu kurz
Insgesamt greifen die vorgestellten Modelle inhaltlich und konzeptionell zu kurz, auch die Förderbedingungen sind vielerorts nicht ausreichend. Betrachtet man bspw. das nordrhein-westfälische Modell kann eine finanzielle Förderung von 12.000 bzw. 13.000 Euro pro Jahr und Einrichtung nicht zur Realisierung von qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Familienzentren führen. Zumindest nicht, wenn sie nicht zusätzlich unterstützt werden wie bspw. durch eine Koordinierungsstelle des Jugendamts. In solchen Programmen besteht die Gefahr, dass sich Einrichtungen mit dem Projekt Familienzentrum überfordern und nicht wesentlich über das Modell „Kindertageseinrichtung Plus“ hinauskommen, da sie all ihre Aufgaben und Angebote weitestgehend mit eigenen Kräften stemmen müssen.
Aufgrund dieser Kritikpunkte an den vorhandenen Kriterienkatalogen bedarf es eines neuen Entwurfs, in welchem eine stärkere Differenzierung zwischen den einzelnen Angebotsbereichen von Familienzentren vorgenommen wird. Ein Entwurf mit flexibel zu kombinierenden Bausteinen, die alle wichtigen Bereiche abdecken und dennoch die Freiheit geben, Schwerpunkte zu setzen sowie gegebenenfalls einzelne Bereiche zusammenzufassen oder auszudünnen. Auf diese Weise kann ein maßgeschneidertes Angebot entstehen, das sich an den individuellen Bedarfen und Gegebenheiten vor Ort orientiert und dennoch hochwertigen Qualitätsstandards entspricht.
5.3. Berücksichtigung der Besonderheiten unterschiedlicher Zielgruppen und Sozialräume bei der Entwicklung maßgeschneiderter Qualitätskriterien
Bei der Entwicklung maßgeschneiderter Qualitätskriterien für ein Familienzentrum müssen immer die Besonderheiten der unterschiedlichen Zielgruppen sowie die sozialen Bedingungen und Strukturen des jeweiligen Sozialraums berücksichtigt werden. Familienzentren richten sich in ihren Angeboten zwar grundsätzlich an alle Familien eines Sozialraums und nicht nur an einzelne Zielgruppen, doch es gibt Gebiete, in denen es einen besonders hohen Anteil einer bestimmten Zielgruppe mit besonderen Bedürfnissen und Bedarfen gibt, auf die Familienzentren in besonderem Maße eingehen müssen. Im Folgenden sollen vier besonders prägnante Zielgruppen sowie der ländliche Raum mit ihren Besonderheiten vorgestellt werden:
- Der ländliche Raum
- Zielgruppe: Gut situierte, bildungsnahe Familien
- Zielgruppe: Sozial benachteiligte und bildungsferne Familien
- Zielgruppe: Familien mit Migrationshintergrund
- Zielgruppe: Familien mit Kindern mit Behinderung und/ oder sonderpädagogischem Förderbedarf
Diese Beschreibungen sollen Hinweise darauf geben, welche besonderen Bedarfe es bei bestimmten Zielgruppen geben kann und welche Angebote in der Folge als geeignet und sinnvoll erscheinen.
In der Beschreibung der bildungsnahen und bildungsfernen Familien wird u.a. auf die Ergebnisse der Studie Eltern unter Druck zurückgegriffen, welche auf den so genannten Sinus-Milieus aufbaut. Hierbei wird die deutsche Gesellschaft in neun verschiedene soziale Milieus eingeteilt, in Abhängigkeit von der jeweiligen Grundorientierung sowie der sozialen Lage der Menschen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenAbb. 11: Sinus-Milieus in Deutschland 2009
Die Studie hat die Lebenslagen und Besonderheiten von Familien und Eltern in den verschiedenen familiären Milieus untersucht. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Verteilung von Elternschaft und Alter konzentriert sich die Studie insbesondere auf folgende Milieus:
- Bürgerliche Mitte (18,8 % der Eltern insgesamt)
- Etablierte (14,6% der Eltern)
- Postmaterielle (12,5 % der Eltern)
- Moderne Performer (12,4 % der Eltern)
- Konsum-Materialisten (11,6 % der Eltern)
- Hedonisten (10,2 % der Eltern)
- Experimentalisten (8,5 % der Eltern) (Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard 2008: 29 f.)
In der nachfolgenden Beschreibung der einzelnen Milieus wird am Ende jeweils eine Analyse von möglichen Gefahren, Problemlagen und Bedarfen vorgenommen. Zwar ist es in Familienzentren wichtig, einen ressourcenorientierten Blick auf Kinder und Familien zu haben, gleichzeitig birgt die Analyse von Risiken und möglichen Problemlagen jedoch die Chance, diese in einem Umkehrprozess zu positiven Zielen umzuformulieren, Bedarfe festzustellen und einen ersten maßgeschneiderten Handlungsplan zu entwickeln (siehe auch Kapitel 7).
In der Beschreibung der sehr heterogenen Zielgruppe Familien mit Migrationshintergrund wird ebenfalls auf die Ergebnisse einer Sinus-Studie zu den Migranten-Milieus in Deutschland von 2008 zurückgegriffen.
5.3.1. Der ländliche Raum
Den ländlichen Raum gibt es heute nicht mehr, denn auch innerhalb der ländlichen Räume gibt es sehr viele unterschiedliche Ausgangsbedingungen. So gehören zum ländlichen Raum nicht nur Dörfer, sondern auch die entsprechenden Klein- und Mittelstädte, welche als zentrale Orte mit sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Einrichtungen das Umland mit versorgen sollen. Darüber hinaus kann man zwischen Dörfern unterscheiden, die auf den zentralen Entwicklungsachsen liegen und sich meist selbst zu infrastrukturell entwickelten größeren Dörfern oder ländlichen Kleinstädten entwickeln, sowie zwischen peripheren Dörfern, welche den zentralen Entwicklungsachsen eher abgewandt sind. Diesen peripheren Dörfern gehen die ehemals selbständigen dörflichen Zentren mit Kirche, Gemeindehaus, Grundschule etc. aufgrund der Konzentration auf die zentralen Orte mehr und mehr verloren. In den größeren Dörfern bzw. ländlichen Kleinstädten entstehen hingegen zum Teil auswuchernde, trabantendorf-ähnliche Neubaugebiete mit einem hohen Anteil an orts- und regionsfremden Neusiedlern. (Vgl. MASGFF RP [Hrsg.] 2009: 7)
Darüber hinaus gibt es im heutigen modernen, regionalen Dorf eine breite Vielschichtigkeit von nebeneinander existierenden unterschiedlichen Zeitkulturen. So existieren auch heute noch alt-dörfliche Verhaltensweisen und Kindheitsmuster, tradierte Kinderrituale und von den Eltern überlieferte Spielformen parallel zur neuen Vielfalt der modernen Kultur- und Lebensstile. Dementsprechend gibt es heute kein fixes Grundmodell von Landkindheit mehr, sondern nur noch Kindheiten auf dem Lande. (Vgl. Stange 2008: 137 f.)
Insgesamt wurde es seit dem Modernisierungsprozess der 70er Jahre immer schwieriger, typische Merkmale für das Leben auf dem Lande zu ermitteln. Städtische Lebensweisen wurden hineingetragen, die Landwirtschaft wurde mit heute nur noch drei Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland stark zurückgedrängt, die Mobilität ist gestiegen. (Vgl. MASGFF RP [Hrsg.] 2009: 7)
Dennoch können bestimmte Haupttrends formuliert werden, die den modernen Lebensalltag auf dem Lande beschreiben:
- Regionalisierung und Mobilisierung: Alltägliches regionales Pendeln wird zur Lebensgewohnheit und führt dazu, dass viel mehr Zeit unterwegs verbracht wird.
- Zentralisierung: Das Dorf dünnt durch die Zentralisierung der Versorgungseinrichtungen infrastrukturell aus und übernimmt zunehmend die Funktion des Siedlungsraums für die Zentralgemeinde.
- Motorisierung: Die PKW-Dichte im ländlichen Raum nimmt stetig zu.
- Individualisierung: Die Kinderzahl pro Familie nimmt stark ab, während die Konsum- und Mobilitätserwartung zunimmt.
- Vervielfältigung und Vereinzelung: Es gibt immer mehr unterschiedliche Vereine und spezialisierte Hobby- und Interessengruppen, die um die sinkende Zahl der Dorfjugendlichen konkurrieren.
- Demografische Entwicklungen: Durch den Rückgang der Kinderdichte in der Nachbarschaft werden die Wege zu Spielkameraden immer länger und das spontane Spiel auf der Straße uninteressanter, da es dort keine anderen Kinder mehr gibt.
- Segmentierung: Das Dorf wird nicht mehr als Gesamtraum, sondern nur noch in Dorfstationen wahrgenommen.
- Sozialraumverluste: Die Funktionsanlässe, ins Dorf zu gehen und sich dort aufzuhalten nehmen ab, während die Zahl der nicht mehr erlebten und durch eigene Erfahrungen erkundeten Räume vor Ort zunimmt.
- Anregungsverluste: Das Dorf als reines Wohndorf ist als Spielraum unattraktiv. Auf den Straßen spielt sich kaum noch Leben ab, überall grenzt Privatzone an Privatzone.
- Funktionsraumverluste: Die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sind nicht mehr im Dorf zu befriedigen, da die Freunde, das Konsumverhalten und die Treffpunkte überregional verstreut sind.
- Bedeutungsverluste: Das Dorf sowie das alte Dorfwissen sind für die eigene Entwicklung und Zukunftsplanung immer weniger von Bedeutung.
- Modernisierungsdruck: Globale Modetrends, weltweite Konsumkampagnen, subkulturelle Lifestyle-Vorgaben, Trendsetter, Spielzeug-Favoriten und ständig wechselnde Lebensabschnittsbedürfnisse beschleunigen den Kinderalltag und üben einen psychologischen Druck aus, bei diesen Trends dabei sein zu müssen.
- Ent-Räumlichung: Die Streifzüge im Dorfraum nehmen ab und das Dorf wird zunehmend als Durchfahrtsraum wahrgenommen. Es reduziert sich mehr und mehr auf den bebauten und asphaltierten Siedlungsraum.
- Raum-Privatisierung: Das privatisierte Spielen mit verabredeten Kindern ersetzt zunehmend das öffentliche Spielen auf der Straße.
- Institutionalisiertes Spielen: Die Kinder sind immer weniger in der Lage, sich selbst zu beschäftigen und über einen längeren Zeitraum hinweg selbstorganisiert zu spielen; deshalb ersetzen neue Kinderspiel- und Kinderkulturangebote zunehmend das alte Dorfspiel.
- Zonierte Spielräume: Seit den 70er Jahren ist das Kinderspielen massiv auf feste Spielzonen begrenzt worden und Kinder werden in diese speziellen Kinderräume verwiesen.
- Ent-Ländlichung: Die „urländlichen“ Erfahrungen aus der Landwirtschaft beschränken sich meist auf eigene Familienerfahrungen, Nachbarschaftsbeobachtungen oder auf Spielfreundschaften. (Vgl. Stange 2008: 142 ff.)
Eine besondere Herausforderung ist außerdem der demografische Veränderungsdruck, der in ländlichen Gebieten stärker besteht als in städtischen. So wird der Anteil der 20 bis 65-Jährigen, die sowohl im Arbeitsleben als auch im Ehrenamt aktiv sind, in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich abnehmen, während der Anteil der 65 bis 80-Jährigen wächst. Diese sinkende Bevölkerungsdichte gefährdet die wirtschaftliche Tragfähigkeit von öffentlichen und privaten Versorgungseinrichtungen, sodass sich der Rückgang wohnungsnaher Infrastruktur in den peripheren Dörfern weiter fortsetzt. In der Folge fehlen Arbeitsplätze für die jüngeren Generationen, sodass diese gezwungen sind, wegzuziehen oder zu pendeln. Gewachsene soziale Strukturen und familiäre Bindungen lockern sich und das Eingebundensein in Familie, Verwandtschaft und Nachbarschaft ist nicht mehr selbstverständlich, was insbesondere die zurückgebliebenen älteren Menschen sowie die wenigen jungen Familien trifft, die noch dort wohnen. Periphere Dörfer stehen somit vor der Herausforderung, sowohl möglichst wohnortnahe medizinische und soziale Betreuung und Versorgung für ältere Menschen sicherzustellen als auch Gelegenheitsstrukturen für Kinder und Jugendliche zum Zusammensein mit Gleichaltrigen zu schaffen. (Vgl. MASGFF RP [Hrsg.] 2009: 8 ff.)
Auch der familiale Wandel macht vor dem ländlichen Raum nicht halt, wie ein Blick auf die Scheidungsraten zeigt. Der Anteil der Alleinerziehenden ist zwar auf dem Lande noch geringfügig kleiner als in der Stadt, doch kann sich die Lebenslage alleinerziehend aufgrund der schlechteren Erwerbsmöglichkeiten für Frauen sowie des geringeren Angebots an Kinderbetreuungs-möglichkeiten sehr drastisch auf die Lebensbedingungen der betroffenen Familien auswirken. Fehlen dann noch zusätzlich private Netze und familiäre Unterstützung, kann dies schnell zu prekären Lebenslagen führen. Insgesamt sind soziale Benachteiligungen wie Arbeitslosigkeit und Armut jedoch in Städten weitaus stärker ausgeprägt als im ländlichen Raum. (Vgl. MASGFF RP [Hrsg.] 2009: 8 ff.)
Die infrastrukturell entwickelten größeren Dörfer und ländlichen Kleinstädte haben im Gegensatz zu den peripheren Dörfern meist eine Zuwanderung von Familien mit Kindern zu verzeichnen, welche die Ballungsräume der größeren Städte verlassen haben oder aus den peripheren Dörfern kommen. Da bei diesen Neusiedlerfamilien der Anteil an erwerbstätigen Frauen vergleichsweise groß ist, haben sie meist einen hohen Bedarf an Angeboten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber hinaus braucht es neue Formen des sozialen Miteinanders, damit sich die Neusiedler in die Dorfgemeinschaft integrieren können, denn über die traditionellen Vereine und Institutionen ist dies nicht mehr zu leisten. (Vgl. MASGFF RP [Hrsg.] 2009: 10)
Ein weiterer Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Gebieten ist die Verteilung von Menschen mit Migrationshintergrund. Insgesamt leben in Städten deutlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund, doch auch in Bezug auf Herkunftsland und kulturellen Hintergrund bestehen Unterschiede in der Verteilung. So siedelten sich bspw. die Gastarbeiter aus Italien, Spanien, Portugal, Jugoslawien und der Türkei zwischen 1950 und 1970 überwiegend in den Groß-, Mittel- und Kleinstädten an, kaum jedoch in den Dörfern. Von der Aufnahme von Asylsuchenden, Flüchtlingen und AussiedlerInnen in den 80er und 90er Jahren waren die Dörfer hingegen stärker betroffen, da die entsprechenden Auffang- und Übergangswohnheime vermehrt im ländlichen Raum eingerichtet wurden. Hier kam es aufgrund von weitgehender Immobilität und fehlenden Arbeitsmöglichkeiten für die BewohnerInnen zu segregierten Wohnsituationen ohne Kontakt zur ansässigen Bevölkerung. Nach Auslaufen der Wohnortzuweisung orientierten sich überwiegend Russlanddeutsche auf die ländlichen Räume, mit bevorzugtem Wohnsitz in der Nähe zu Verwandten und Bekannten. Dies führte zu konzentrierten Ansiedlungen von AussiedlerInnen in den Dörfern und Gemeinden und wirkte sich deutlich erschwerend auf deren Integration aus. Stigmatisierung, soziale Ausgrenzung und geringe Teilhabechancen waren die Folge und führten wiederum zur Kumulation bestimmter Problemlagen wie Arbeitslosigkeit und Armut. Besondere Herausforderungen für Familienzentren im ländlichen Raum sind deshalb die Sicherstellung gleichberechtigter Teilhabechancen, die Überwindung der räumlichen und sozialen Segregation, das Schaffen von Gelegenheitsstrukturen für Begegnungen zwischen der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund sowie soziale Entwicklungsprozesse zur Attraktivierung der teilweise bereits benachteiligten Wohngebiete. (Vgl. MASGFF RP [Hrsg.] 2009: 10 f.)
5.3.2. Zielgruppe: Gut situierte, bildungsnahe Familien
Mit gut situiert und bildungsnah sind Familien der mittleren bis oberen Mittelschicht bzw. Oberschicht gemeint, in denen die Eltern einen qualifizierten mittleren bis hohen Bildungsabschluss sowie ein mittleres bis hohes Einkommen haben. Da die Familien sowie deren Lebensentwürfe und Bedarfe in diesen Sozialräumen sehr heterogen sind, soll an dieser Stelle auf die familiären Milieus der Sinus-Studie Eltern unter Druck zurückgegriffen werden. Familiäre Milieus, die überwiegend als bildungsnah bezeichnet werden können, sind die Bürgerliche Mitte, die Etablierten, die Postmateriellen, die Modernen Performer und die Experimentalisten. Gut situiert meint hier, dass der überwiegende Teil dieser Milieus keine massiven finanziellen Probleme hat und somit ein gewisser finanzieller Spielraum vorhanden ist, in die Förderung ihrer Kinder zu investieren.
Bürgerliche Mitte:
Familien der Bürgerlichen Mitte können auch als statusorientierter Mainstream bezeichnet werden. Sie streben danach, in gut gesicherten Verhältnissen zu leben und sind teilweise von Abstiegsängsten geplagt. Das Milieu ist sehr kinderfreundlich und es umfasst ca. 19% der Eltern insgesamt. Der Altersschwerpunkt liegt bei 30 bis 60 Jahren. Der größte Teil der Bürgerlichen Mitte verfügt über einen qualifizierten mittleren Bildungsabschluss und arbeitet als einfache(r) bis mittlere(r) Angestellte(r), Beamte(r) oder FacharbeiterIn mit mittlerem Einkommen. Die Familien dieses Milieus haben einen bodenständigen, realistischen Lebensstil, bestehen häufig aus beiden Elternteilen und mehreren Kindern und finanzieren sich oftmals aus einem vollen Haushaltseinkommen, in der Regel durch den Vater.
Die Gründung einer Familie wird für Paare der Bürgerlichen Mitte als identitätsstiftender Faktor erlebt und das Familienleben ist stark kindzentriert und geordnet. Für die Hobbys der Eltern bleibt selten genügend Zeit und Raum, sie versuchen jedoch, sich kleine Oasen der persönlichen Freizeitgestaltung zu erhalten.
Die Mutter leistet eine aufopfernde Erziehungsarbeit, die nahezu keine Grenzen kennt; der Vater orientiert sich an dem Ideal-Bild des modernen Vaters, der seine freie Zeit gerne mit seinen Kindern verbringt. Die Rollenverteilung kann als traditionell in einem modernen Sinne betrachtet werden: Die Partner ergänzen sich mit ihren unterschiedlichen, aber gleichwertigen Aufgabenbereichen gegenseitig im Team. Gleichzeitig fühlen sich viele Mütter unter Druck, sich den gesellschaftlichen Trends anpassen zu müssen und mit ihrem Dasein als Hausfrau und Mutter zunehmend gesellschaftlich diskreditiert. Dies und finanzielle Gründe können ausschlaggebend für einen Wiedereinstieg in den Beruf sein, jedoch meist erst ab einem Alter des Kindes von drei Jahren und nur in Teilzeit bis max. 20 Stunden oder auf 400-Euro-Basis.
Insgesamt erschaffen die Eltern ihren Kindern einen (über-)behüteten und schützenden Rahmen und die Sorge um die Sicherheit der Kinder ist stark ausgeprägt. Gegenüber den Medien legen sie eine gemäßigt kritische Haltung an den Tag, in der Realität ist Fernsehen jedoch oft fester Bestandteil des Alltagslebens und hat eine entspannende Funktion. Insgesamt hat das Milieu eine starke Außenorientierung.
Das wichtigste Erziehungsziel ist eine glückliche und erfolgreiche Entwicklung der Kinder, Schulerfolg und frühkindliche Fördermaßnahmen werden als Garant für eine sichere und glückliche Zukunft gesehen und müssen finanziert und organisiert werden. Auch die Mitgliedschaft in Vereinen spielt eine große Rolle. Dementsprechend befinden sich Eltern der Bürgerlichen Mitte oftmals in einem Spannungsfeld: Da die Durchlässigkeit nach oben in ihren Augen immer schwerer wird, haben sie das Gefühl, ihre Kinder besonders früh und intensiv fördern zu müssen. Gleichzeitig wünschen sie sich für ihre Kinder jedoch, dass sie in der Schule nicht durch frühe Selektion unter Druck gesetzt werden. Darüber hinaus sind sie oftmals vor das Problem gestellt, dass frühkindliche Fördermaßnahmen nicht immer finanzierbar und die Angebote häufig unübersichtlich sind.
(Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard 2008: 140 ff.)
Experimentalisten:
Experimentalisten sind ein junges Milieu mit einem Altersschwerpunkt unter 30 Jahren. Unter ihnen gibt es viele Single-Haushalte und Alleinerziehende, Rollen, Zwänge und lebenslange Festlegungen lehnen sie ab. Sie leben nach den zentralen Werten Individualität, Kreativität, Identität, Freiheit, Offenheit und Toleranz.
Sie sind locker, tolerant und offen gegenüber anderen Lebensformen und Kulturen und haben ein großes Interesse an Musik, Kunst und Kultur; häufig zeigen sie auch eine gesellschaftliche Protesthaltung und eine Vorliebe für stilistische Provokationen. Sie leben ein spontanes intensives Leben und streben nach Selbstentdeckung und -verwirklichung, z.T. auch über Grenzerfahrungen. Daraus folgt, dass sie insgesamt einen hohen Anspruch an Betreuungs-, Kunst-, Musik-, Sport- und Erlebnisangebote für sich und ihre Kinder haben.
Mit der Geburt eines Kindes beginnt häufig ein Reifungsprozess und eine neue, bewusste Lebensphase. Elternschaft wird als spannende und bereichernde Aufgabe erlebt, die Selbstvertrauen und Klarheit über die eigene Identität und die Zukunft gibt. Das Verantwortungsgefühl und das berufliche Engagement zur finanziellen Absicherung steigen, doch ein Verlust von Freiheit und Identität wird selten beklagt. Diese Veränderung macht jedoch auch privat häufig eine Neuorientierung notwendig, da es teilweise zum Bruch mit dem bisherigen Freundes- und Bekanntenkreis kommen kann. Meist lernen sie aber schnell neue Leute in ähnlichen Lebenslagen kennen und bauen sich ein enges und intensives Netzwerk von Nachbarn und Freunden auf.
Der Alltag wird bestimmt durch Abwechslung und hohe Aktivität, sie sind gerne unterwegs und unter Menschen. Das Kind ist bei allen Aktivitäten ganz selbstverständlich dabei und lernt viele unterschiedliche Welten kennen. Auf diese Weise erlebt es Wärme und Geborgenheit durch die Integration in unterschiedliche soziale Kreise (anstatt durch Cocooning, wie es bei der Bürgerlichen Mitte häufig geschieht).
Insgesamt haben Experimentalisten ein gehobenes Bildungsniveau und sind vielfach noch in Ausbildung oder arbeiten als mittlere Angestellte, kleine Selbstständige oder Freiberufler, wobei sie meist kreative Berufe als Form der Selbstverwirklichung bevorzugen. Kann dies jedoch aus Gründen der finanziellen Sicherheit nicht gelebt werden, kann es zu Frustrationen kommen.
Das Partnerschaftsverständnis ist sehr modern und das Rollenverhalten flexibel, für Experimentalisten müssen Partnerschaften lebendig, spannend und intensiv sein. Nach ihrer Grundvorstellung müssen Gleichberechtigung und Selbstständigkeit herrschen, sie sind jedoch gegen eine verkrampfte Auseinandersetzung mit traditionellen oder modernen Rollen. Zudem sind sie überzeugt, dass ein Kind beide Eltern braucht, um sich gesund entwickeln zu können – auch im Falle einer Trennung.
Aus emotionalen und/ oder lebenspraktischen Gründen übernimmt die Mutter oft den größeren Teil der Erziehungsarbeit, bekommt von ihrem Partner aber auch Freiräume zugestanden, in denen sie sich Zeit für sich selbst nehmen kann. Die Erziehungsarbeit wird insgesamt sehr optimistisch, selbstbewusst und unkompliziert angegangen, da Fehler ihrer Meinung nach zum Leben dazugehören. Experimentalistische Mütter sehen sich selbst häufig als begeisterte, sich selbst entdeckende Mutter und sind stets bestrebt, ihr Kind und dessen Meinung ernst zu nehmen. Das Erziehungsverhalten ist überwiegend intuitiv und situativ, dennoch sind sie über innovative pädagogische Ansätze meist gut informiert. Eines der wichtigsten Erziehungsziele ist die Selbstständigkeit. Deshalb möchten auch die Väter ihren Kindern genug Freiraum sowie die Möglichkeit geben, verschiedene Perspektiven erproben zu können. Betüddelndes, moralisches und regelfixiertes Verhalten lehnen sie ab. Insgesamt ist es das Ziel der Eltern, ihrem Kind als Partner zur Seite zu stehen und Verlässlichkeit vorzuleben. Das Kind wird mit seiner Sicht der Dinge ernst genommen, soll in einem geschützten Raum seine eigenen Erfahrungen machen und sich frei entwickeln können. Rituale im Alltag und vorgelebte Maßstäbe geben dem Kind einen gewissen Orientierungsrahmen, ohne es zu sehr einzugrenzen. So wird eine Balance zwischen Loslassen und Führung angestrebt.
(Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard 2008: 182 ff.)
Postmaterielle:
Die Altersgruppe der Postmateriellen ist sehr breit, der Schwerpunkt liegt bei 30 bis 50 Jahren. Sie zeichnen sich durch eine liberale, weltoffene und tolerante Grundhaltung sowie durch Multikulturalität, Verantwortungsethik und eine zunehmende Entideologisierung aus. Bildung wird als eine humanistische Tugend angesehen.
In postmateriellen Familien haben oftmals beide Elternteile eine akademische Bildung und tragen überwiegend als qualifizierte und leitende Angestellte, Beamte oder Freiberufler zu einem doppelten Einkommen in mittlerem bis höheren Niveau bei. Familiären und beruflichen Anforderungen treten sie selbstbewusst entgegen, schaffen sich im Gegenzug aber auch ihre Freiräume und pflegen die Lebenskunst.
Postmaterielle Mütter sehen sich selbst häufig in der Rolle einer Lebensphasen-Begleiterin, die sie selbst bleiben und ihre Kinder einen wichtigen Teil ihres Lebens begleiten möchte. So sollen die Kinder selbst ihren Platz finden können und selbstbestimmt glücklich sein. Eltern sehen sich selbst als natürliche Autorität und pflegen einen autoritativen Erziehungsstil mit individuellen Elementen. Das Kind wird als Gesprächspartner ernst genommen und mit Augenmaß gefördert. Insgesamt haben postmaterielle Eltern hohe Ansprüche an die eigene Erziehungsleistung, sind aber auch offen gegenüber pädagogischer Unterstützung.
Für beide Eltern ist es wichtig, Gleichberechtigung vorzuleben und der Vater ist als partizipierender Erzieher bei allen Themen gemeinsam mit der Mutter gleichgestellt zuständig. Eine traditionelle Rollenverteilung lehnen sie ab. Viele Eltern werden durch die Elternschaft jedoch von der Realität eingeholt und rutschen in eine eher traditionelle Rollenverteilung hinein, was z.T. zu Frustration und Spannungen führen kann.
Probleme, die von postmateriellen Familien geäußert werden, sind die wenig familienfreundliche Umwelt und Arbeitswelt, die noch immer mangelnde Anerkennung von neuen Rollen in der Gesellschaft sowie mangelnde qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsmöglichkeiten als Orte des sozialen Miteinanders. Auch im Umgang mit Medien sind sie eher kritisch.
(Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard 2008: 94 ff.)
Moderne Performer:
Moderne Performer haben ein hohes Bildungsniveau und können als junge, unkonventionelle Leistungselite bezeichnet werden. Der Altersschwerpunkt liegt bei unter 30 Jahren und unter ihnen gibt es viele Studierende, Selbstständige, Freiberufler und qualifizierte leitende Angestellte mit einem hohen Haushaltsnettoeinkommen.
Sie führen ein intensives, flexibles und multioptionales Leben mit einer Mischung aus Leistungsehrgeiz und materiellem Erfolg sowie dem Streben nach Selbstverwirklichung und lustvollem Leben.
Elternschaft wird häufig als anstrengender empfunden als die bisherige Lebenssituation, da sie ihr Grundbedürfnis nach Multioptionalität und Flexibilität nicht mehr im gleichen Maße ausleben können, gleichzeitig wird das Familienleben aber auch als Bereicherung erlebt.
Die Rolle der Mutter als Profi-Mama wird selbstbewusst ausgelebt und professionell organisiert. Das Projekt Kind war eine bewusste Entscheidung und wird dementsprechend gemanagt, sodass Beruf und Familie bestmöglich miteinander vereint werden können. Meist steigt die Mutter nach sehr kurzer Babypause wieder in den Beruf ein.
Insgesamt setzt sie ihre eigene, intuitive Vorstellung von Erziehung um, bei konkreten Fragen informiert sie sich fokussiert. Die Vaterrolle entspricht einem liebevoll-professionellen Part-Time-Event-Papa am Wochenende, der sich unter der Woche überwiegend seiner Karriere widmet. Der Erziehungsstil ist autoritativ mit einer klaren Orientierung an Regeln und Vorschriften und die Eltern haben meist hohe Anforderungen an ihr Kind. So wird es möglichst früh und gut gefördert, sodass es in den Bereichen seiner Begabungen überdurchschnittliche bzw. Bestleistungen erbringen kann. Dies spiegelt ein eher funktionales Verständnis von Erziehung wieder: Input (Förderung, Hilfestellung, Vorgaben) führt zu Output (leistungsfähiges, sich abhebendes Kind).
Moderne Performer -Familien äußern sich häufig kritisch über die gesellschaftliche Stellung von Familien sowie die Qualität von öffentlichen Betreuungsmöglichkeiten. Zudem halten sie häufig eine bewusste Distanz zu benachteiligten Familien – aus Angst, das eigene Kind könnte durch die anderen in seiner Entwicklung ausgebremst werden. In der Folge ist eine überwiegende Nutzung privater Betreuungsarrangements zu beobachten.
(Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard 2008: 121 ff.)
Etablierte:
Etablierte Familien sind überdurchschnittlich hoch gebildet, gut situiert und verfügen häufig über ein doppeltes Einkommen in höherem bis höchstem Niveau. Sie sehen sich als die selbstbewusste Elite unserer Gesellschaft mit hohen Exklusivitätsansprüchen, ausgeprägtem Statusdenken, Kennerschaft und Stil – eine bewusste Abgrenzung zu anderen Milieus.
Am gesellschaftlichen und politischen Leben nehmen sie intensiv Teil und verfolgen einen modernen Leistungsgedanken, gleichzeitig sind sie traditionsverwurzelt und leben eine traditionelle Rollenverteilung. Die Altersgruppe ist sehr breit mit einem Schwerpunkt zwischen 35 und 64 Jahren, die Haushalte umfassen meist drei bis vier Personen.
Etablierte Mütter leben häufig nach dem Rollenbild der Erziehungs-Managerin, die sich mit liebevollem und professionellem Weitblick um die Entwicklung und frühe Förderung der Kinder kümmert. Gleichzeitig nimmt sie sich Freiräume für eigene Interessen und bezieht professionelle Dritte in die Erziehung und Förderung mit ein, um ihren Kindern optimale Startchancen im Wettbewerb zu ermöglichen. Dennoch wünschen sich etablierte Mütter häufig eine Auszeit von der täglichen Routine.
Der Vater fungiert oftmals als Familienvorstand und überlegter Weichensteller, der den Kindern mit Verständnis und sanfter Strenge begegnet und im Einvernehmen mit der Mutter bei zentralen Entscheidungen das letzte Wort hat. Dabei sorgt er für die Wahrung einer gewissen Etikette und setzt klare Richtungsvorgaben. Seine starke berufliche Einbindung verlangt eine hohe Mobilität und zeitliche Flexibilität, sodass das Familienleben häufig auf die Wochenenden verlagert, dann aber bewusst gemeinsam verbracht wird. Trotz des knappen Zeitbudgets ist bei Etablierten insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation zu beobachten.
Die Ehe wird als ideale Form des Zusammenlebens betrachtet und muss um jeden Preis erhalten werden. Toleranz und Rücksichtnahme hat für die Ehepartner deshalb eine besondere Bedeutung; Probleme werden so weit wie möglich vermieden oder verdrängt.
Die Kinder werden häufig mit hohen Leistungserwartungen und einer starken zeitlichen Verplanung ihres Alltags konfrontiert, was dazu führt, dass ihrer Selbstentwicklung häufig enge Grenzen gesetzt werden. Für die bestmögliche Förderung ihrer Kinder setzen sie bevorzugt auf Individuelle Betreuungsarrangements wie z.B. eine eigene Kinderfrau und Privatschulen. Institutionelle Betreuungsmöglichkeiten werden eher selten in Anspruch genommen. Trotz dieser hohen Abgrenzungstendenz äußern Etablierte häufig die Forderung, dass sozial schwächer gestellte Kinder und Familien besser unterstützt werden sollten.
(Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard 2008: 76 ff.)
5.3.3. Zielgruppe: Sozial benachteiligte und bildungsferne Familien
Auch in sozial benachteiligten Sozialräumen ist es sinnvoll, sich anhand der Sinus-Milieus der unteren Mittelschicht bzw. Unterschicht ein genaueres Bild von den jeweiligen Zielgruppen zu machen, um daraus besondere Bedarfe ableiten zu können. Hierfür sollen im Folgenden die familiären Milieus Konsum-Materialisten und Hedonisten beschrieben werden, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass keinesfalls alle Familien dieser beiden Milieus als bildungsfern und sozial benachteiligt bezeichnet werden können und hier lediglich Tendenzen beschrieben werden.
Konsum-Materialisten:
Konsum-Materialisten leben häufig in einer prekären finanziellen Lage und versuchen dies über spontanen und prestigeträchtigen Konsum zu verdecken mit dem Ziel, als normaler Durchschnittsbürger wahrgenommen zu werden und dazuzugehören. Ihrem Gefühl, sozial ausgegrenzt zu werden, begegnen sie meist mit Ohnmacht und suchen die Schuld im Außen. So kritisieren sie gesellschaftlich eine erlebte Diskriminierung von Mehrkindfamilien sowie eine mangelnde finanzielle Unterstützung. Ihrerseits bemühen sie sich jedoch ebenfalls, sich gegenüber Randgruppen und Ausländern abzugrenzen.
Für Konsum-Materialisten besteht der Sinn von Arbeit im Geldverdienen, darüber hinaus haben sie eher geringe Ambitionen. Viele Eltern dieses Milieus haben einen Haupt- oder Volksschulabschluss und arbeiten als Arbeiter oder Facharbeiter mit einem unteren Einkommen, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Hinzu kommen oftmals soziale Benachteiligungen wie Krankheit und/ oder eine unvollständige Familie, viele Paare leben getrennt bzw. in Scheidung. Die Altersstreuung ist sehr breit und reicht bis ca. 60 Jahre.
(Viele) Kinder zu haben gehört zur Normalität, oft auch schon in jungen Jahren und nicht immer geplant. Dabei ist eine gewisse monetäre Ambivalenz festzustellen, da Kinder zwar einerseits Geld kosten, durch staatliche Transferleistungen aber andererseits auch das Haushaltseinkommen aufbessern.
Die mentale Flucht aus der Alltagsmühe und der Traum von einem besonderen, sorgenfreien Leben und plötzlichen Chancen wie ein Lottogewinn oder die Entdeckung als Superstar oder Model sind weit verbreitet. Diese Alltagsflucht wird häufig über einen übermäßigen Konsum von Unterhaltungsmedien oder spontane Fluchtreaktionen ausgelebt, die bisweilen auch zur Vernachlässigung der Aufsichtspflicht führen können. Insgesamt ist der Alltag eher wenig durchstrukturiert und die Familien haben i.d.R. ein vergleichsweise großes Zeitbudget für Freizeitaktivitäten mit den Kindern, das z.B. in Form von Spielplatzbesuchen, Treffen mit Freunden, gemeinsamem Fernsehen am Abend etc. gemeinsam verbracht wird. Dabei empfinden die Eltern die Freizeitgestaltung jedoch eher als eine Art Pflichtprogramm, das sie ihren Kindern zuliebe auf sich nehmen. In diesem Sinne können bestimmte Freizeitaktivitäten auch Belohnungscharakter haben, wie bspw. Besuche von Schnellrestaurants oder ähnliches.
In der Paarbeziehung herrscht meist ein traditionelles Rollenverständnis vor; wenn neue Rollenbilder von außen das traditionelle Bild in Frage stellen, sorgt dies für Irritation. So ist die Mutter als Versorgungs- und Kuschel-Mutti für Erziehung und Organisation des Familienalltags zuständig, während sich der Vater als Geldverdiener und Chef weitgehend aus der Erziehung heraushält und gelegentlich seine Autorität demonstriert. Durch Leistungserwartung und Strenge will er seine Kinder auf den Kampf im Leben vorbereiten.
Die Mütter haben oftmals das Bedürfnis, ihre Kinder zu verwöhnen, wie z.B. durch Geschenke und Kuscheln. Insgesamt erleben die Eltern das Kind teilweise als sinnstiftendes Element für das Dasein im Haushalt oder im Beruf.
An die Partnerschaft wird meist nicht mehr als der Minimalanspruch gestellt, dass sie funktioniert und Sicherheit bietet. Dennoch kann es aufgrund von finanzieller Not und Arbeitslosigkeit des Vaters häufig zu Konflikten kommen. Darüber hinaus fühlen sich die Mütter mit Haushalt, Erziehung, finanziellen Sorgen und einer unglücklichen Partnerschaft oftmals überfordert.
Der Minimalanspruch an Partnerschaft lässt sich ebenfalls auf Erziehung übertragen, denn diese wird nur wenig reflektiert und es herrscht ein eher permissiv-vernachlässigender Erziehungsstil vor. Die Kinder werden dabei häufig als ständig fordernd und kaum zu bändigenden wahrgenommen. Demzufolge wird Erziehung im konsum-materialistischen Milieu meist als schwierig empfunden und mit dem Bestrafen von nicht gewolltem Verhalten gleichgesetzt. Bestrafung ist meist das einzige bewusst eingesetzte Erziehungsmittel (z.B. Entzug von Konsumgütern). Gleichzeitig wird Konsum häufig mit persönlicher Zuwendung gleichgesetzt und dient insbesondere bei alleinerziehenden Müttern als Kompensationsleistung.
Abgesehen von Kindergarten und Schule werden Förder- und Betreuungsangebote nur wenig in Anspruch genommen. Das hat zum einen finanzielle Gründe, geschieht aber auch aus Ablehnung gegenüber pädagogischer Unterstützung. TV-Erziehungsshows haben für dieses Milieu hingegen eine hohe Relevanz, da diese für sie ein hohes persönliches Identifikationspotential bieten.
Die Bedeutung guter Schulnoten für eine bessere Zukunft wird in der Theorie zwar immer wieder betont, in der Praxis zeigen sie jedoch nur wenig Interesse am Schulalltag ihrer Kinder. Lernschwächen, gesundheitliche Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten des Kindes werden meist verdrängt, da die Angst vor der Diagnose und der Wunsch nach einem normalen Kind zu groß sind. Tatsächlich sind jedoch viele Kinder von Legasthenie, Dyskalkulie oder ADS betroffen und es findet eine intergenerationelle Weitergabe von Benachteiligungen statt, da die Eltern ökonomisch, sozial und psychisch bedingt nur wenig Möglichkeiten haben, ihre Kinder entsprechend zu fördern.
(Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard 2008: 161 ff.)
Hedonisten:
Der Altersschwerpunkt im hedonistischen Milieu liegt bei unter 30 Jahren und es handelt sich häufig um sehr junge Familien in Trennung oder Scheidung. Viele Eltern sind noch in Ausbildung oder arbeiten nach einfacher bis mittlerer Formalbildung als einfache Angestellte und Arbeiter, das Haushaltsnettoeinkommen liegt meist im mittleren Bereich. Dabei haben sie ein starkes Bedürfnis, sich nach oben von ihren Eltern, den Spießern, aber auch nach unten von den Ausländern und Sozialschmarotzern abzugrenzen.
Hedonisten sind häufig auf der Suche nach Spaß und Action und versuchen aus dem Alltag auszubrechen. Hierbei flüchten sie zum Teil in Gegenwelten wie PC- und Rollenspiele und/ oder Subkulturen. Dies führt häufig zu einer Art Doppelleben: Im Berufsalltag sind sie angepasst, ohne sich jedoch mit der Tätigkeit zu identifizieren, und danach tauchen sie ab in subkulturelle Gegenwelten. Darüber hinaus wird das Bedürfnis, frei und ungebunden zu sein, häufig vom Wunsch nach einem heilen, geordneten (Familien-)Leben begleitet. Der Medienkonsum ist bei Eltern und Kindern überdurchschnittlich hoch.
Trotz unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen bewahren sich Hedonisten eine entspannte Grundhaltung und leben im Jetzt. So bewältigen sie auch in schwierigen Zeiten ihre Krisen eher durch Verdrängung und lassen sich ihren Spaß nicht nehmen. Ihre Hyperaktivität wird jedoch häufig von energetischen Löchern unterbrochen.
Soziale Kontakte zu Freunden sind aufgrund des hohen Freizeitbedürfnisses für Hedonisten sehr wichtig. Auch die eigenen Eltern sind trotz eines häufig belasteten Verhältnisses ein wichtiger Bezugspunkt – als Babysitter oder auch aufgrund finanzieller Abhängigkeiten. Darüber hinaus führen problematische Jobverhältnisse und unregelmäßige Arbeitszeiten zu einem hohen Bedarf an flexiblen Betreuungszeiten in öffentlichen Einrichtungen, der nicht immer erfüllt werden kann und den Wiedereinstieg ins Berufsleben für die Frau erschwert. Das Gehalt des Vaters allein reicht jedoch häufig nicht aus.
Kinder gehören eher nicht zur Lebensplanung und viele Schwangerschaften sind ungeplant, denn Elternschaft bedeutet eine massive Veränderung, die teilweise als Bedrohung für die eigene Identität und Lebensqualität erlebt wird. Auch mit Kind versuchen sie, sich möglichst viel von ihrer persönlichen Freiheit und Unabhängigkeit zu bewahren und ihren spontanen Bedürfnissen nachzugehen. Dennoch werden sie durch den Verlust an Spontaneität teilweise aus ihrem bisherigen Freundeskreis ausgegrenzt und verlieren an Zugehörigkeit.
Ein Kind kann aber gleichzeitig auch zu einem Mehr an Struktur und Sinnhaftigkeit beitragen sowie neuen Halt und Orientierung bieten, da viele Eltern bezüglich ihrer gesellschaftlichen Position noch orientierungslos sind.
Hedonistische Mütter sehen sich häufig in der Rolle der großen Schwester bzw. der etwas anderen Mutter, die ihr Kind mit einem eher inkonsequenten Erziehungsstil als Freundin begleiten will ohne es einzugrenzen. Hedonistische Väter genießen es teilweise, als Spiel- und Spaßvater durch das Mitspielen selbst wieder zum Kind zu werden, grenzen sich aber auch ab und gehen eigene Wege, wenn es ihnen zu viel wird. Im Großen und Ganzen ist das Bedürfnis von hedonistischen Eltern, sich bewusst mit dem Kind zu beschäftigen und es fördern, jedoch eher gering und der Umgang beschränkt sich überwiegend auf Alltagselemente wie z.B. Mahlzeiten. Hedonistische Eltern sind häufig mit der Frage konfrontiert, wie sie ihre Freiheiten behalten und trotzdem gute Eltern sein können. Dieser Konflikt zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen des Kindes führt häufig zu Gefühlen von schlechtem Gewissen, Überforderung und Stress.
Erziehung an sich wird eher als etwas Rückständiges gesehen, da sie der Meinung sind, das Zusammenleben sollte aus dem Bauch heraus gesteuert werden. Dabei wird der Familienalltag, insbesondere mit seinen Anforderung von außen, jedoch häufig als überfordernd und Auseinandersetzungen mit dem Kind als anstrengend erlebt, da diese täglich und situativ neu ausgehandelt werden müssen.
Insgesamt ist das Erziehungsverhalten sehr beliebig und es gibt kaum abgesprochene Regeln und Grundsätze. Dieser permissive, konzeptlose Erziehungsstil ist häufig jedoch eher Zeichen der Überforderung als ein bewusst eingesetztes pädagogisches Konzept. Belohnungen sind dabei ein häufiges Erziehungsmittel, wie bspw. in Form von Süßigkeiten. Zentrale Forderungen an das Kind sind eine frühe Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, auch wenn sie ihm dies selbst nicht immer vorleben. Abgesehen davon lehnen sie Leistungsdruck kategorisch ab und haben nur einen Minimalanspruch an Bildung ohne bestimmte Bildungsziele.
Insgesamt sind die Eltern nur wenig über die Entwicklungsprozesse von Kindern informiert. Häufige Informationsquellen sind TV-Erziehungsshows und Info-Broschüren zu Leistungen, die ihnen als Eltern zustehen. Freiwillig in Anspruch zu nehmende und inspirierende pädagogische Hilfestellungen könnten unter Umständen als Orientierungshilfe angenommen werden. Generell sehen sie die Verantwortung für die Förderung ihres Kindes jedoch eher auf Seiten staatlicher Institutionen.
Partnerschaften sind meist weniger verbindlich und beruhen auf Toleranz und einer offenen und intensiven Kommunikation, sodass Probleme direkt und ehrlich angesprochen werden. Eine Partizipation des Mannes am Haushalt wird als selbstverständlich angesehen, da hedonistische Mütter sich nicht auf die Rolle der Hausfrau und Mutter beschränken lassen wollen. Entpuppt sich der Vater im Haushalt jedoch als nicht ganz so selbstständig wie von der Mutter vorausgesetzt, kann dies häufig zu Problemen führen. Kommt es zur Trennung, lebt das Kind meist bei der Mutter mit einem eher unregelmäßigen Kontakt zum Vater.
(Vgl. Henry-Huthmacher & Borchard 2008: 202 ff.)
5.3.4. Zielgruppe: Familien mit Migrationshintergrund
Spricht man von Menschen mit Migrationshintergrund oder Migranten, hat man oftmals schon ein bestimmtes Bild vor Augen von den Werten, der sozialen Lage und dem Lebensstil, der diese vermeintlich homogene Gruppe ausmacht. Berichte und Untersuchungen über Migranten spiegeln häufig eine klare Defizitperspektive wieder, meist mit der Frage nach der mangelnden Integration und Anpassungsbereitschaft an eine vermeintliche deutsche Leitkultur, gespeist durch die Angst vor Fundamentalismus, Gewalt und Unkontrollierbarem. Tatsächlich entspricht dies jedoch einem stark verengten Blick auf ein kleines Segment der Migranten-Population, das in keiner Weise repräsentativ ist für die Gesamtheit der Menschen mit Migrationshintergrund. (Vgl. Wippermann & Flaig 2009: 4)
Gemäß den Daten des statistischen Bundesamts von 2006 entspricht der Anteil der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtgesellschaft 18,6%, davon sind 8,9% Ausländer und 9,7% Deutsche mit Migrationshintergrund. Schaut man auf den Anteil der in Deutschland lebenden Familien mit Migrationshintergrund ist der Wert mit 27,2% deutlich höher, jedes dritte Kind unter fünf Jahren wächst heute in einer Familie mit Migrationshintergrund auf. Dabei ist die Zusammensetzung der Migranten nach Herkunftsland sehr heterogen:
- Ex-Sowjetunion 21%
- Türkei 19%
- Südeuropa 12%
- Polen 11%
- Ex-Jugoslawien 10%
- Land in Asien 9%
- Andere EU-Länder 6%
- Andere Osteuropäische Länder 6%
- Land in Amerika 3%
- Land in Afrika 3%
- Andere Länder 1%
Die Unterteilung der Menschen nach Ethnie sagt jedoch nichts über die Werte, die Lebensauffassung und die Lebensweisen des Einzelnen aus.
„Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Religion und Zuwanderungs-geschichte beeinflussen zwar die Alltagskultur, sind aber nicht milieuprägend und auf Dauer nicht identitätsstiftend.“ (Wippermann & Flaig 2009: 10)
In der Sinus-Studie zu den Migranten-Milieus in Deutschland wurden deshalb die alltäglichen Lebenswelten von Menschen mit Migrationshintergrund Ethnien übergreifend und mehrdimensional untersucht und sortiert, also auch in Bezug auf Werte, Lebensstile, Bildung und soziale Lagen. Dabei zeigte sich, dass die erfasste Pluralität von Lebensauffassungen und Lebensweisen auch innerhalb der verschiedenen Ethnien stark ausgeprägt war und keines der Milieus allein durch eine ethnische Zugehörigkeit repräsentiert wurde. Zudem konnte festgestellt werden, dass der religiöse Einfluss auf die Lebensstile und Lebensauffassungen von Menschen oft überschätzt wird. So zeigten drei Viertel der Befragten eine starke Aversion gegenüber fundamentalistischen Einstellungen und Gruppierungen jeder Couleur und 84 % waren der Meinung, dass Religion reine Privatsache sei. Insgesamt bezeichneten sich 56 % der Befragten als Angehörige einer der drei größten christlichen Konfessionen und 22 % als Muslime. (Vgl. Wippermann & Flaig 2009: 4 ff.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Wippermann & Flaig 2009: 7)
Allein im r eligiös verwurzelten Milieu, das nach einem rural-traditionellen, von autoritärem Familismus geprägten Wertesystem lebt, spielt Religion eine alltagsbestimmende Rolle. Dieses Milieu besteht fast zur Hälfte aus Muslimen und zu einem großen Teil aus Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass sich dieses Milieu zur anderen Hälfte auch aus anderen Herkunftsländern und Religionen zusammensetzt, darunter auch christliche. Insgesamt ist das Spektrum der Grundorientierungen in der Migranten-Population heterogener als in der autochthonen deutschen Gesellschaft und es gibt sowohl deutlich traditionellere als auch soziokulturell modernere Segmente. (Vgl. Wippermann & Flaig 2009: 4 ff.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 12: Die Migranten-Milieus in Deutschland 2008
Kurzbeschreibung der Migranten-Milieus
Bürgerliche Migranten-Milieus:
- Adaptives Bürgerliches Milieu (16%): „Die pragmatische moderne Mitte der Migrantenpopulation, die nach sozialer Integration und einem harmonischen Leben in gesicherten Verhältnissen strebt“ (Wippermann & Flaig 2009: 8)
- Statusorientiertes Milieu (12%): „Klassisches Aufsteiger-Milieu, das durch Leistung und Zielstrebigkeit materiellen Wohlstand und soziale Anerkennung erreichen will“ (Wippermann & Flaig 2009: 8)
Traditionsverwurzelte Migranten-Milieus:
- Religiös verwurzeltes Milieu (7%): „Vormodernes, sozial und kulturell isoliertes Milieu, verhaftet in den patriarchalischen und religiösen Traditionen der Herkunftsregion“ (Wippermann & Flaig 2009: 8)
- Traditionelles Arbeitermilieu (16%): „Traditionelles Blue Collar Milieu der Arbeitsmigranten und Spätaussiedler, das nach materieller Sicherheit für sich und seine Kinder strebt“ (Wippermann & Flaig 2009: 8)
Ambitionierte Migranten-Milieus:
- Multikulturelles Performermilieu (13%): „Junges, leistungsorientiertes Milieu mit bi-kulturellem Selbstverständnis, das sich mit dem westlichen Lebensstil identifiziert und nach beruflichem Erfolg und intensivem Leben strebt“ (Wippermann & Flaig 2009: 8)
- Intellektuell-kosmopolitisches Milieu (11%): „Aufgeklärtes, global denkendes Bildungsmilieu mit einer weltoffenen, multikulturellen Grundhaltung und vielfältigen intellektuellen Interessen“ (Wippermann & Flaig 2009: 8)
Prekäre Migranten-Milieus:
- Entwurzeltes Milieu (9%): „Sozial und kulturell entwurzeltes Milieu, das Problemfreiheit und Heimat/ Identität sucht und nach Geld, Ansehen und Konsum strebt“ (Wippermann & Flaig 2009: 8)
- Hedonistisch-subkulturelles Milieu (15%): „Unangepasstes Jugendmilieu mit defizitärer Identität und Perspektive, das Spaß haben will und sich den Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft verweigert“ (Wippermann & Flaig 2009: 8)
Nicht anders als in der autochthonen deutschen Bevölkerung, haben überwiegend die unterschichtigen Migranten-Milieus Defizite bei der Integration in die Mehrheitsgesellschaft. Die meisten Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich als Teil der multiethnischen deutschen Gesellschaft, mehr als die Hälfte hat einen uneingeschränkten Integrationswillen, ohne dabei ihre kulturellen Wurzeln vergessen zu wollen. Insbesondere die Befragten aus den soziokulturell modernen Milieus sind längst in unserer Gesellschaft angekommen, haben ein bikulturelles Selbstbewusstsein aufgebaut und sehen Mehrsprachigkeit und Bikulturalität als Chance. Gleichzeitig beklagen jedoch viele ein geringes Interesse sowie eine mangelnde Integrationsbereitschaft der autochthonen deutschen Bevölkerung. Insbesondere Angehörige der unterschichtigen Milieus fühlen sich zu einem großen Teil isoliert, ausgegrenzt und diskriminiert. Dabei ist den meisten Befragten der wesentliche Zusammenhang zwischen Bildung und einer erfolgreichen Etablierung in der Aufnahmegesellschaft bewusst und die meisten haben einen ausgeprägten Bildungsoptimismus. Aufgrund von strukturellen Hürden, Fehleinschätzungen und Informationsdefiziten führt dieser jedoch nicht immer in entsprechende Abschlüsse und Berufspositionen. Dennoch ist die Bereitschaft zur Leistung sowie der Glaube an und der Wille zum gesellschaftlichen Aufstieg in der Migranten-Population deutlich stärker ausgeprägt als in der autochthonen deutschen Gesellschaft. Was das Bildungsniveau insgesamt betrifft, gibt es zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund keine sehr großen Unterschiede, allein die Streuung ist in der Migrantenpopulation breiter. So gibt es einen höheren Anteil an Menschen ohne oder mit nur geringer Schulbildung, gleichzeitig ist aber auch der Anteil an Menschen mit einem akademischen Abschluss bei den Migranten größer als bei den Einheimischen. Dies spiegelt sich allerdings nicht im Einkommen wieder, da Menschen mit Migrationshintergrund im Schnitt deutlich weniger verdienen als ohne, insbesondere Frauen, aber auch AkademikerInnen allgemein. (Vgl. Wippermann & Flaig 2009: 10 f.)
Die Ergebnisse der Sinus-Studie machen deutlich, dass viele der verbreiteten Negativ-Klischees über Migranten nicht den Tatsachen entsprechen. Dennoch gibt es insbesondere in den unterschichtigen Milieus Randgruppen, auf die einige dieser Klischees zutreffen. Insbesondere die verstärkte Konzentration von Menschen der unterschichtigen Milieus mit und/ oder ohne Migrationshintergrund in bestimmten Sozialräumen führt oftmals zu Stigmatisierungen, sozialen Benachteiligungen und einer Kumulation bestimmter Problemlagen wie Arbeitslosigkeit und Armut. In diesen Sozialräumen entstehen besondere Bedarfe an pädagogischen und sozialpädagogischen Angeboten und Maßnahmen wie z.B. zur ganzheitlichen Förderung der Kinder, zur Beratung und Unterstützung der Familien im Alltag, in Erziehungsfragen, bei der Kommunikation mit Behörden sowie in der Gestaltung ihrer familiären und sozialen Beziehungen. Auch der Bedarf von Kindern an Schutz vor Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung ist in sozial benachteiligten Stadtteilen stärker ausgeprägt als in bessergestellten.
Besonders wichtig in Sozialräumen mit einem hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund ist die interkulturelle Kompetenz der (sozial-)pädagogischen Fachkräfte. Hierzu gehören nach Hess und Hansen 2012 folgende Kompetenzen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Hess [Hrsg.] 2012: 77)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl pädagogische Einrichtungen, die Politik als auch unsere Gesellschaft allgemein vor die Aufgabe gestellt sind, Vorurteile gegenüber Menschen mit Zuwanderungsgeschichte abzubauen sowie gleichermaßen an einer besseren Integration und Chancengerechtigkeit für sozial benachteiligte Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu arbeiten. Denn genau wie in der autochthonen deutschen Gesellschaft auch, gibt es bei Menschen mit Migrationshintergrund eine Vielzahl an unterschiedlichen Einstellungen und Lebensweisen, die gesehen und berücksichtigt werden müssen.
5.3.5. Zielgruppe: Familien mit Kindern mit Behinderung und/ oder sonderpädagogischem Förderbedarf
Eltern und Familien mit Kindern mit Behinderung und/ oder sonderpädagogischem Förderbedarf sind sehr heterogen und ziehen sich durch alle gesellschaftlichen Milieus und Ethnien. Dabei ist zunächst zwischen sonderpädagogischem Förderbedarf und Behinderung zu unterscheiden, denn nicht alle Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf sind behindert und nicht alle Kinder mit Behinderung haben einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Behinderung wird nach dem Sozialgesetzbuch wie folgt definiert:
SGB IX, § 2, Abs. 1: „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von der Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist“.
Bei einem sonderpädagogischen Förderbedarf handelt es sich nach dem niedersächsischen Schulverwaltungsblatt von 2005 hingegen um individuelle Förderbedürfnisse, die in erzieherischen und unterrichtlichen Prozessen erforderlich sind und die eine spezielle sonderpädagogische Unterstützung oder Intervention verlangen.
„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei den Schülerinnen und Schülern gegeben, die in ihren Entwicklungs-, Lern- und Bildungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht zusätzliche sonderpädagogische Maßnahmen benötigen. Sonderpädagogischer Förderbedarf wird von unterschiedlichen Faktoren bestimmt und ist vielfältig beeinflussbar. Körperliche oder kognitive Beeinträchtigungen und Behinderungen sowie soziale und wirtschaftliche Belastungen und Benachteiligungen können zu Verzögerungen oder Einschränkungen in der Entwicklung führen und einen sonderpädagogischen Förderbedarf zur Folge haben. Sonderpädagogischer Förderbedarf ist individuell unterschiedlich ausgeprägt und kann in verschiedenen Schwerpunkten vorliegen:
- Emotionale und Soziale Entwicklung,
- Geistige Entwicklung,
- Hören,
- Körperliche und Motorische Entwicklung,
- Lernen,
- Sehen,
- Sprache“ (SVBl NI 2/ 2005: 50)
Auch wenn es Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allen Milieus gibt, ist in den Förderschulen doch eine gehäufte Anzahl von Kindern aus sozial benachteiligten Familien sowie aus Familien mit Migrationshintergrund vertreten. Gründe hierfür können die zum Teil ungünstigen Entwicklungsbedingungen der Kinder in den Familien und in ihrem Lebensumfeld bzw. mangelnde Kenntnisse der deutschen Sprache sein, die von LehrerInnen der ersten Klassen in den Regelschulen nicht aufgefangen werden können.
Die Zusammenarbeit mit Eltern von behinderten Kindern sowie von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf braucht eine besondere Qualität, da diese Familien oftmals besondere Belastungen zu tragen haben und in besonderer Weise auf Unterstützung und Beratung angewiesen sind. So ergeben sich bspw. vielfältige Fragen und Unsicherheiten in Bezug auf geeignete Fördermaßnahmen und Therapiemöglichkeiten, zur Bewältigung des Alltags, zu Unterstützungsmöglichkeiten oder zur richtigen Schulwahl im Kontext von inklusiver vs. gesonderter Beschulung in einer Förderschule. Auch die Nachricht, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt und es sich möglicherweise ganz anders entwickeln wird, als sie es sich vorgestellt haben, kann Eltern von Kindern mit Behinderung und/ oder sonderpädagogischem Förderbedarf in eine Krise stürzen, die sie erst langsam verarbeiten müssen. Das Krisenverarbeitungsmodell nach Schuchardt beschreibt einen modellhaften Bewältigungsprozess von Lebenskrisen in acht verschiedenen Phasen:
- Ungewissheit – was ist eigentlich los...?
- Gewissheit – ja, aber das kann doch nicht sein...?
- Aggression – warum gerade ich...?
- Verhandlung – wenn...dann muss aber...?
- Depression – wozu..., alles ist sinnlos...?
- Annahme – ich erkenne jetzt erst...!
- Aktivität – ich tue das...!
- Solidarität – wir handeln...!
Für pädagogische Fachkräfte ist es wichtig, einschätzen zu können, ob und in welcher Krisenphase sich Eltern von Kindern mit Behinderung oder sonderpädagogischem Förderbedarf gerade befinden, denn nur so können sie ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie verstanden werden und sie unterstützend in ihrem Krisenbewältigungsprozess begleiten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 13: Spiralphasen-Modell nach Schuchard 1985
Auch ein nach außen hin als schwierig wirkendes Verhalten der Eltern kann von Fachkräften besser gedeutet werden, wenn sie sich mit Krisenverarbeitungsprozessen auskennen. Zur Unterstützung und Förderung von Kindern mit Behinderung und/ oder einem sonderpädagogischen Förderbedarf ist eine gute Zusammenarbeit von Eltern und pädagogischen Fachkräften in Form von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften besonders wichtig. Auch pädagogisch weniger gebildete Eltern müssen als Experten ihrer Kinder ernst genommen und auf Augenhöhe behandelt werden. Darüber hinaus müssen sich Fachkräfte bewusst sein, dass die von der Norm abweichende Entwicklung eines Kindes für Eltern ein sehr emotionales Thema ist, und dass sie eine entsprechende Sensibilität an den Tag legen sollten, wenn sie Eltern von ihren Beobachtungen erzählen und Ratschläge zu Therapien und Behandlungen erteilen. (Vgl. Hess [Hrsg.] 2012: 89 ff.)
5.4. Mögliche Angebote eines Familienzentrums
Die Angebotspalette von Familienzentren kann sehr breit angelegt sein und je nach Standort und Zielgruppen sehr unterschiedlich ausfallen. So können die Angebote von Beratungsangeboten über Elternbildungsangebote bis hin zu Freizeitangeboten, Sprachkursen und Weiterbildungsinitiativen für Eltern reichen. Zudem werden in Kapitel 5.5.3. Qualitätskriterien für die Angebote und Maßnahmen von Familienzentren entwickelt, die deutlich machen, welche Angebotsbereiche von den Einrichtungen abgedeckt werden sollten.
5.5. Vorschlag für einen allgemeinen Qualitätskriterienkatalog für Familienzentren
Der folgende Qualitätskriterienkatalog setzt sich aus drei Grundbausteinen zusammen, welche wiederum in einzelne Qualitätsbereiche unterteilt sind:
- Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit
- Selbsthilfeorientierung
- Lebenswelt-, Bedarfs- und Gemeinwesenorientierung
- Niederschwelligkeit der Angebote
- Zugänglichkeit
- Prävention und Bildung als kontinuierliche, Lebensalter übergreifende Prozesse
- Partizipation
- Inklusion und Umgang mit Heterogenität
- Kooperation/ Vernetzung
- Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit
- Qualifizierung/ Aus-, Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte
- Qualitätsentwicklung
- Qualitätskriterien für den Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Kerngeschäft der Kindertageseinrichtung
- Orientierung an den Bildungsplänen der jeweiligen Bundesländer
- Qualitätskriterien für Angebote und Maßnahmen von Familienzentren, die über den Kernbereich der Kindertagesstätten hinaus gehen
- Verzeichnisse und Vermittlung
- Beratungs- und Unterstützungsangebote
- Prävention
- Frühe Hilfen
- Angebote für Familien mit Kindern unter drei Jahren
- Bildungs-, Förder- und Freizeitangebote für Kinder (0-12/14 Jahre)
- Jugendarbeit
- Altersübergreifende Familienangebote
- Generationen übergreifende Angebote
- Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
- Stärkung von Elternkompetenzen
- Kontaktmöglichkeiten und andere Angebote für Eltern
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Kindertagespflege
- Förderung von Ehrenamt
- Öffentlichkeitsarbeit
Die hier dargestellten Kriterien sollen eine Orientierung geben für die Entwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebots für Familienzentren.
Hierfür sollten zunächst alle aufgeführten Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit erfüllt werden. In ihrer konkreten Ausprägung sind die Grundprinzipien inhaltlich so zu erweitern und zu verändern, dass sie zu den gegebenen Verhältnissen und Strukturen des jeweiligen Sozialraums passen. Darüber hinaus können an einzelnen Stellen auch inhaltlich ähnliche Grundprinzipien zu einem zusammengefasst werden, sofern die jeweilige Grundaussage der Prinzipien dabei nicht verloren geht.
Im Qualitätsbereich der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern wird auf den vorhandenen Strukturen aufgebaut, sofern das Familienzentrum an eine Kindertages-einrichtung angebunden ist. Wie in jeder Kindertagesstätte hat das Familienzentrum die Aufgabe, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln sowie sich an den aktuellen Erkenntnissen der Forschung und den Bildungsplänen der einzelnen Bundesländer zu orientieren.
In Bezug auf die Qualitätskriterien für die Angebote und Maßnahmen von Familienzentren gilt Ähnliches wie für die Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit. Auch hier sollten alle 16 Qualitätsbereiche mit Angeboten abgedeckt sein, wie viele der aufgeführten Angebote im jeweiligen Bereich jedoch vorgehalten werden müssen, hängt von den jeweiligen Bedarfen der Familien im Sozialraum ab. Die Angebote müssen nicht alle vom Familienzentrum selbst angeboten werden, sofern es bereits andere Akteure vor Ort gibt, die den entsprechenden Bedarf in ausreichendem Maße abdecken. In diesem Fall muss mit dem anderen Anbieter kooperiert und die Familien dorthin weitervermittelt werden. Darüber hinaus ist es möglich, inhaltlich ähnliche Qualitätsbereiche zu einem zusammenzufassen und größere Kategorien zu bilden. Es sollte jedoch für jeden der 16 Ursprungsbereiche mindestens ein Angebot in den zusammengefassten Kategorien mit enthalten sein. Darüber hinaus können für die einzelnen Qualitätsbereiche auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse weitere, passgenaue Angebote und Maßnahmen entwickelt werden, die in den dargestellten Kriterien nicht mit aufgeführt sind.
5.5.1. Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit
Selbsthilfeorientierung
Familienzentren fördern Familien insbesondere dahingehend, dass sie in der Lage sind, ihre Lebenssituation eigenständig und selbstbestimmt bewältigen zu können. Bei fachlich begleiteten Selbsthilfeaktivitäten können sich die Familien gegenseitig unterstützen und beraten sowie bei Bedarf zusätzliche Hilfe von außen dazuholen. Durch diesen ungezwungenen Austausch mit anderen Familien können eigene Probleme oftmals besser eingeschätzt oder auch gelöst werden (vgl. MSFG TH 2006: 157). Die Hemmschwelle, über seine eigenen Probleme zu sprechen, kann in einem Kreis von Menschen, die in ähnlichen Lebenssituationen sind, deutlich geringer sein als bei anderen Beratungsangeboten. Familienzentren sollte es deshalb ein wichtiges Anliegen sein, den Aufbau von Selbsthilfeinitiativen zu unterstützen und die notwendigen Räumlichkeiten bereitzustellen. Ein(e) feste(r) AnsprechpartnerIn zur Unterstützung und Koordinierung der Selbsthilfe-initiativen im Familienzentrum kann dabei sehr hilfreich sein.
Lebenswelt-, Bedarfs- und Gemeinwesenorientierung
Familienzentren orientieren sich in ihrer Arbeit am Gemeinwesen, setzen sich mit ihrem sozialen Umfeld auseinander und wirken auf dieses ein. Die Angebote von Familienzentren richten sich nach den konkreten Bedarfen der Stadtteilbewohner und berücksichtigen die sozialen Strukturen und Beziehungen, in welche die Familien eingebunden sind. Darüber hinaus muss ein Familienzentrum flexibel, zeitnah und unbürokratisch auf veränderte Bedarfs-, Bedürfnis- und Interessenlagen von Familien reagieren können (vgl. MSFG TH 2006: 157). Für eine nachhaltige Angebotsgestaltung müssen sowohl die Angebote als auch die Konzeption von Familienzentren kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt sowie an die aktuellen Bedarfe, Gegebenheiten und Strukturen im Stadtteil angepasst werden.
Niederschwelligkeit der Angebote
Die Angebote von Familienzentren sind möglichst niederschwellig zu gestalten, das bedeutet alltagsnah, leicht zugänglich und mit einer niedrigen persönlichen Hemmschwelle (vgl. MGFFI NRW [Hrsg.]: 2). Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn das Familienzentrum an eine Kindertagesstätte angebunden ist bzw. es sich um ein Verbundsystem handelt, welches mindestens eine Kindertagesstätte mit einschließt. Denn Kindertagesstätten sind vertraute Orte für Familien und können die Hemmschwelle senken, Hilfs- und Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus kann die große Nähe zu Eltern und Kindern dazu beitragen, dass Problemlagen in Familien frühzeitig erkannt sowie ein bedarfsgerechtes Angebot vermittelt werden kann (vgl. Internetauftritt der Familienzentren im Emsland: Baustein 7: Bildungs- und Beratungsangebote für Familien). Hilfs- und Beratungsangebote werden teilweise direkt in den Tageseinrichtungen der Kinder angeboten, damit die Familien sich nicht zusätzlich an andere, ihnen fremde Einrichtungen wenden müssen. Ist dies nicht möglich, können Eltern direkt an andere Anbieter weitervermittelt und im Bedarfsfall dorthin begleitet werden. Einzelne Eltern-Kind-Angebote, Spielgruppen und Elterntreffs können von ErzieherInnen begleitet werden, welche die Kinder und Eltern bereits kennen und denen sie vertrauen. Zusätzlich ist es möglich, dass sich einzelne ErzieherInnen in ihren Gesprächsführungs- und Beratungskompetenzen fortbilden, um eine Erstberatung durchführen zu können.
Zugänglichkeit
Die Angebote von Familienzentren sollten nach Möglichkeit für alle Familien und Familienmitglieder im jeweiligen Stadtteil, also wohnortnah und unabhängig von Herkunft, Status, Religion, Behinderung oder Geschlecht frei zugänglich sein. Damit dies gewährleistet ist, müssen finanzielle, räumliche und zeitliche Barrieren möglichst gering gehalten werden, sodass sich alle Familien eine Teilnahme an den Angeboten leisten, sie das Familienzentrum problemlos erreichen sowie die Angebote bei Bedarf barrierefrei und in ihrer freien Zeit wahrnehmen können, also auch an Wochenenden und in den Abendstunden (vgl. MSFG TH 2006: 157). Wie niedrig diese Barrieren sein müssen, richtet sich immer nach der besonderen Interessenlage der zu erreichenden Zielgruppe und den vorhandenen Strukturen im Sozialraum. In städtischen Gebieten sollten Familienzentren möglichst fußläufig erreichbar sein und eine gute Anbindung an die Infrastruktur des Stadtteils haben. In ländlichen Gebieten ist dies nicht immer möglich, deshalb kann hier das Leistungsangebot im Bedarfsfall auch durch mobile Angebote ergänzt werden (vgl. MSFG TH 2006: 157).
Prävention und Bildung als kontinuierliche, Lebensalter übergreifende Prozesse
Ziel eines breiten, Lebensalter übergreifenden Angebotsspektrums von Familienzentren ist der Aufbau von Präventions- und Bildungsketten. So werden Familien in allen Lebenslagen und Lebensphasen ihrer Kinder anhand präventiver Hilfen und fördernder Angebote unterstützend begleitet, beginnend mit der Schwangerschaftsberatung und den frühen Hilfen, über Eltern-Kind-Angebote im Baby- und Kleinkindalter, hin zum Kindergarten-, Grundschul- und Jugendalter. Auf diese Weise soll von Beginn an verhindert werden, dass es in den Familien zu emotional belastenden Beziehungen und Zuständen kommt, die dazu führen, dass die emotionale, psychische, kognitive und körperliche Entwicklung der Kinder beeinträchtigt wird. Die Familien bekommen Unterstützung in der Bewältigung ihres Alltags und ihrer Lebenssituation, in der Entwicklung von harmonischen, liebevollen Beziehungen innerhalb und außerhalb der Familie sowie Anregungen zur ganzheitlichen Förderung ihrer Kinder.
Partizipation
Die aktive Beteiligung und Aktivierung von Familien ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Familienzentren. Nur wenn Familien bei der Planung und Umsetzung des Angebots und der laufenden Prozesse mitbestimmen und mitgestalten, kann ein passgenaues, an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiertes Angebotsprofil entstehen. Darüber hinaus hat Partizipation einen präventiven Charakter und kann das Gefühl der eigenen Selbstwirksamkeit sowie das ehrenamtliche und gesellschaftliche Engagement der Beteiligten fördern (vgl. Deutsches Kinderhilfswerk e.V. [Hrsg.] 2007: 36ff.; Drosten 2012: 12ff.).
Inklusion und Umgang mit Heterogenität
Familienzentren handeln nach einer Pädagogik, welche die gesellschaftlich festgelegten Kategorien wie Geschlecht, Herkunft oder Behinderung reflektiert und sich dessen bewusst ist, dass diese Kategorien lediglich gewachsene Konstrukte sind, die keinesfalls eine wertungsfreie Beschreibung der Realität darstellen. Darüber hinaus gehen Familienzentren davon aus, dass alle Menschen unterschiedlich sind und andere Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen haben. Da diese Unterschiedlichkeiten genauso innerhalb wie auch zwischen den gesellschaftlich festgelegten Kategorien bestehen, ist es wichtig, dass die Grenzen dieser Kategorien auch überwunden werden können und der Blick für den konkreten Menschen und dessen individuelle Lebenslage geschärft wird. Auf diese Weise wird Diversität zur Normalität und Inklusion zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Alltags.
Durch ein breites Spektrum von unterschiedlichen Angeboten werden in Familienzentren insbesondere auch interkulturelle und Generationen übergreifende Begegnungen ermöglicht und gefördert. Darüber hinaus werden Eltern in ihren Elternrollen sowie bei der Entwicklung neuer, egalitärer Geschlechterrollen unterstützt (vgl. Zentrum Bildung der EKHN [Hrsg.] 2010: 10).
Kooperation/ Vernetzung
Familienzentren kooperieren eng mit anderen Akteuren vor Ort und übernehmen die Steuerung in einem sozialräumlichen Netzwerk rund um die Familie. Dabei nutzen Familienzentren die im Stadtteil bereits vorhandenen Strukturen. Um ein möglichst breites, niederschwelliges Angebotsspektrum vorhalten und den unterschiedlichen Bedarfen von Familien gerecht werden zu können, bietet das Familienzentrum anderen Institutionen und Einrichtungen die Möglichkeit, familienbildende und -beratende Angebote in seinen Räumen durchzuführen, soweit die räumlichen Ressourcen dies zulassen. Hat ein Familienzentrum nicht genügend eigene Räumlichkeiten zur Verfügung, um dort die notwendigen Angebote zu realisieren, kann es Kooperationsvereinbarungen mit anderen Partnern zur Nutzung ihrer Räume schließen (vgl. MGFFI NRW [Hrsg.]: 3). Darüber hinaus vermittelt und begleitet das Familienzentrum die Familien bei Bedarf zu passenden Anbietern im Stadtteil. Dabei berücksichtigt es die Pluralität der verschiedenen Träger und achtet auf die Passgenauigkeit zwischen den jeweiligen Angeboten und dem individuellen Bedarf des Klienten. Die Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren vor Ort wird nach Möglichkeit durch Kooperationsverträge abgesichert. Für die Koordination der verschiedenen Angebote sowie die Steuerung des Netzwerks ist nach Möglichkeit eine Koordinierungsstelle zu schaffen.
Mögliche Kooperationspartner können sein: Psychologische Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, Familienberatungsstellen, Beratungsstellen für Schwanger-schaftsfragen, Pro Familia, Ehe- und Lebensberatungsstellen, örtliche Kinder- und Gleichstellungsbeauftragte, Jugendorganisationen, (Kinder-)Ärzte, Zahnärzte, (Kinder-) Psychologen und Kinderkliniken, (freiberufliche) Therapeuten, Hebammen, Schuldner- und Sozialberatung, Suchtberatung, Familienbildungsstätten, Elternschulen, Familienverbände, Familienservicebüro, freie Träger der Wohlfahrtspflege, Verbraucherzentrale, Kranken-kassen, Vereine, Integrationsfachstellen, soziale Dienste, Schulen, Altenheime, Volkshoch-schulen, Jugendamt (ASD), Arbeitsamt, andere Kindertagesstätten, Frühförderstellen, Gesundheitsamt, kirchliche Gemeinden, Ehrenamtliche, Kommune/ Stadt/ Landkreis u.a.
Kommunikation/ Öffentlichkeitsarbeit
Familienzentren nutzen vielfältige Wege, um ihr Angebot in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dabei berücksichtigen sie die unterschiedliche Erreichbarkeit der einzelnen Zielgruppen und wählen jeweils geeignete Methoden und Medien zur Darstellung ihres Angebots (z.B. Flyer, Aushänge, Pinnwand, Aufsteller, Internetplattform, E-Mail-Newsletter, persönliche Ansprache, Hausbesuche, Werbeanzeigen in Printmedien und Rundfunk etc.).
Qualifizierung/ Aus-, Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte
Für den gelingenden Aufbau von Familienzentren bzw. für die Weiterentwicklung von (Kindertages-)Einrichtungen zum Familienzentrum ist es unverzichtbar, dass das pädagogische Team hinter dieser Entwicklung steht, über die laufenden und geplanten Prozesse informiert sowie fachlich für die neuen Aufgabenbereiche qualifiziert ist. Da die Themen Elternbildung, -beteiligung sowie Bildungs- und Erziehungspartnerschaften bisher nur einen geringen Stellenwert in der Ausbildung von ErzieherInnen einnehmen, sind Fort- und Weiterbildungen zu diesen Themen dringend notwendig. Auch Vernetzungs- und Managementfähigkeiten kommt in Familienzentren eine besondere Rolle zu, insbesondere für die Leitung der Einrichtung. Im Zuge der Konzeptentwicklung sollte deshalb auch eine Analyse der Fort- und Weiterbildungsbedarfe der pädagogischen Fachkräfte durchgeführt werden. (Siehe auch Kapitel 6.2. Gliederungselemente eines Konzepts bzw. einer Konzeption)
Qualitätssicherung
Grundlage für die Sicherung der pädagogischen Qualität ist ein schriftliches Konzept mit der Darstellung der pädagogischen Ziele und der Angebotsstruktur, welches stetig überarbeitet, weiterentwickelt und an die sich verändernden Lebensbedingungen und Bedarfe von Familien angepasst wird. Hierfür ist es ratsam, eine Steuerungsgruppe einzurichten, die sich in regelmäßigen Abständen trifft und an der Weiterentwicklung des Konzepts, der Arbeitsprozesse und der Angebotsstruktur des Familienzentrums arbeitet. In diesem Zusammenhang sind regelmäßige Erhebungen zur Bedarfslage von Familien im Stadtteil sowie die (Selbst-)Evaluation und Supervision anhand geeigneter Methodiken zur permanenten Veränderung und Verbesserung der pädagogischen Arbeit unverzichtbar. Auf diese Weise können Lücken, Mängel und nicht genutzte Angebote, Fortbildungsbedarfe bei den pädagogischen Fachkräften sowie schlecht funktionierende Strukturen aufgedeckt und bearbeitet werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, ein geeignetes Qualitäts-managementsystem einzuführen bzw. das bereits vorhandene Qualitätsmanagement an die neuen Anforderungsbereiche eines Familienzentrums anzupassen.
Zur Unterstützung der Kommunikation und Kooperation der verschiedenen Akteure im Stadtteil sowie verschiedener Familienzentren untereinander sind außerdem regelmäßige Netzwerktreffen sinnvoll und wichtig.
5.5.2. Qualitätskriterien für den Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Kerngeschäft der Kindertageseinrichtung
Bei Familienzentren, die sich aus Kindertagesstätten entwickeln oder eine Kindertagesstätte im Verbund integriert haben, bleibt der Bereich der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern als Kerngeschäft der Kindertageseinrichtungen ein zentraler Bestandteil der pädagogischen Arbeit, den es durch die Weiterentwicklung zu stärken und keinesfalls zu vernachlässigen gilt. Die pädagogische Ausgestaltung dieses Bereichs richtet sich nach den Empfehlungen der Bildungspläne der einzelnen Bundesländer. Beispielhaft soll hier genannt werden, welche Bildungsbereiche die Empfehlungen Niedersachsens umfassen:
- Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
- Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
- Körper – Bewegung – Gesundheit
- Sprache und Sprechen
- Lebenspraktische Kompetenzen
- Mathematisches Grundverständnis
- Ästhetische Bildung
- Natur und Lebenswelt
- Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium [Hrsg.] 2005: 3)
5.5.3. Qualitätskriterien für Angebote und Maßnahmen von Familienzentren, die über den Kernbereich der Kindertagesstätten hinaus gehen
In der folgenden Darstellung werden die Angebote und Maßnahmen von Familienzentren zu bestimmten Themenbereichen zusammengefasst und in ihrer Eignung für bestimmte Sozialraumtypen untersucht. Hierzu werden die in Kapitel 5.3. vorgestellten Zielgruppen gut situierte, bildungsnahe Familien, sozial benachteiligte und bildungsferne Familie n sowie Familien mit Migrationshintergrund herangezogen und auf bestimmte Sozialraumtypen bezogen, in denen diese Zielgruppen jeweils gehäuft vertreten sind. Auf diese Weise entstehen vier verschiedene Sozialraumtypen, die in den folgenden Tabellen aus Platzgründen jeweils auf einzelne Schlagworte reduziert werden. Damit deutlich wird, was jeweils hinter den Schlagworten steht, hier eine kurze Erläuterung:
- Der ländliche Raum
- Gut situierter Sozialraum: Sozialräume mit einem hohen Anteil an gut situierten, bildungsnahen Familien
- Benachteiligte Sozialräume: Sozialräume mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten und bildungsfernen Familien
- Sozialraum mit hohem Migranten -Anteil: Sozialräume mit einem hohen Anteil an Familien mit Migrationshintergrund
Die Zielgruppe Familien mit Kindern mit Behinderung und/ oder sonderpädagogischem Förderbedarf wird hier nicht als eigene Untersuchungskategorie hinzugezogen, da sich diese Zielgruppe quer zu den anderen verhält und sich durch alle Milieus, Bevölkerungsgruppen und Sozialräume zieht.
Ist ein Angebot für den jeweiligen Sozialraumtyp geeignet, ist dies in den Tabellen durch ein X gekennzeichnet. Diese Eignungsprüfung ist jedoch nur als Orientierungshilfe zu verstehen, da immer auch im konkreten Einzelfall zu prüfen ist, welche Angebote im jeweiligen Sozialraum des Familienzentrums geeignet und sinnvoll sind (siehe auch Kapitel 5.6. Maßgeschneiderte Qualitätskriterien entwickeln und anwenden). Darüber hinaus ist zu beachten, dass es in der Praxis immer zu Überschneidungen und Mischformen der Sozialraumtypen kommt. So leben beispielsweise in Sozialräumen mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten Familien auch häufig überdurchschnittlich viele sozial benachteiligte Familien mit Migrationshintergrund, sodass diese beiden Sozialraumtypen häufig schwer voneinander zu trennen sind. Auch eine Mischung aus gut situierten und sozial benachteiligten Familien in einem Sozialraum ist nicht selten der Fall und stellt pädagogische Einrichtungen vor die Herausforderung, beiden Zielgruppen gerecht zu werden und einer möglichen Abgrenzungstendenz zwischen den Gruppen entgegenzuwirken. Im ländlichen Raum gibt es ebenfalls Überschneidungen, wie schon in Kapitel 5.3.1. erläutert wurde. Hier sind die Kommunen und Gemeinden teilweise vor das Problem der konzentrierten Ansiedlung, sozialen Ausgrenzung und Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund gestellt.
1. Verzeichnisse und Vermittlung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Beratungs- und Unterstützungsangebote
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Prävention
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Frühe Hilfen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5. Angebote für Familien mit Kindern unter drei Jahren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6. Bildungs-, Förder- und Freizeitangebote für Kinder (0-12/14 Jahre)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7. Jugendarbeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8. Altersübergreifende Familienangebote
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9. Generationen übergreifende Angebote
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11. Stärkung von Elternkompetenzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12. Kontaktmöglichkeiten und andere Angebote für Eltern
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14. Kindertagespflege
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
15. Förderung von Ehrenamt
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16. Öffentlichkeitsarbeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.6. Maßgeschneiderte Qualitätskriterien entwickeln und anwenden
Wenn ein neues Familienzentrum entsteht, das den Anspruch hat, nach maßgeschneiderten und bedarfsgerechten Qualitätskriterien zu arbeiten, muss zunächst eine Bedarfsanalyse stattfinden, wie sie in Kapitel 6. dieser Arbeit beschrieben wird. Auf der Grundlage der dort ermittelten Problemlagen können Ziele sowie die zur Erreichung dieser Ziele notwendigen Maßnahmen erarbeitet werden, nach Möglichkeit unter Beteiligung einer breiten Masse von Einrichtungen und/ oder Betroffenen vor Ort. Diese Maßnahmen werden in einem nächsten Schritt mit den oben dargestellten Qualitätskriterien für die Angebote und Maßnahmen von Familienzentren abgeglichen und insoweit durch die dort genannten Angebote ergänzt, dass die Bedarfe der Familien im Sozialraum sowie alle 16 Qualitätsbereiche der Kriterien mit Angeboten abgedeckt sind. In einer kleineren Gruppe von Vertretern der beteiligten Institutionen kann dann diskutiert werden, welche Angebote und Maßnahmen tatsächlich umsetzbar sind sowie in ihrer zeitlichen Umsetzung Priorität haben.
Bei der anschließenden Formulierung einer Konzeption werden die Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit integriert und gegebenenfalls so überarbeitet, dass sie zu den Gegebenheiten des jeweiligen Sozialraums passen. Auch das zuvor entwickelte Gesamtangebot kann nun in die Konzeption mit aufgenommen werden.
Das genaue Verfahren zur Entwicklung einer Konzeption für Familienzentren wird in den folgenden beiden Kapiteln näher erläutert. Hierfür wird zunächst eine Explikation der Begriffe Konzept und Konzeption gegeben sowie die theoretischen Bestandteile und Besonderheiten von sozialräumlichen Gesamtkonzepten in der Jugendhilfe allgemein und für Familien-zentren im Besonderen erläutert. Im Anschluss daran wird ein Praxisbeispiel für einen Beratungsprozess vorgestellt, im Rahmen dessen die Konzeption für ein Familienzentrum in Cuxhaven entwickelt wurde.
6. Das Verfahren zur Entwicklung von sozialräumlichen Gesamtkonzepten der Jugendhilfe im Allgemeinen und für Familienzentren im Besonderen
6.1. Was ist ein Konzept/ eine Konzeption?
Das Wort Konzept leitet sich vom lateinischen Wort concipere ab und bedeutet so viel wie erfassen, in sich aufnehmen. Im Duden wird ein Konzept als ein gedanklicher Entwurf oder auch als klar umrissener Plan bzw. Programm für ein Vorhaben und eine Konzeption als die einer Lehre, einem Programm, einem Werk zugrunde liegende Anschauung oder Leitidee definiert (vgl. Duden 2003: 945). Stange beschreibt ein Konzept als eine „gedankliche Zusammenfassung (Vorstellung) von Gegenständen und Sachverhalten, die sich durch gemeinsame Merkmale und Zielsetzungen auszeichnen“ (Stange 2012b [u.M.]: o.S.) und betont den flexiblen, veränderbaren Charakter eines Konzepts bzw. einer Konzeption. Man malt sich in einem Entwurf aus, wie sich die derzeitigen Zustände entwickeln und wie sie beeinflusst werden könnten. Auf diese Weise vereint ein Konzept zugleich einen visionären Gehalt mit einem klaren Plan und klaren Zielsetzungen. (Vgl. Stange 2012b [u.M.]: o.S.)
Nach Stange kann zwischen Konzept und Konzeption unterschieden werden aufgrund ihres unterschiedlichen Grades an Ausführlichkeit und Umfang. So gehen bei einer Konzeption die Vorüberlegungen und die theoretische Auseinandersetzung mit dem Planungsprojekt mehr in die Tiefe und Breite als bei einem Konzept. Demnach ist eine Konzeption eine umfassende Zusammenstellung von Informationen und Begründungszusammenhängen für ein größeres Vorhaben bzw. umfangreiche Planungen, während ein Konzept einen kleineren, einfacheren und kurzfristigeren Entwurf meint. Stange weist jedoch darauf hin, dass die Begriffe Konzept und Konzeption in der Literatur häufig synonym verwendet werden, da die zu vollziehenden Planungsschritte die gleichen sind. Da die nachfolgenden Erläuterungen sowohl für Konzepte als auch für Konzeptionen gelten, soll auch hier nicht weiter zwischen den Begriffen unterschieden werden. (Vgl. Stange 2012b [u.M.]: o.S.)
Grundsätzlich sollte ein Konzeptionstext für Familienzentren immer auf einer möglichst sachhaltigen und differenzierten Beschreibung der Lebensbedingungen, Lebensentwürfe und Lebensstile von Familien basieren und sich möglichst informiert mit fachlich relevanten Rahmenentwürfen der Familienarbeit auseinandersetzen. Vor diesem Hintergrund müssen fachlich relevante Zielsetzungen begründet und präzisiert sowie die spezifischen Aufgaben konkreter Einrichtungen und Projekte definiert werden. Auf diese Weise engen Konzepte die Vielfalt potentieller Handlungsmöglichkeiten zwar einerseits ein, eröffnen andererseits jedoch die Möglichkeit, in realen Handlungssituationen verschiedene geplante und reflektierte Alternativen wählen zu können. (Vgl. Stange 2012b [u.M.]: o.S.)
6.2. Gliederungselemente eines Konzepts bzw. einer Konzeption
In Anlehnung an ein Merkblatt des Niedersächsischen Landesamts für Soziales, Jugend und Familie beschreibt Stange die inhaltlichen Gliederungselemente eines Konzeptionstextes wie folgt:
Konzepte sind immer spezifisch angelegt und beziehen sich auf die bestimmten Lebenswelten und Sozialräume konkreter Zielgruppen. Ein Konzept muss deshalb eine differenzierte Situationsanalyse beinhalten, die alle für das Projekt wichtigen Informationen enthält, einschließlich einer Analyse der Infrastruktur vorhandener pädagogischer und sonstiger Angebote (Bestandsaufnahme und -bewertung). Die Situation und Lebenswirklichkeit der Zielgruppen muss von den PädagogInnen detailliert analysiert und verstanden werden.
Aus der Situationsanalyse ergibt sich ein breites Spektrum aus möglichen Problemen und Themenstellungen aus der Lebenswelt der Zielgruppen. Hier muss anhand fachlicher und politischer Erwägungen eine Problem- und Aufgabendefinition stattfinden (Eingrenzung).
Resultierend aus der Problem- und Aufgabendefinition werden konkrete Ziele (Handlungsziele) gesetzt, die nach Möglichkeit operationalisiert werden. Diese Zielsetzungen müssen in ihrem Zielerreichungsgrad durch geeignete Evaluationen messbar sein.
Daraus folgt, dass Konzeptionen Kriterien für Qualität liefern müssen. Das heißt, es muss eingeschätzt werden, was Erfolg und Wirksamkeit der jeweiligen Maßnahme sein können und wie man sie evaluieren kann.
Auch die einzelnen Schritte zur Ziel-Erreichung müssen definiert und die typischen Handlungsprinzipien, Handlungsformen und Methoden zur Erreichung der gesetzten Ziele und Teilziele müssen dargelegt werden.
Wichtig ist zudem die Planung der strukturellen Bedingungen für das pädagogische Handeln wie z.B. Ressourcen, Räume, Finanzen, Zeiten, Personal, Sachmittel, Kompetenzen etc.. Demzufolge muss auch ein grober Zeitplan erstellt werden, der die ungefähr geplante Abfolge aufeinander aufbauender Aktivitäten erläutert (Meilensteine).
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Vernetzung und Gemeinwesen-orientierung aller Maßnahmen. Dabei müssen alle Instanzen und Gremien aufgeführt werden, die an der Konzeption beteiligt sind oder beteiligt werden sollen, und die jeweils spezifischen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten dargestellt werden.
Zuletzt muss die Konzeption regelmäßig überprüft und fortgeschrieben werden. Hierfür muss bspw. untersucht werden, ob das Konzept Erfolg hat, ob die Maßnahmen wirksam sind und der Ziel-Erreichung dienen, ob alle beschlossenen Maßnahmen mit den vorhandenen Ressourcen tatsächlich umgesetzt werden können, ob die Maßnahmen den Vorgaben entsprechend umgesetzt werden und von den Zielgruppen angenommen werden, ob es evtl. neue, nicht planbare oder übersehene Problemlagen gibt, ob sich die Bedarfe geändert haben, ob es neue fachliche Erkenntnisse, Trends und Methoden gibt etc. Auf dieser Grundlage ist zu prüfen, ob Anpassungen, Korrekturen und/ oder Umstrukturierungen des Angebots notwendig sind.
(Vgl. Stange 2012b [u.M.]: o.S.)
Aus den genannten Elementen formuliert Stange einen Gliederungsvorschlag für eine ausführliche Einrichtungskonzeption:
Konzeptionsgliederung
- Einführung – Präambel
- Werte, Leitziele (Richtziele), Leitbild
- Ausgangslage
- Standort (Ort, beteiligte Institutionen, zur eigenen Einrichtung)
- Beschreibung und Analyse der Situation (Sozialraum- und Lebensweltanalyse, ggf. vertiefte spezielle Zielgruppenanalyse, Bestand an Programmen, Angeboten, Maßnahmen und Projekten, politische, administrative und finanzielle Rahmenbedingungen)
- Zu lösende Probleme – Ziele – Bedarfe
- Bestandsbewertung (orientiert an fachlichen Kriterien und Standards)
- Allg. Einschätzung und Bewertung der Sozialraum- und Lebensweltanalyse
- Welche Besonderheiten gibt es?
- Abgleich der Sozialraumanalyse mit dem Angebot: Bewertung des Bestands (Feststellung von Angebotslücken und Qualitätslücken)
- Wie ausreichend ist das bisherige Angebot? In welchem Maße löst es die vorhandenen Probleme, befriedigt es die Bedürfnisse – in welchem Maße nicht?
- Zu lösende Probleme: Aufgaben
- Zielformulierungen (aus den Werten, den Merkmalen der konkreten Situation/ Ausgangslage und den zu lösenden Problemen/ Aufgaben abgeleitete Zielformulierungen)
- Im Sinne von Outcome : Leitziele, Mittlerziele, Handlungsziele
- Erhoffter Impact (gesellschaftliche Wirkungen) benennen, aber nicht in den eigenen Zielkatalog aufnehmen, da diese Systemwirkungen nur indirekt und bedingt durch das eigene Konzept beeinflusst werden können
- Bedarfsfeststellung 1: aus (a) und (b) resultierender Abgleich mit den vorhandenen Möglichkeiten
- Das brauchen wir! Das wollen wir! Das können und dürfen wir!
- Theoretische Grundlagen
- Theoretische Hintergründe der Konzeption
- Strategische Konsequenzen (Grundansatz/ strategische Prinzipien)
- z.B. Sozialraum- und Lebensweltorientierung, Öffnung der Einrichtung, Niederschwelligkeit und Zugangsgerechtigkeit, Gemeinwesenbezug und Vernetzung
- Das Programm (Output): Maßnahmen, Projekte, Angebote (das der Erreichung der Outcome -Ziele dienende Produkt)
- Kurze Liste: Gesamtüberblick zu allen Programmteilen/ Angeboten (Maßnahmen, Projekten, ggf. auch Methoden)
- Der geplante Output: Darstellung der einzelnen Angebote (Skizzen) als Einheit von Themen, Zielen und Methoden
- Erforderliche Rahmenbedingungen und Ressourcen für das Angebot (Programm) – Voraussetzungen
- Reflexion – Evaluation – Qualitätssicherung
- Qualifizierung, Aus-, Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte
- Beschreibung und Analyse der im Team vorhandenen sowie Abgleich mit den für das Projekt benötigten Kompetenzen
- Ermittlung des Fortbildungsbedarfs des Teams und der einzelnen Teammitglieder
- Grenzen und Perspektiven der Konzeption
- Mögliche Einschränkungen der Wirksamkeit, besondere Chancen usw.
- Ausblick: Kurze Ablaufplanung der Umsetzung der Konzeption
(Vgl. Stange 2012b [u.M.]: o.S. - leicht abgeändert)
6.2.1. Bestandteile einer Bedarfsanalyse für Familienzentren in Sozialräumen unterschiedlicher Größe
Eine systematische Bedarfsanalyse ist die Grundlage für die Erstellung einer maßgeschneiderten Konzeption. Da dies aufgrund unvollständiger Daten und/ oder mangelndem Know-how für viele Einrichtungen und Projekte in der Praxis noch eine große Herausforderung darstellt, soll das Verfahren zur Bedarfsanalyse hier noch einmal genauer dargestellt und anschließend ein beispielhaftes partizipatives Vorgehen skizziert werden.
(Vgl. nachfolgend Stange 2010 [u.M.]: 5 ff.)
1. Sozialraum- und Lebensweltanalyse (Zielgruppenanalyse, Rahmenbedingungen)
Bei der Sozialraum- und Lebensweltanalyse geht es um die Frage, welche Informationen insgesamt über die Zielgruppen vorhanden sind.
Zunächst wird der Sozialraum (Gemeinde, Stadtteil, Quartier, Kiez, Dorf) bezüglich seiner Sozialstrukturdaten, seiner Demographie und seiner kommunalpolitischen Rahmen-bedingungen untersucht und beschrieben (Sozialraumbeschreibung). Auch die Sozialgeografie spielt hier eine wichtige Rolle und der Sozialraum wird hinsichtlich seiner räumlichen Beschaffenheit, Morphologie, Flächennutzung, Spielraumsituation (z.B. Erreichbarkeit der Spielräume, freie Flächen) Verkehrssituation, Gebäudestruktur, Wohnsituation, Umweltsituation/ Ökologie (gesundheitliche Gefahren) etc. analysiert.
Es folgt eine ausführliche Lebensweltanalyse, welche die historische Gewordenheit, die Traditionen, das kollektive Bewusstsein, die Milieus und Subkulturen sowie die subjektiven Sichtweisen, Einstellungen, Bewertungen, Interessen, Bedürfnisse, Wünsche, Probleme aus Sicht der Betroffenen beschreibt.
Zuletzt wird eine Organisations- und Institutionsanalyse vorgenommen, die sich mit der Form und Größe, dem Träger, den administrativen, finanziellen und personellen Rahmenbedingungen, der Organisation, den Programmen und dem Leitbild der beteiligten Einrichtungen auseinandersetzt.
2. Bestandsermittlung
Im Anschluss der Sozialraum- und Lebensweltanalyse wird geprüft, was bereits an Institutionen, Angeboten, Programmen, Ressourcen und Potentialen im Sozialraum vorhanden ist.
So wird zunächst erfasst, welche fachlichen Institutionen, Organisationen, Einrichtungen sowie Programm- und Personen-Netzwerke (Regionale Bildungslandschaften, Präventions-ketten, Familienzentren etc.) bereits vorhanden sind und welche Programme, Dienste, Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen sie anbieten, sodass ein Komplettüberblick über alle vorhandenen Angebote entsteht.
In einem weiteren Schritt werden die im Sozialraum vorhandenen Potentiale und Ressourcen erfasst (Potential-Kataster, Ressourcen-Kataster).
Darüber hinaus ist eine Netzwerk-Analyse insbesondere für Familienzentren wichtig. Hier geht geht es um die Analyse verschiedener Einflussfaktoren und Akteure sowie um das Aufzeigen von Beziehungen und Zusammenhängen (Arbeits- und Austauschprozesse, Einflüsse, aktive und passive Elemente, Netzwerke der Einzelfaktoren).
3. Bewertung
In diesem Abschnitt wird bewertet, ob aus der Sicht der Zielgruppen-Bedürfnisse sowie aus fachlicher Sicht ausreichend Angebote im Bestand vorhanden sind oder ob es Lücken und Defizite gibt. Darüber hinaus wird beurteilt, wie die Qualität der vorhandenen Angebote beschaffen ist.
In diesem Sinne findet zunächst ein Abgleich der Sozialraumanalyse (Bedürfnisse) mit dem Angebot (Bestand) sowie eine Bewertung des Bestands statt.
Anschließend wird eine allgemeine Einschätzung und Bewertung der Ergebnisse der Sozialraumanalyse sowie der Besonderheiten und Auffälligkeiten gegeben sowie Angebotslücken festgestellt. Dieses Vorgehen bezieht sich immer auf den gesamten Planungsraum/ Sozialraum und nicht nur auf das einzelne geplante Projekt.
Ist bereits ein Projekt vorhanden, welches durch die Bedarfsanalyse weiterentwickelt werden soll, findet an dieser Stelle auch eine Gesamtbewertung der Qualität dieses Projekts sowie seiner einzelnen Bestandselemente (Angebote) statt (Feststellung von Qualitätslücken, Selbstevaluation). Im Anschluss kann dies ggf. auch für den ganzen Sozialraum und die Gesamtheit aller Träger und Angebote durchgeführt werden, wofür die Selbstevaluationsinstrumente (wie z.B. Checklisten) allerdings abgewandelt werden müssen.
4. Bedarfsfeststellung (orientiert an den fachlichen Standards/ Qualitätskriterien und den vorhandenen Möglichkeiten, objektiven Rahmenbedingungen, Ressourcen)
In der Bedarfsfeststellung wird geklärt, welcher Bedarf an neuen Angeboten und Maßnahmen sich angesichts der vorhandenen Möglichkeiten, der objektiven Rahmenbedingungen, der Ressourcen und des politischen Willens definieren lässt und welche Prioritäten festzulegen sind. Darüber hinaus geht es um die Frage, wie eine Gesamtkonzept-Skizze aussehen muss.
Hierfür wird zunächst eine Risikoanalyse durchgeführt, geleitet von der Frage, wie die Realisierungschancen der neuen Angebote und Programme aussehen und welche Projektumfeldbedingungen und Wirkkräfte für die Akteure und Angebote zu beachten sind.
Anschließend geschieht eine Bedarfsdefinition aus fachlicher Sicht, in welcher der konkrete Bedarf bestimmt und eine erste grobe Maßnahmen- und Projekte-Sammlung erstellt wird.
Es folgt eine Zielbeschreibung sowie die Suche nach Lösungen. Hierfür werden Ideen und Vorschläge für konkrete Angebote, Maßnahmen, Projekte und Programme zu jeder Angebotslücke entwickelt, die zuvor in der Bewertung identifiziert wurde.
Anschließend werden vorläufige Prioritäten festgelegt und eine Auswahl von Leitprojekten im Sozialraum getroffen, die wiederum einem Prüf-Filter standhalten müssen, der die Realisierungschancen, Interessenlagen, Einflüsse, Risiken etc. für mögliche Maßnahmen und Projekte untersucht.
Auch eine Bedarfseinschätzung aus politischer Sicht muss getroffen werden, welche die vorläufige politische Bewertung und Prüfung anhand fachlicher Kriterien, politischer Interessen und dem politischen Willen umfasst.
Eine erneute Realisierungsprüfung und Risikoanalyse untersucht die Rahmenbedingungen und Wirkkräfte für den Projektstandort und die konkrete Einrichtung (Projektumfeldanalyse, Stakeholder-Analyse, Kraftfeldanalyse).
Zudem müssen die Kooperationsbedingungen und Voraussetzungen für die einzelnen Maßnahmen geklärt, die Ressourcen erschlossen, Kontakte aufgenommen sowie Aushandlungsprozesse mit potentiellen Kooperationspartner geführt werden. Die Aufgabenverteilung, Zeitplanung, Verantwortlichkeiten und Ressourcen-Anteile müssen abgesprochen werden.
Der nächste Schritt ist die Konzeptentwicklung, wie sie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde. Hier geht es um das Gesamtkonzept in Form eines Grobkonzepts bzw. einer Konzeptskizze, nicht um das Konzept einzelner Angebote. Dieses Konzept wird dann dem Träger präsentiert, sofern dieser nicht selbst an der Konzeptentwicklung beteiligt war.
Auf der Grundlage des Konzepts bzw. seiner Präsentation findet eine Bedarfsfeststellung aus politischer Sicht statt, in welcher konkrete Entscheidungen (z.B. des Jugendhilfeausschusses), fachliche Kriterien, politische Interessen und der politische Wille herangezogen werden. In diesem Rahmen fällen die Träger bzw. die Leitung, der Vorstand, die Geschäftsführung oder die Sachgebietsleitung (je nach Größe und Situation des Trägers) eine Entscheidung über das Gesamtkonzept sowie über größere Einzelmaßnahmen und es findet ggf. eine Änderung, endgültige Prioritätenfestlegung und Auswahl statt. Darüber hinaus treffen die einzelnen Fachkräfte im Rahmen ihrer Kompetenzen und Ressourcen eine eigene Entscheidung über die normalen, alltäglichen Maßnahmen (einfache Maßnahmen).
Nach der entgültigen Entscheidung findet ggf. eine Präsentation des Konzepts in der Öffentlichkeit statt.
5. Umsetzung der Bedarfsanalyse
In diesem letzten Abschnitt geht es um die Frage, wie die Angebote, Maßnahmen, Programme und Projekte weiter konkretisiert und ausgestaltet sowie umgesetzt und realisiert werden können. Es geht um die Planung und Umsetzung weiterer Schritte des klassischen Projektmanagements für das Gesamtkonzept (Programm), aber auch für einzelne Maßnahmen und Projekte. So muss zum einen eine Planung der Organisation und Verwaltung stattfinden (Kommunikationsstrategie, Arbeitspakete, Projektstrukturplan, Zeitschiene etc.) und zum anderen die Realisierung des Projekts in Angriff genommen werden (Organisation und Verwaltung der Realisierung des Gesamtkonzeptes bzw. des Programms, Controlling, Schnittstellenanalyse, Prozessbegleitung/ Coaching).
6.2.2. Methodische Beispiele: Partizipative Beratungsformate für Bedarfsanalysen und den Entwicklungsprozess von Gesamtkonzepten
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Methoden, mit denen eine Bedarfsanalyse durchgeführt und ein Gesamtkonzept entwickelt werden kann. Zu Beginn steht immer die Auswertung bereits bestehender und/ oder erhobener Daten und Informationen zum jeweiligen Sozialraum. Für die anschließende Problem-, Ziel- und Maßnahmenbestimmung und Bewertung können jedoch zwei verschiedene Grund-Ansätze gewählt werden.
Beim ersten Ansatz werden die weiteren Überlegungen auf der Basis der Informationen und Daten zum Sozialraum von einer kleinen Gruppe oder auch von einzelnen Experten bzw. Vertretern der beteiligten Einrichtungen angestellt. Auch denkbar ist die Delegation der Auswertung und Ideenfindung an unbeteiligte Dritte mit einer besonderen Expertise (wie bspw. Universitäten, Hochschulen o.a.). Auf diesen Überlegungen aufbauend wird dann ein Konzept verfasst.
Der zweite Ansatz legt sein Hauptaugenmerk auf die Partizipation der betroffenen Einwohner, Einrichtungen, Dienste und Stakeholder des jeweiligen Sozialraums, um gezielt auch die subjektive Expertise der Menschen zu ihrer eigenen Lebenswelt mit aufnehmen und in die weiteren Planungen mit einbeziehen zu können. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass durch die Vielzahl der mitarbeitenden Menschen ein hohes Kreativitäts- und Informationspotential entsteht. Wenn die beteiligten Menschen zugleich potentielle Nutzer der Angebote sind, können durch ihre Mitarbeit wertvolle Informationen zu den Zielgruppen-Bedürfnissen gewonnen werden. Ein darauf abgestimmtes Angebot wird mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich besser angenommen als ein Angebot, das von Unbeteiligten entwickelt wurde. Zugleich findet eine Aktivierung der Menschen vor Ort statt und sie bekommen die Möglichkeit, sich von Anfang an mit dem geplanten Projekt zu identifizieren. Dies kann zukünftigen Hemmschwellen zur Inanspruchnahme des entwickelten Angebots vorbeugen und die Bereitschaft erhöhen, sich auch in Zukunft für das Projekt und ihren Stadtteil engagieren zu wollen. Ebenso kann die Beteiligung der familienunterstützenden Einrichtungen und Dienste des Sozialraums sehr sinnvoll sein, da sie wichtige zukünftige Kooperationspartner darstellen und so die Möglichkeit besteht, sich auf gemeinsame Ziele zu verständigen und eine wichtige Grundlage für die spätere Zusammenarbeit zu legen. Darüber hinaus haben die Einrichtungen und Dienste i.d.R. sehr gute Kenntnisse zu dem Sozialraum, in dem sie arbeiten sowie zu den Menschen, die darin leben. Sie kennen sich aus mit den Problemlagen im Stadtteil, den Bedarfen und Lebenslagen der Menschen, den Angeboten, die angenommen oder nicht angenommen werden sowie mit den Methoden, die greifen oder auch nicht greifen.
Welche Personengruppe in welchem Umfang beteiligt wird, muss anhand der jeweiligen Möglichkeiten, Strukturen und Ressourcen vor Ort entscheiden werden.
Wichtig bei einer Bedarfsanalyse ist, dass es immer eine kompetente Gruppe oder Einzelperson gibt, welche die Hauptverantwortung für das Vorhaben trägt, es vorantreibt, die Prozesse koordiniert und moderiert sowie im Nachgang die Ergebnisse auswertet und für die Konzeptentwicklung aufbereitet. Ist eine solche Expertise vor Ort nicht vorhanden, sollte sie von außen hinzugeholt werden.
Im Folgenden soll ein beispielhaftes partizipatives Vorgehen für eine Bedarfsanalyse erläutert werden:
1. Schritt: Auswertung der Daten und Informationen zum Sozialraum
Zunächst müssen alle relevanten Daten und Informationen zum jeweiligen Sozialraum zusammengetragen bzw. erhoben sowie anschließend ausgewertet werden, sodass in einem weiteren Schritt für den Sozialraum typische Fragestellungen und Problemlagen abgeleitet werden können.
2. Schritt: Beteiligung der Betroffenen in Form von Großgruppenworkshops
Die Betroffenen werden zu einzelnen oder mehreren Großgruppenworkshops eingeladen und arbeiten gemeinsam an der Vervollständigung und Bewertung der ausgewerteten Daten, des Bestands und der abgeleiteten Problemlagen. Im Anschluss können gemeinsam Ziele, Maßnahmen und Methoden entwickelt und gewichtet sowie Ideen zur Ausgestaltung und Umsetzung des Projekts entwickelt werden.
Bei der Planung und Durchführung von Großgruppenworkshops ist jedoch unbedingt eine besondere Expertise sowie der sichere Umgang mit Moderations-Methoden gefragt. Es bietet sich deshalb an, dass der Prozess durch Fachleute von außen begleitet und beraten wird. Mögliche Großgruppenmethoden können z.B. der Delphi-Stationenlauf, die Zukunftswerkstatt, Open-Space-Veranstaltungen, die Sozialraumwerkstatt, Informations- und Disku-Märkte sein (vgl. Stange et al. 2006: 3).
3. Schritt: Auswertung der Ergebnisse und Konzeptentwicklung
In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse der Workshops ausgewertet und für das Konzept aufbereitet. Eine kleine Gruppe oder Einzelperson kann sich dann an die Ausformulierung eines ersten Konzeptentwurfs machen.
4. Schritt: Diskussion und Überarbeitung des Konzepts
Es ist zu empfehlen, dass der erste Konzeptentwurf mit einer Gruppe von Vertretern der wichtigsten beteiligten Einrichtungen und Akteure (Entscheider, Geldgeber) des Sozialraums gemeinsam diskutiert und überarbeitet wird, damit sich alle Beteiligten in dem Entwurf wiederfinden können und ein realisierbares Projekt entsteht. Hierbei ist jedoch eine Gruppengröße zu wählen, die ein intensives und produktives Arbeiten und Diskutieren noch zulässt.
Wie das hier skizzierte Vorgehen auch in der Praxis umgesetzt werden kann, soll anhand des nachstehend beschriebenen Praxisprojekts in Cuxhaven erläutert werden.
7. Familienzentrum in Cuxhaven Ritzebüttel – Entwicklung eines Gesamtkonzepts
7.1. Der Beratungsprozess
Zu Beginn des Jahres 2012 haben Frau Prof. Dr. Angelika Henschel und Herrn Prof. Dr. Waldemar Stange von der Leuphana Universität Lüneburg gemeinsam mit einer Gruppe von sieben Masterstudierenden die Beratung hinsichtlich der Konzeptionsentwicklung für ein geplantes Familienzentrum im Stadtteil Ritzebüttel in Cuxhaven aufgenommen. Der Ev. Kindertagesstätten-verband Cuxhaven hat diesen Beratungs- und Konzeptionsentwicklungs-prozess initiiert, begleitet und koordiniert.
Der Beratungsprozess setzte sich aus vier verschiedenen Phasen zusammen: einer Vorbereitungs- und Einarbeitungsphase, einer Workshopphase zur Bedarfsanalyse, einer Konzeptionsentwicklungsphase sowie einer Phase zur Diskussion und Überarbeitung des ersten Konzeptionsentwurfs.
In der Vorbereitungs- und Einarbeitungsphase wurde zunächst umfangreiches schriftliches Material zur sozialen Lage in Ritzebüttel gesichtet, auf dessen Basis eine erste Sozialraum- und Lebensweltanalyse vorgenommen wurde. In der darauf folgenden Workshopphase wurden zwei stark partizipativ geprägte Bedarfsanalysen-Workshops mit jeweils ca. 60 TeilnehmerInnen in Ritzebüttel durchgeführt, unter der Leitung und Moderation der Universitätsvertreter. Ziel dieser beiden Großgruppen-Workshops mit dem Titel „Auf dem Weg zum Familienzentrum“ war es, die Ausgangssituation in Ritzebüttel in Kooperation mit den sozialen AkteurInnen hinsichtlich der vorhandenen Bedarfsanalysen abzugleichen und aktuell zu definieren, um hierdurch die Bedarfe der Familien festzustellen. An den zwei Workshops, welche im Abstand von sechs Wochen durchgeführt wurden, nahmen jeweils einzelne VertreterInnen der verschiedenen familienunterstützenden Institutionen in Ritzebüttel teil. Auf der Basis der in der Bedarfsanalyse erarbeiteten Ergebnisse wurde im Zuge dieser Masterarbeit ein erster Konzeptionsentwurf für das Familienzentrum Ritzebüttel entwickelt. Dieser wurde im Rahmen zweier Treffen mit einer Konzeptionsgruppe vor Ort diskutiert und überarbeitet, sodass er im Anschluss für den weiteren Implementierungsprozess des Familienzentrums sowie für einen Projektantrag beim Landkreis Cuxhaven verwendet werden konnte.
7.1.1. Ausgangslage
Der Stadtteil Ritzebüttel, auch Lehfeld genannt, ist ein Geschosswohnungsquartier mit besonderen sozialen Problemlagen und vielen benachteiligten Familien und Kindern. So befanden sich bei einer Erhebung der sozialen Daten 2006 22,7% der GrundschülerInnen im Armutsbereich und der Landkreis musste bei ca. 50% der Hortkinder die Elternbeiträge übernehmen. Darüber hinaus haben ca. 50-60% der Schulkinder einen Migrations-hintergrund und der Anteil nichtdeutscher Bewohner insgesamt beläuft sich in Ritzebüttel auf etwa 30%. Sehr ungünstige Schulübergangsquoten, ein überdurchschnittlich hoher Bevölkerungsrückgang, eine schlechte Wohnungsqualität sowie städtebauliche Missstände kommen hinzu (vgl. NWP & re.urban 2006: 5ff.). Darüber hinaus haben der hohe Anteil an Multiproblemfamilien sowie innerfamiliäre Konflikte und emotionale Belastungen oftmals eine ungünstige emotionale und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zur Folge. Gleichzeitig birgt der Stadtteil mit seiner kulturellen und lebensweltlichen Vielfalt sowie mit seinem Reichtum an jungen Menschen und Familien auch viele Chancen und Potentiale, die es besser zu nutzen gilt.
Die (sozial-)pädagogische Infrastruktur des Stadtteils ist bereits sehr reichhaltig, da es viele engagierte Einrichtungen gibt, die untereinander gut vernetzt sind und vielfältige Angebote für einzelne Zielgruppen bereit halten. Es mangelt jedoch an Angeboten für die ganze Familie sowie an einer zentralen Steuerung und Koordinierung der Netzwerke und Angebote. Das geplante Familienzentrum soll deshalb die Steuerungsfunktion des sozialräumlichen Gesamtnetzwerks übernehmen und ein bedarfsgerechtes Angebot für alle Familien des Stadtteils bereithalten.
7.1.2. Vorgehen
Methodisches Vorgehen in den Workshops:
Im ersten Workshop zur Bedarfsanalyse haben die Teilnehmenden in einer partizipativen Großgruppenmethode zusammengearbeitet, dem so genannten „Delphi-Stationen-Lauf“. Hierfür wurden auf rund 30 Moderationstafeln bestimmte Leitfragen gestellt, die von insgesamt ca. 60 Teilnehmenden simultan, das heißt parallel und gleichzeitig, beantwortet wurden. Diese standen in zufällig zusammengelosten Kleingruppen an jeweils unterschiedlichen Tafeln und bearbeiteten die vorgegebenen Leitfragen auf Moderationskarten in Form eines Gruppen-Selbstinterviews. Zwischenzeitlich konnten die Gruppen jeweils an weitere freie Tafeln wechseln und so nacheinander mehrere Themenkomplexe bearbeiten. Im Anschluss daran haben die Kleingruppen bestimmte Bereiche und Antworten mit Hilfe von Klebepunkten gewichtet und so eigene Schwerpunkte gesetzt. Die gewählte Methode hat den Vorteil, dass alle 60 TeilnehmerInnen zur gleichen Zeit intensiv miteinander ins Gespräch kommen und eine große Fülle an Ergebnissen entsteht. Da alle Beiträge gleichwertig sind und auf Karten festgehalten werden, geht nichts verloren und alle Teilnehmenden haben die gleiche Chance, sich einzubringen. Auch vermeintlich gegensätzliche Aussagen und Bedenken können nebeneinander stehen bleiben und in die weiteren Überlegungen einbezogen werden. Die Bewertung und Gewichtung bestimmter Schwerpunkte durch die Bepunktung der Teilnehmenden geschieht auf eine demokratische und transparente Art und Weise, sodass sich am Ende alle TeilnehmerInnen mit den Ergebnissen identifizieren können. Gleichzeitig entsteht an den Tafeln ein ausführliches und vollständiges Protokoll der Ergebnisse.
Im zweiten Workshop wurden zunächst die zentralen Ergebnisse des ersten Workshops vorgestellt und ein kurzer theoretischer Input zu den Organisationsmodellen von Familienzentren gegeben. Im Anschluss daran hatten die TeilnehmerInnen in kleineren Gruppen von bis zu sieben Personen die Möglichkeit, sich intensiv mit der inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung des Familienzentrums auseinanderzusetzen. Die Kleingruppenarbeit wurde von jeweils einer Studentin oder einem Studenten bzw. einer Professorin oder einem Professor moderiert und die erarbeiteten Ergebnisse wurden auf Moderationskarten festgehalten und an Tafeln visualisiert.
Inhaltliches Vorgehen:
Sozialraum- und Lebensweltanalyse
Zu Beginn des Beratungsprozesses wurde zunächst eine Sozialraum- und Lebensweltanalyse durchgeführt auf der Basis von unterschiedlichen schriftlichen Materialien zur sozialen Situation in Ritzebüttel. Diese wurden der Leuphana Universität Lüneburg vom Ev. Kindertagesstättenverband Cuxhaven zur Verfügung gestellt. Es konnten Informationen gewonnen werden zu den sozialen Daten, wie bspw. Anteil der Kinder im Armutsbereich, Anteil der Familien mit Migrationshintergrund, Schulübergangsquoten etc., zur Altersstruktur, zum Bevölkerungsrückgang, zur Zusammensetzung der Haushalte, zur städte- und wohnungsbaulichen Situation sowie zur Betreuungssituation im Stadtteil. In einem weiteren Schritt wurden anhand dieser Daten- und Informationsbasis bestimmte, für den Stadtteil Ritzebüttel charakteristische Problemschwerpunkte abgeleitet, welche im ersten Workshop von den Teilnehmenden überarbeitet und ergänzt werden konnten.
Bestandsermittlung
Zur Ermittlung des Bestands wurden im Vorfeld der beiden Bedarfsanalyse-Workshops an alle familienunterstützenden Einrichtungen des Stadtteils Fragebögen zur Analyse der jeweiligen Institution verschickt. Abgefragt wurden Informationen zu Name, Träger, Ansprechpartner, Finanzierung, Zusammenstellung des Teams, Netzwerkpartner, Angeboten und Zielgruppen der Einrichtungen sowie zur Gruppenzusammensetzung, Größe und dem Betreuungs-schlüssel der Kindertageseinrichtungen im Stadtteil.
Darüber hinaus wurden während des ersten Bedarfsanalyse-Workshops Formblätter zur Erfassung der exakten Netzwerkstrukturen der einzelnen Institutionen verteilt und von den jeweiligen Vertretern ausgefüllt. Diese wurden in der Nachbereitung des Workshops ausgewertet und zu einem sehr reichhaltigen Gesamtnetzwerk der Institutionen im Stadtteil zusammengefügt.
Bewertung (Gebietsprofil und Bestand)
Zur Bewertung des Bestands wurden die erarbeiteten Problemschwerpunkte im ersten Workshop durch die TeilnehmerInnen mit Hilfe von Klebepunkten unterschiedlich gewichtet, sodass deutlich wurde, welche Probleme als besonders schwerwiegend und dringend empfunden wurden und nach Meinung der Kleingruppen als erstes angegangen werden sollten.
Darüber hinaus konnte vor dem Hintergrund der Sozialraum-, Lebenswelt- und Institutionenanalyse eine Bewertung der Vernetzungs- und Angebotsstruktur sowie der für das Familienzentrum zur Verfügung stehenden personellen, räumlichen und finanziellen Ressourcen vorgenommen werden.
Bedarfsfeststellung
Vor dem Hintergrund der Problemlagen haben die TeilnehmerInnen des ersten Workshops im Sinne einer Umkehrmethode Ziele entwickelt: Wie wäre es, wenn es diese Probleme nicht mehr gäbe? Auch die Ziele wurden durch Bepunktung bewertet, sodass deutlich wurde, was für die Teilnehmenden besondere Priorität hatte. Im Anschluss daran wurde die Frage beantwortet, mit welchen Maßnahmen (Programmen, Angeboten) man diese Ziele erreichen könnte. Mit diesen Maßnahmen wurde dann im zweiten Workshop weitergearbeitet. Dort wurde in der Gruppenarbeitsphase intensiv diskutiert, welche Angebote das geplante Familienzentrum endgültig vorhalten sollte, um angemessen auf die Bedarfe der Familien reagieren zu können. Diskutiert wurde auch, wer die Angebote durchführen und wo genau sie stattfinden sollten. Darüber hinaus konnten im Abgleich mit den bereits vorhandenen Maßnahmen Angebotslücken aufgedeckt werden.
Konzeptionsentwurf
Auf der Grundlage der aus der Sozialraumanalyse und den Workshops gewonnenen Ergebnissen ist ein erster Konzeptionsentwurf für das geplante Familienzentrum entstanden, welcher im Rahmen zweier Treffen mit den Vertretern der vier am Familienzentrum beteiligten Einrichtungen, einer Vertreterin des Ev. Kindertagesstättenverbands sowie Vertretern von Stadt und Landkreis Cuxhaven diskutiert und gemeinsam überarbeitet wurde. Die so entstandene Konzeption ist als erste Rohversion zu verstehen und muss im weiteren Implementierungsprozess des Familienzentrums von einer Steuerungsgruppe stetig weiterentwickelt und überarbeitet werden. Darüber hinaus konnte mit einer ausgedünnten Version der Konzeption ein Projektantrag zur finanziellen Förderung des Familienzentrums beim Landkreis Cuxhaven gestellt werden.
7.2. Die Konzeption
7.2.1. Anwendung der Qualitätskriterien auf Cuxhaven
Die Qualitätskriterien für das Familienzentrum in Cuxhaven Ritzebüttel wurden zuvorderst auf der Basis der erarbeiteten Ergebnisse aus den Workshops entwickelt und in der anschließenden Diskussion mit der Konzeptionsgruppe überarbeitet. Anhand dieses Prozesses wurden folgende Grundprinzipien der pädagogischen Arbeit formuliert:
- Selbsthilfeorientierung
- Lebenswelt-, Bedarfs- und Gemeinwesenorientierung
- Niederschwelligkeit der Angebote
- Prävention und Bildung als kontinuierliche, lebensalter übergreifende Prozesse
- Partizipation
- Inklusion und Umgang mit Heterogenität
- Kooperation/ Vernetzung
- Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Auch der Bereich Reflexion – Evaluation – Qualitätssicherung, darin enthalten die (Weiter-) Qualifizierung des pädagogischen Fachpersonals, wird in der Konzeption näher erläutert. Hierbei wurden die in Kapitel 5.5.1. genannten Qualitätskriterien übernommen und den individuellen Gegebenheiten entsprechend teilweise leicht gekürzt und umformuliert. Die Punkte Niederschwelligkeit und Zugänglichkeit der Angebote wurden zu einem Bereich zusammengefasst.
Bei den Qualitätskriterien für den Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Kerngeschäft der Kindertagesstätte konnten die bereits im Vorfeld in einem IQUE-Qualitätsentwicklungsprozess erarbeiteten Leitsätze und Indikatoren der Cuxhavener Einrichtungen verwendet werden. Diese bauen auf den Empfehlungen des niedersächsischen Bildungsplanes auf und umfassen folgende Bildungsbereiche:
- Grundhaltung, emotionales und soziales Lernen, Transparenz
- Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und Freude am Lernen
- Sprache, Schriftkultur, Sprechen, Zuhören
- Naturwissenschaftliches Grundverständnis: Mathematik – Biologie/ Natur – physikalische Grunderfahrungen
- Körper, Bewegung, Sinnesentwicklung
- Lebenspraktische Kompetenzen, Kultur/-techniken
- Ethische und religiöse Fragen – Überlieferungen, Traditionen, Rituale, verschiedene Kulturen, Wertevermittlung und Diakonie
- Übergänge Kita – Grundschule gestalten
- Beobachten und Dokumentation
Die für Cuxhaven erarbeiteten Qualitätskriterien für Angebote und Maßnahmen von Familienzentren, die über den Kernbereich der Kindertagesstätten hinaus gehen, sind folgende:
- Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Kontaktmöglichkeiten für Eltern und Ermöglichung von Selbsthilfeinitiativen
- Stärkung der Erziehungskompetenz
- Beratungs- und Unterstützungsangebote
- Bildungs-, Förder- und Freizeitangebote für Kinder im Alter von 0-12/14 Jahren
- Jugendarbeit
- (Weiter-)Bildungsangebote für Eltern
- Frühe Hilfen
- Altersübergreifende Familien-Angebote
- Präventionsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit
In der Anwendung der allgemeinen Kriterien auf den Cuxhavener Stadtteil Ritzebüttel wurden einige Qualiätsbereiche leicht abgeändert sowie die Angebote der Bereiche Verzeichnisse und Vermittlung, Angebote für Familien mit Kindern unter drei Jahren, Generationen übergreifende Angebote, Kindertagespflege und Förderung von Ehrenamt jeweils in andere, thematisch verwandte Qualitätsbereiche integriert. Der Bereich Stärkung von Elternkompetenzen wurde hingegen in die beiden Bereiche Stärkung der Erziehungskompetenz und (Weiter-)Bildungsangebote für Eltern unterteilt.
8. Zusammenfassung und Ausblick
In den ersten Kapiteln dieser Arbeit wurde deutlich, warum wir Familienzentren in unserer Gesellschaft brauchen und in welchen Modellen, Profilen, Funktionen und Rahmen-bedingungen sie sich bewegen.
In einem weiteren Schritt wurden die Qualitätskriterienkataloge der einzelnen Städte und Bundesländer untersucht und es konnte festgestellt werden, dass sich diese in Umfang, Inhalt und Ausführlichkeit zum Teil deutlich voneinander unterscheiden. Auch die Art der Förderung und die Ressourcen, die den Familienzentren zur Verfügung gestellt werden, fallen sehr unterschiedlich aus. Es stellte sich also die Frage, wie die Qualität von Familienzentren auch überregional bestimmt und sichergestellt werden und wie ein allgemeiner Qualitätskriterienkatalog aussehen kann, der zum einen hochwertige Standards und Orientierungen bereithält und zum anderen die jeweils individuellen Bedarfe und Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt. Hervorgehoben wurde in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der Besonderheiten der vorhandenen Zielgruppen und Sozialräume bei der Konzept- und Angebotsentwicklung. Denn auch in den Qualitätsstandards muss sichergestellt werden, dass ein zielgruppendifferenziertes und bedarfsorientiertes Angebot entsteht, das allen Beteiligten gerecht wird. Auf dieser Basis wurde ein eigener Vorschlag für einen allgemeinen Kriterienkatalog für Familienzentren entwickelt.
Im letzten Teil dieser Arbeit stand die systematische Entwicklung einer maßgeschneiderten Konzeption im Zentrum der Betrachtungen. In diesem Zusammenhang wurden die einzelnen Bestandteile einer Konzeption sowie die Arbeitsschritte einer systematischen Bedarfsanalyse nach Stange zunächst theoretisch erläutert und anschließend anhand eines konkreten Praxisbeispiels exemplarisch angewandt. Auf diese Weise sollte dargestellt werden, dass die entwickelten Qualitätskriterien auch in die Praxis übertragbar sind und zur Entwicklung einer maßgeschneiderten Konzeption für Familienzentren verwendet werden können. Dabei macht allein schon der Umfang der Konzeption des Familienzentrums Ritzebüttel von 42 Seiten deutlich, dass es sich bei diesem Entwurf um mehr handelt, als um eine Kindertagesstätte, die zusätzlich familienunterstützende Angebote bereithält. Es handelt sich um ein sozialräumliches Gesamtkonzept, das ein breit gefächertes Netzwerk für Familien aufspannt und ganzheitliche integrierte Handlungsstrategien bereithält.
In der Praxis muss jedoch klar sein, dass nicht jede Kindertageseinrichtung, die sich weiterentwickeln möchte, eine solch umfangreiche Rolle einnehmen kann wie das skizzierte Familienzentrum in Cuxhaven Ritzebüttel. Wie auch Detert et al. im Abschlussbericht der wissenschaftlichen Evaluation der Familienzentren in Hannover deutlich machen, müssen sich die Einrichtungen über ihr eigenes Selbstverständnis sowie über ihre Ressourcen, Möglichkeiten und zentralen Ziele bewusst sein, wenn das Projekt nicht auf Dauer zu einer deutlichen Überbelastung des Teams oder gar zum Scheitern führen soll.
Darüber hinaus muss verstärkt fachwissenschaftlich diskutiert werden, was genau wir von Familienzentren erwarten und welche Funktionen sie erfüllen sollen. Denn die Potentiale von Familienzentren sind groß, wenn man sie so betrachtet, wie sie in dieser Arbeit gezeichnet wurden: Als Zentrum und koordinierender Motor von sozialräumlichen Gesamtnetzwerken, als integrierte Handlungsstrategie, als integrierter Teil eines kommunalen Gesamtnetzwerks. In der Realität beschränkt sich die Zahl der Familienzentren, die diese Vision tatsächlich erfüllen, auf wenige Leuchttürmprojekte, wie z.B. das bereits erwähnte Projekt in Monheim. Denn für die Umsetzung eines solchen Modells braucht es mehr als ein jährliches Förderbudget von 12.000 oder 13.000 Euro, wie es in Nordrhein-Westfalen gezahlt wird. Es braucht zusätzliche Kompetenzen sowie finanzielle, räumliche und personelle Ressourcen, die zu einer tatsächlichen Entlastung für die pädagogischen Fachkräfte führen und somit ihren Förder- und Bildungsauftrag bezüglich der Kinder unterstützen. Darüber hinaus ist die Einrichtung einer Koordinierungsstelle zentral für die Wahrnehmung der leitenden Netzwerkfunktion im Sozialraum, da die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und umfangreiche Netzwerkkompetenzen voraussetzt. Ob es gelingt, ein integriertes sozialräumliches Gesamtnetzwerk für Familien aufzubauen, hängt jedoch auch von der Bereitschaft der beteiligten Kooperationspartner und Stakeholder ab, sich auf gemeinsame Ziele zu verständigen und sich auf Kooperation anstelle von Konkurrenz einzulassen. Auch das Jugendamt kann entscheidend zum Erfolg eines sozialräumlichen Netzwerks beitragen, indem es eine zentrale Steuerungsfunktion übernimmt, aktiv zur (Um-)Gestaltung der Jugendhilfelandschaft beiträgt und das Familienzentrum als das zentrale Element in seinem familienpolitischen Auftrag unterstützt.
Die Ergebnisse in Monheim, Dormagen und co zeigen, dass es sich lohnt, eine größere Vision von Familienzentren und integrierten Gesamtstrategien zu haben. Deshalb plädiert diese Arbeit dafür, bei der zukünftigen Planung von Familienzentren stärker den Gesamtkontext im Blick zu behalten und dies auch bspw. beim Bau neuer Einrichtungen räumlich zu berücksichtigen.
Dennoch können auch kleinere Einrichtungen mit weniger Ressourcen und Möglichkeiten die vorliegenden Qualitätsstandards erfüllen und für die Entwicklung ihres Konzepts nutzen, wenn sie ein geeignetes Organisationsmodell wählen, intelligente Strategien zur Kooperation und Delegation von Aufgaben entwickeln sowie Ressourcen und Kompetenzen ihrer Partner für sich nutzbar machen. Wichtig ist hier jedoch, dass eine Profilbildung stattfindet und sich die jeweilige Einrichtung auf ihre zentralen Ziele konzentriert anstatt sich mit unerreichbaren Visionen aufzureiben.
9. Literaturverzeichnis
Barnett, Steven (2011): Benefit-Cost-Analysis of the Perry Preschool Program — Kosten-Nutzen-Analyse des Perry Preschool Programms. In: Robert Bosch Stiftung 2011: Qualität und Effekte frühkindlicher Bildung und Betreuung: ein internationaler Vergleich. Abstracts aller Vorträge. 17./18. November 2011. Bosch Repräsentanz Berlin
Detert, Dörte; Rückert, Norbert; Bremer-Hübler, Ulrike; Asche, Eike; Ullrich, Stephan (2012) (u.M.): Abschlussbericht. Wirkfaktoren von Familienzentren mit Early Excellence Ansatz. Wissenschaftliche Evaluation der bestehenden und sich entwickelnden Familienzentren in Hannover und Region. Unveröffentlichtes Manuskript. Hannover
Detert, Dörte; Rückert, Norbert (2012) (u.M.): Präsentation: Wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Familienzentren in Hannover. Unveröffentlichtes Manuskript. Hannover
Deutsches Kinderhilfswerk e.V. (Hrsg.) (2007): Vita gesellschaftlichen Engagements. Eine Studie zum Zusammenhang zwischen früher Beteiligung und dem Engagement bis ins Erwachsenenalter. Laserline. Berlin
Diller, Angelika (2006): Eltern-Kind-Zentren. Grundlagen und Rechercheergebnisse.
URL: http://www.dji.de/bibs/4EKZ-Grundlagenbericht.pdf (gesichtet am 21.06.12)
Diller, Angelika; Schelle, Regine (2009): Von der Kita zum Familienzentrum. Konzepte entwickeln – erfolgreich umsetzen. Verlag Herder GmbH. Freiburg im Breisgau
Drosten, Rabea (2012): Partizipation als kommunale Gewaltprävention. GRIN Verlag GmbH. Norderstedt
Engelhardt, Heike/ Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) (2012) (u.M.): Entwurf einer Definition der nifbe Expertenrunde „Familienzentren in Niedersachsen“. Unveröffentlichtes Manuskript. Hannover
Engelhardt, Heike/ Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) (2012): Expertenrunde “Familienzentren”. Familienzentren in Niedersachsen. Erläuterungen zur Auswertung der Befragung zur Bestandsaufnahme im Oktober 2011.
URL: http://bildungsklick.de/datei-archiv/51721/erlaeuterungen-zur-nifbe-befragung-familienzentren.pdf (gesichtet am 31.08.12)
Engelhardt, Heike; Schenk, Andreas (2010): Von der Kindertageseinrichtung zum Familienzentrum. Konzeption und Dokumentation. Programm Familienzentren Hannover. Hrsg. Landeshauptstadt Hannover Der Oberbürgermeister. Gutenberg Beuys Feindruckerei. Hannover
Fritschi, Tobias; Oesch, Tom (2008): BASS-Studie. Volkswirtschaftlicher Nutzen frühkindlicher Bildung. Bertelsmann Stiftung. Gütersloh
Henry-Huthmacher, Christine; Borchard, Michael (2008): Eltern unter Druck. Selbstverständnisse, Befindlichkeiten und Bedürfnisse von Eltern in verschiedenen Lebenswelten. Lucius & Lucius. Stuttgart
Henschel, Angelika (2011): Präsentation: Familie heute. Veränderte Ansprüche an Bildung, Erziehung und Unterstützung. Fachkonferenz Familien (im) Zentrum – regionale Modelle und Perspektiven. nifbe Regionalnetzwerk NordOst. 30.11.2011. Lüneburg URL: http://nifbe.de/media/RNW%20NordOst%20neu/Familien%20%28im%29%20Zentrum/Familie%20heute%20Endfassung%202.pdf (gesichtet am 25.09.12)
Hertzmann, Clyde (2008): Wirkung messen – zielorientiert steuern. Good-practice-Beispiel aus Kanada URL: http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_24048_24049_2.pdf (gesichtet am 28.09.12)
Hess, Simone (Hrsg.) (2012): Grundwissen Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren. Cornelsen Verlag. Berlin
Internetauftritt der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2012): Familien URL: http://www.gbe-bund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon?p_uid=gastg&p_aid=&p_knoten=FID&p_sprache=D&p_suchstring=2089::Ehepaare,%20Ehepaar (gesichtet am 26.09.12)
Internetauftritt des Hessischen Sozialministeriums: Familienzentren. URL: http://www.hsm.hessen.de/irj/HSM_Internet?cid=1e8dc8aab7b4621dd68659da4a1e31b8
Fach- und Fördergrundsätze zur Etablierung von Familienzentren. URL: http://www.hsm.hessen.de/irj/HSM_Internet?cid=61c60942d2829721e4a195fd3a4e0d94 (gesichtet am 20.06.12)
Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism) (Februar 2009): Das Haus der Familie im ländlichen Raum – eine Handreichung. Mainz. URL: http://www.vivafamilia.de/fileadmin/downloads/Haeuser_der_Familien/Handreichung_laendlicher_Raum_2009_Endversion_mit_ISBN.pdf (gesichtet am 21.06.12)
Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism) (März 2009): Das Haus der Familie mit und für Migrantinnen und Migranten gestalten – eine Handreichung. Mainz. URL: http://www.vivafamilia.de/fileadmin/downloads/Haeuser_der_Familien/Handreichung_Migration_2009_01.pdf (gesichtet am 21.06.12)
Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. (ism) (2010): Leitfaden für die Kooperation mit der Kommune. Landesmodellprojekt „Häuser der Familien in Rheinland-Pfalz“. Mainz. URL: http://www.vivafamilia.de/fileadmin/downloads/Haeuser_der_Familien/Leitfaden_Kooperation_Kommune.pdf (gesichtet am 21.06.12)
Internetauftritt der Familienzentren im Emsland: URL: http://www.familienzentrum-emsland.de/index.php?con_cat=7&con_lang=1 (gesichtet am 23.07.12)
Internetauftritt des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz (MIFKJF RP): Häuser der Familien – Mehrgenerationenhäuser. URL: http://www.vivafamilia.de/34.html (gesichtet am 24.07.12)
Landkreis Osnabrück (Hrsg.) (o.J.): Kriterienkatalog Familienzentrum. Modellprojekt (Broschüre)
Lowe Vandell, Deborah (2011): Results of the NICHD-Study: Effects of Early Child Care Are Found at Age 15 Years — Ergebnisse der NICHD-Studie: Effekte frühkindlicher Betreuung beobachtet bei 15-Jährigen. In: Robert Bosch Stiftung 2011: Qualität und Effekte frühkindlicher Bildung und Betreuung: ein internationaler Vergleich. Abstracts aller Vorträge. 17./18. November 2011. Bosch Repräsentanz Berlin
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz (MASGFF RP) (2010): Förderkriterien. Landesförderung „Haus der Familie“. Ausbauprogramm. Mainz. URL: http://www.vivafamilia.de/fileadmin/downloads/Haeuser_der_Familien/HdF_Foerderkriterien_01-01-2010.pdf (gesichtet am 21.06.12)
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz (MASGFF RP) (Hrsg.) (2009): Das Haus der Familie im ländlichen Raum – eine Handreichung. URL: http://www.vivafamilia.de/fileadmin/downloads/Haeuser_der_Familien/Handreichung_laendlicher_Raum_2009_Endversion_mit_ISBN.pdf (gesichtet am 21.06.12)
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MGFFI NRW) (Hrsg.) (2007): Das Gütesiegel Familienzentrum NRW. Zertifizierung der Piloteinrichtungen. Veröffentlichungsnummer 1041. URL: http://www.familie-in-nrw.de/fileadmin/fileadmin-kommaff/pdf/Guetesiegel.pdf (gesichtet am 19.06.12)
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MGFFI NRW) (Hrsg.) (2008): Wege zum Familienzentrum Nordrhein-Westfalen. Eine Handreichung. Veröffentlichungsnummer 1058
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MGFFI NRW) (Hrsg.) (2009): Familienzentren in Nordrhein-Westfalen – Neue Zukunftsperspektiven für Kinder und Eltern. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung im Überblick. Veröffentlichungsnummer 1092
Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Festfalen (Hrsg.) (o.J.): Von Kult bis Kultur. Von Lebenswelt bis Lebensart. Ergebnisse der Repräsentativuntersuchung „Lebenswelten und Milieus der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland und NRW“. URL: http://www.sinus-institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/Lebenswelten_und_Milieus_2009.pdf (gesichtet am 21.08.12)
Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.) (2005): Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder. Schlütersche Druck GmbH & Co. KG. Langenhagen
NWP Planungsgesellschaft mbH; re.urban Stadterneuerungsgesellschaft (2006): Stadt Cuxhaven. Bereich „Lehfeld“. Vorbereitende Untersuchungen/ Entwicklungskonzept für den Oberbürgermeister. Oldenburg
Karkow, Christine; Kühnel, Barbara (2008): Das Berliner Modell. Qualitätskriterien im Early Excellence Ansatz. Dohrmann Verlag. Berlin
Rißmann, Michaela; Remsperger, Regina (2011): Die Kita auf dem Weg zum „Eltern-Kind-Zentrum“. Konzeptionsbericht und Strategiepapier. URL: http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmsfg/abteilung4/referat33/modellprojekt_eltern_kind_zentrum/konzeptionsbericht_final_30_06_2011.pdf (gesichtet am 18.06.12)
Schlevogt, Vanessa (2012): KiFaz, Eltern-Kind-Zentren oder Haus der Familie. Konzepte und Fördermodelle von Kinder- und Familienzentren im bundesweiten Vergleich. In: KiTa aktuell spezial 1. URL: http://www.schlevogt.de/upload/2012/Schlevogt_Kita-Spezial-1-2012-Familienzentren.pdf (gesichtet am 16.07.12)
Schulverwaltungsblatt Niedersachsen, Amtlicher Teil (SVBl 2/ 2005): Sonderpädagogische Förderung. URL: http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=1885&article_id=6268&_psmand=8 (gesichtet am 25.08.12)
Stange, Waldemar; Hartmann Kristin; Holzmann Steffi (2006): Erziehungs- und Bildungspartnerschaften als Aufgabe von Kindertagesstätten. Seminar 3. Visualisierung in Partizipationsprozessen (VIPP): eine Arbeitshilfe. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). Gütersloh
Stange, Waldemar (2008): Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Stadtplanung und Dorfentwicklung. Aktionsfelder – exemplarische Orte und Themen II. Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OHG. Münster
Stange, Waldemar (2012a) (u.M.): Präsentation: Familienzentrum ein Modell für die Zukunft?! Dargestellt am Beispiel der Konzeptionen für NRW und Hannover und der Recherchen des Deutschen Jugendinstitutes. Unveröffentlichtes Manuskript. Lüneburg
Stange, Waldemar (2012b) (u.M.): Präsentation: Konzeptentwicklung. Unveröffentlichtes Manuskript. Lüneburg
Stange, Waldemar (2012c): Erziehungs- und Bildungspartnerschaften – Grundlagen, Strukturen, Begründungen. In: Stange, Waldemar; Krüger, Rolf; Henschel, Angelika; Schmitt, Christof (Hrsg.) (2012): Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit. Springer VS. Wiesbaden
Stange, Waldemar (2012d): Elternarbeit als Netzwerkaufgabe. In: Stange, Waldemar; Krüger, Rolf; Henschel, Angelika; Schmitt, Christof (Hrsg.) (2012): Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit. Springer VS. Wiesbaden
Statistisches Bundesamt (2004): Datenreport 2004. Wiesbaden.
Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit (MSFG TH) (2006): Jugend und Familie. S. 156-159. Kapitel: Fachliche Empfehlungen für Familienzentren in Thüringen vom 15. März 2004. URL: http://www.familie.unijena. de/familie_multimedia/Dokumente/Familie+und+Kind/EA13_Jugend_Familie_Rechtliches+in+ Th%D0%83ringen.pdf (gesichtet am 17.06.12)
Tietze et al. (Hrsg.) (2012): NUBBEK. Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit. Fragestellungen und Ergebnisse im Überblick. Berlin
Wüstenberg, Wiebke (1992): Soziale Kompetenz 1-2 jähriger Kinder. Johann Wolfgang Goethe-Universität. Institut für Sozialpädagogik. Frankfurt am Main
Wippermann, Carsten; Flaig, Berthold Bodo (2009): Lebenswelten von Migrantinnen und Migranten. In: Bundeszentrale für politische Bildung (2009): Aus Politik und Zeitgeschichte 5/ 2009. 26. Januar 2009. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. URL: http://www.bpb.de/apuz/32229/lebenswelten-von-migrantinnen-und-migranten-pdf (gesichtet am 17.08.12)
Zander, Margherita; Dietz, Berthold (2003): Kommunale Familienpolitik. Expertise für die Enquetekommission „Zukunft der Städte in NRW“ des Landtages von Nordrhein-Festfalen. Münster/ Drensteinfurt URL: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/EK/EKALT/13_EK1/EKZukunftStadteNRW_ZanderEtAl_KommunaleFamilienpolitik_2003.pdf (gesichtet am 26.09.12)
Zentrum Bildung der EKHN (Hrsg.) (2010): Rahmenkonzept Familienzentren in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). URL: http://ebfb.zentrumbildung-ekhn.de/fileadmin/erwachsenenbildung/004_Familienbildung/Familienzentren/Rahmenkonzept-Neuauflage.pdf (gesichtet am 17.06.12)
Abkürzungsverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis:
Abb. 1: Modell Unter einem Dach / Zentrumsmodell (vgl. MGFFI NRW 2008: 8)
Abb. 2: Modell Galerie / Kooperationsmodell (vgl. MGFFI NRW 2008: 15 f.)
Abb. 3: Modell Lotse (vgl. MGFFI NRW 2008: 12)
Abb. 4: Verbundsystem (vgl. MGFFI NRW 2008: 17)
Abb. 5: Die Drei Säulen einer Gesamtstrategie nach Stange (vgl. Stange 2012d: 522)
Abb. 6: Netzwerkverhältnis der Unterstützungsstrukturen für Familien nach Stange (vgl. Stange 2012c: 34)
Abb. 7: Planungsebenen in kommunalen Gesamtsystemen nach Stange (vgl. Stange 2012c: 35)
Abb. 8: Qualitätsdimensionen eines Familienzentrums (vgl. Diller & Schelle 2009: 129)
Abb. 9: Werkzeuge des Qualitätsmanagments (vgl. Diller & Schelle 2009: 135)
Abb. 10: Aufbau der Familienzentren im Emsland URL: http://www.familienzentrum- emsland.de/index.php?con_cat=20&con_lang=1 (gesichtet am 23.07.12)
Abb. 11: Sinus-Milieus in Deutschland 2009 URL: http://www.jugend- gruendet.de/uploads/pics/sinus-milieus2009.jpg (gesichtet am 17.08.12)
Abb. 12: Die Migraten-Milieus in Deutschland 2008 URL: http://www.caritas.de/cms/contents/caritasde/medien/bilder/fachthema/
migration/diemigranten-milieus/migrantenmilieus_in_deutschland.gif? w=600&h=600&e=y&k=y&c=-1 (gesichtet am 17.08.12)
Abb. 13 Spiralphasen-Modell nach Schuchard 1985 URL: http://www.grin.com/object/document.75855/2934818aada7dfdc3845c6544d70ce63_LARGE.png (gesichtet am 31.08.12)
-

-
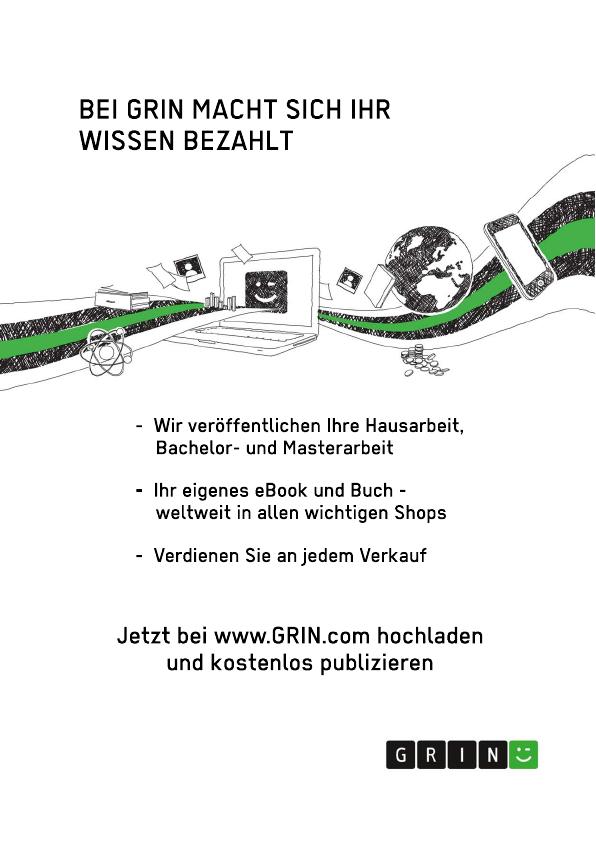
-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.

