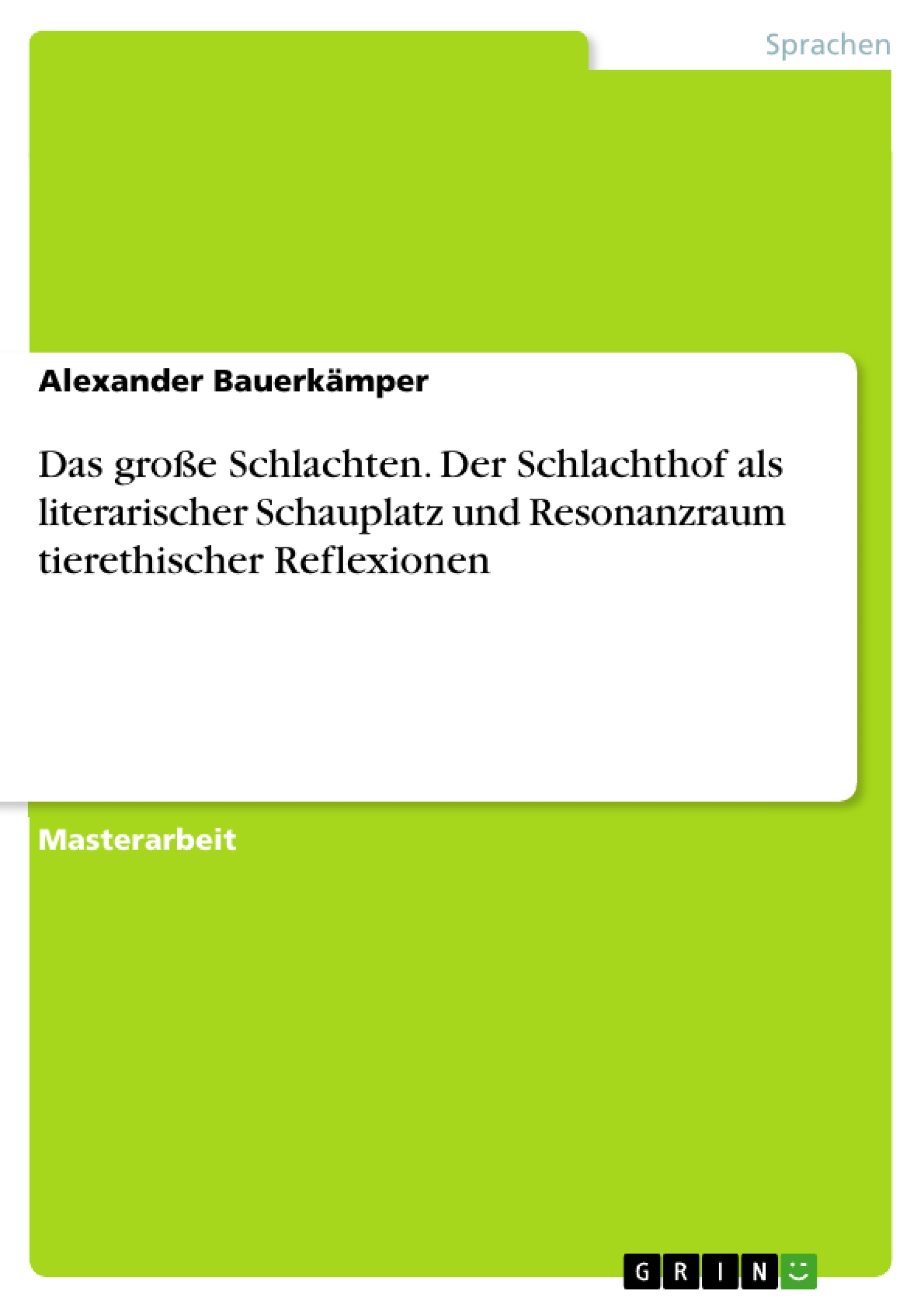Diese Arbeit zeigt, dass der Schlachthof vielfach als Schauplatz in der Literatur auftaucht, insbesondere als allegorische Versinnbildlichung einer Kritik an den sozialen und politischen Verhältnissen. Das Paradebeispiel hierfür ist "Der Dschungel" (1906) von Upton Sinclair. Der Roman erzählt den Leidensweg von Jurgis Rudkus und seiner Familie, mit der er als litauischer Einwanderer und Arbeitssuchender in den berühmten Union Stockyards von Chicago landet. Sinclair schildert die katastrophalen Zustände unter denen die Menschen in den Yards hausen, im Akkord das Vieh abstechen und es auf den hochmodernen disassembly lines zerlegen müssen. "Der Dschungel" gibt Einblicke in die Arbeitsweise der damaligen Schlachthöfe und die Grausamkeit ihrer monopolistischen, rein gewinnorientierten Verwertungslogik. Tausende Tiere werden dort stündlich geschlachtet, Krankheit und giftige Stoffe liegen in der Luft und die absolute Armut und Abhängigkeit der Arbeiter ist für uns heute kaum vorstellbar – der Schlachthof als Symbol unserer Zeit.
Neben "Der Dschungel" gibt es noch weitere Texte, welche im Schlachthof spielen oder Episoden im Schlachthof erzählen. Die in literaturwissenschaftlicher Hinsicht besonders spannenden Werke – insbesondere der außergewöhnliche Roman "Blösch" (1983) von Beat Sterchi – sollen in dieser Arbeit untersucht werden, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede vergleichend herauszuarbeiten. Was dabei entsteht ist eine Art ‚Kanon der Schlachthofliteratur‘.
Der zweite Spannungspol dieser Arbeit, der das Thema punktuell spezifiziert, ist das Tier im Schlachthof. Dabei soll auf die Art der Darstellung, die Rolle und die ethische Position der Tiere innerhalb dieser ‚Schlachthofliteratur‘ eingegangen werden. Was erzählen die Autoren über das Dasein der Tiere an diesem Ort, den wir niemals betreten werden, und der ihr Schicksal besiegelt – der ihr Schicksal ist?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 1.1 Thematische Eingrenzung
- 1.2 Zentrale Fragen und Thesen
- 1.3 Vorgehensweise
- 2 Vorgeschichte: Zum Motiv des Schlachtens
- 2.1 Fleisch und Moral
- 2.2 Mitleid und Ekel
- 2.3 Fazit Was ist der Mensch, wie soll er sein?
- 3 Schauplatz Schlachthof
- 3.1 Raumtheoretische Vorbemerkungen
- 3.2 Themenkomplexe und erzählte Welt
- 3.2.1 Alltag I: Gefahr für Leib und Leben
- 3.2.2 Alltag II: Männer, Männlichkeit, Stolz.
- 3.2.3 Alltag III: Frauen, Weiblichkeit, Sexismus
- 3.2.4 Alltag IV: ‚Fremdarbeiter‘ und Fremdenfeindlichkeit
- 3.2.5 Konsequenz I: Entmenschlichung und Hoffnungslosigkeit
- 3.2.6 Konsequenz II: Widerstand und Hoffnung
- 3.2.7 System und Systemkritik
- 3.2.8 Zur Sinnbildlichkeit des Schlachthofs
- 3.3 Zusammenfassung.
- 4 Tier und Tierethik im Schlachthof.
- 4.1 Grundlagen der Tierethik
- 4.2 Rolle und Darstellung der Tiere
- 4.3 Der Schlachthof als Resonanzraum tierethischer Reflexionen
- 4.4 Zusammenfassung.
- 5 Schlussbemerkung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Rolle des Schlachthofs in der Literatur und seinen Stellenwert als Resonanzraum tierethischer Reflexionen. Die Arbeit widmet sich der Frage, wie der Schlachthof als Ort der Gewalt und des Leidens in der Literatur thematisiert und wie diese Thematik mit ethischen Fragen nach dem Verhältnis von Mensch und Tier verbunden ist.
- Der Schlachthof als literarischer Schauplatz und Symbol
- Die Darstellung von Gewalt und Leid im Schlachthof
- Die Rolle der Tiere in der Literatur und ihre ethische Relevanz
- Die Verbindung zwischen dem Schlachthof und tierethischen Reflexionen
- Die Kritik an der modernen Fleischproduktion und Konsumgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Thematik der Arbeit und erläutert die zentralen Fragen und Thesen. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Vorgeschichte des Schlachtens und beleuchtet die Verbindung zwischen Fleischkonsum und Moral sowie den Aspekten von Mitleid und Ekel. Der Schwerpunkt des dritten Kapitels liegt auf der Analyse des Schlachthofs als literarischer Schauplatz, wobei die Themenkomplexe und die erzählte Welt des Schlachthofs untersucht werden. Das vierte Kapitel widmet sich der Rolle des Tiers und der Tierethik im Schlachthof und beleuchtet die Grundlagen der Tierethik, die Darstellung der Tiere in der Literatur sowie den Schlachthof als Resonanzraum tierethischer Reflexionen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Schlachthof, Literatur, Tierethik, Gewalt, Leid, Mensch-Tier-Verhältnis, Fleischproduktion, Konsumgesellschaft, Symbol, Resonanzraum, Reflexion, Kritik.
- Quote paper
- Alexander Bauerkämper (Author), 2015, Das große Schlachten. Der Schlachthof als literarischer Schauplatz und Resonanzraum tierethischer Reflexionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315166