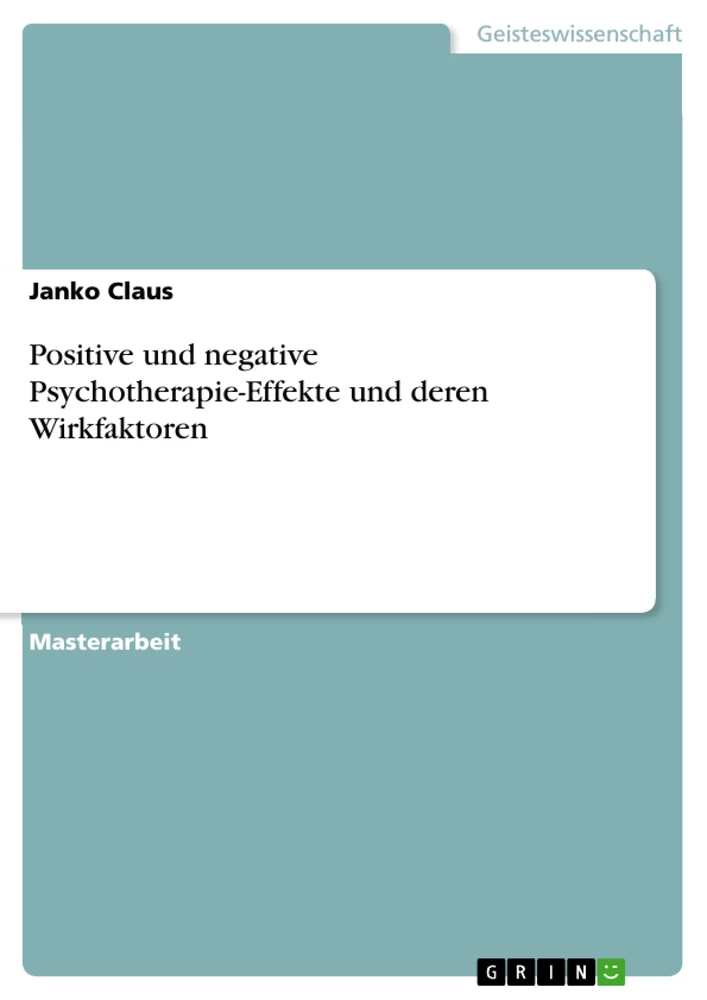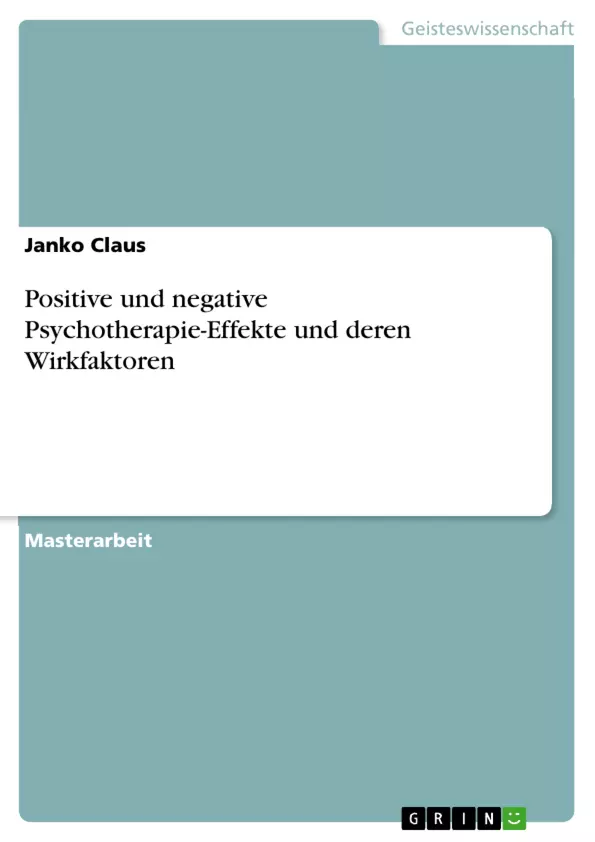Die vorliegende Master-Thesis widmet sich dem Thema: „Positive und negative Psychotherapie-Effekte und deren Wirkfaktoren“. Es wurden folgende Forschungsfragen untersucht: Was sind die Wirkfaktoren der Psychotherapie? Welche Wirkfaktoren kommen bei der Psychodynamischen Therapie, der Kognitiv-Behavioralen Therapie und der Gruppentherapie zum Tragen? Wie häufig treten Verschlechterungen auf? Was ist unter negativen Therapiewirkungen zu verstehen? Was sind die Ursachen für negative Therapiewirkungen?
Die Erstellung der Arbeit basiert auf der Methode der Literaturrecherche. In dem Zeitraum von Oktober 2014 bis Juli 2015 wurde in folgenden Datenbanken nach themenrelevanten Publikationen gesucht: PubMed, PsyContent, PSYNDEX, Springerlink und Google Scholar. Zudem wurde in den Bibliotheken der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Universitätsbibliothek der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg nach Fachbüchern und Zeitschriftenbeiträgen recherchiert.
Die Literaturrecherche erfolgte durch eine Kombination aus systematischer und unsystematischer Recherche, dabei wurden die nachfolgenden Schlüsselwörter in deutscher und englischer Sprache (in Verbindung mit dem Psychotherapie-Begriff) verwendet: Wirkfaktoren, Nebenwirkungen, negative Therapieeffekte, Placeboeffekte, außer- und extratherapeutische Faktoren, allgemeine Wirkfaktoren, spezifische Wirkfaktoren, Wirkfaktoren der Verhaltenstherapie, Wirkfaktoren der Gruppentherapie, Wirkfaktoren psychoanalytisch begründeter Verfahren, Therapie-Dosis-Effekt, Wirksamkeit von Laienhelfern, unerwünschte Ereignisse, Therapieschäden, Therapie-Misserfolg, Passung, Diagnostik, Stigmatisierung, Therapeutenvariablen, Klientenvariablen, Therapiebeziehung, Behandlungsfehler, Negativeffekte der Gruppentherapie, Negativeffekte der Verhaltenstherapie, Negativeffekte der Psychoanalyse, Negativeffekte psychodynamischer Verfahren, Abbrecher, Kunstfehler, Rückmeldesysteme, Qualitätssicherung, Systemfehler, Äquivalenzparadoxon.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung.
- 1 Einleitung
- 2 Methodik
- 3 Positive Psychotherapie-Effekte und deren Wirkfaktoren.
- 3.1 Extratherapeutische Faktoren
- 3.2 Die Bedeutung des Placebo-Effekts für die Psychotherapie
- 3.3 Allgemeine Wirkfaktoren...
- 3.3.1 Allgemeine Wirkprinzipien der Psychotherapie nach Grawe.
- 3.3.2 Das Allgemeine Modell der Psychotherapie von Orlinsky und Kollegen................
- 3.4 Spezifische Wirkfaktoren...
- 3.4.1 Kritik an der Manualisierung
- 3.4.2 Allgemeine versus spezifische Wirkfaktoren
- 3.4.3 Der Einfluss spezifischer Interventionen auf spezifische Störungen
- 3.4.4 Die Wirkfaktoren psychodynamischer Therapien
- 3.4.5 Die Wirkfaktoren der Verhaltenstherapie..
- 3.4.6 Die Wirkfaktoren der Gruppentherapie.
- 3.5 Wirkzusammenhänge spezifischer und allgemeiner Wirkfaktoren
- 3.6 Weitere Wirkungszusammenhänge...
- 3.6.1 Der Therapie-Dosis-Effekt.
- 3.6.2 Die Wirksamkeit von Laienhelfern im Vergleich zu professionellen Therapeuten...
- 3.7 Zusammenfassung
- 4 Negative Psychotherapie-Effekte und deren Wirkfaktoren
- 4.1 Begriffsbestimmungen.
- 4.2 Häufigkeiten eines negativen Therapie-Outcomes.
- 4.3 Negativeffekte durch Psychotherapie.
- 4.3.1 Unerwünschte Ereignisse und negative Therapieeffekte
- 4.3.2 Nebenwirkungen, Therapieschäden und Kunstfehlerfolgen
- 4.3.3 Therapie-Misserfolg..
- 4.4 Die Ursachen negativer Therapieeffekte.
- 4.4.1 Passungsprobleme.
- 4.4.2 Risiken und Kontraindikationen
- 4.4.3 Fehlerhafte Diagnostik und Stigmatisierung.
- 4.4.4 Therapeutenseitige Ursachen
- 4.4.5 Klientenseitige Ursachen.
- 4.4.6 Schlechte Therapiebeziehung...
- 4.4.7 Behandlungsfehler.
- 4.4.8 Systemfehler.
- 4.5 Zusammenfassung.
- 4.5 Therapiespezifische Negativwirkungen und deren Ursachen...........
- 4.5.1 Negativeffekte psychodynamischer Therapien.
- 4.5.2 Negativeffekte der Verhaltenstherapie
- 4.5.3 Negativeffekte der Gruppentherapie..
- 4.6 Diskussion der Ergebnisse.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Master-Thesis beschäftigt sich mit positiven und negativen Effekten der Psychotherapie und deren Wirkfaktoren. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema zu geben. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von allgemeinen und spezifischen Wirkfaktoren für den Therapieerfolg und untersucht die Ursachen für negative Therapieeffekte.
- Allgemeine und spezifische Wirkfaktoren in der Psychotherapie
- Ursachen für negative Therapieeffekte
- Die Bedeutung der Therapiebeziehung
- Therapiespezifische Negativwirkungen
- Qualitätssicherung in der Psychotherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die historische Entwicklung der Psychotherapieforschung dar und beleuchtet die Evidenz für die Wirksamkeit der Psychotherapie. Kapitel 3 befasst sich mit positiven Therapieeffekten und deren Wirkfaktoren. Es werden sowohl allgemeine als auch spezifische Wirkfaktoren in der Psychotherapie beleuchtet, wobei die Bedeutung von Therapeuten-, Klienten- und Beziehungsvariablen hervorgehoben wird. Kapitel 4 widmet sich den negativen Therapieeffekten. Es werden verschiedene Kategorien von negativen Effekten vorgestellt und deren Ursachen analysiert. Es werden sowohl systemische als auch individuelle Faktoren betrachtet, die zu negativen Therapieergebnissen führen können. Die Diskussion der Ergebnisse fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt Ausblicke auf zukünftige Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Psychotherapie, Wirkfaktoren, positive Therapieeffekte, negative Therapieeffekte, Nebenwirkungen, Therapiebeziehung, Therapieschäden, Qualitätssicherung, Forschung, Evidenz.
- Arbeit zitieren
- Janko Claus (Autor:in), 2015, Positive und negative Psychotherapie-Effekte und deren Wirkfaktoren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340611