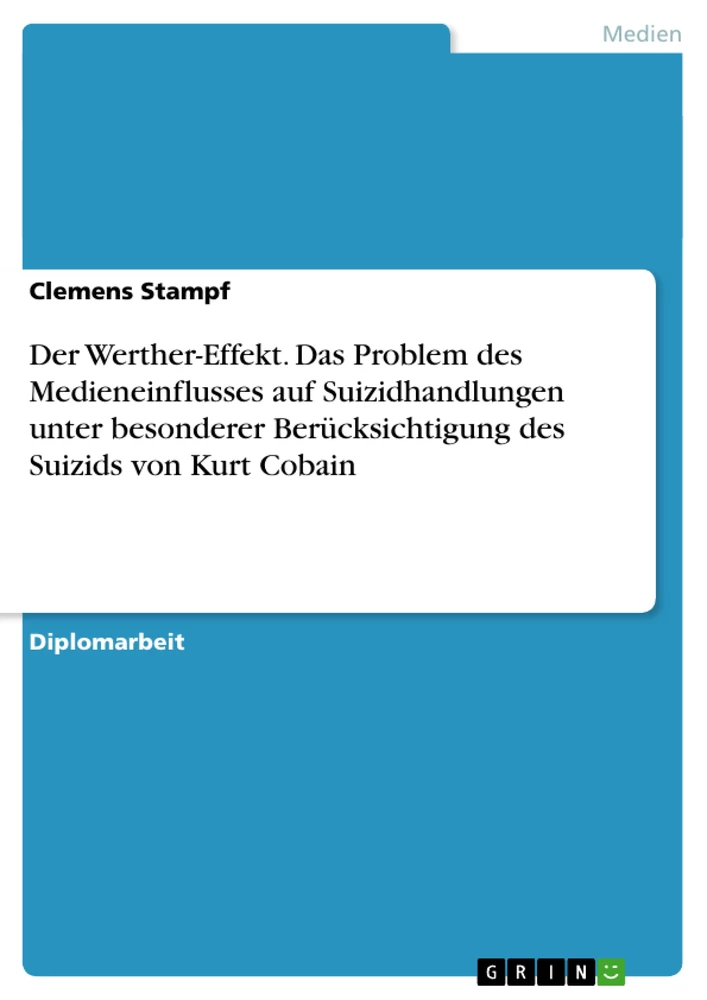1 EINLEITUNG
Es war ein Tag im April 1994. Ich war 18 Jahre alt und den ganzen Tag über gab es kein anderes Gesprächsthema in der Schule und unter Freunden als "Kurt Cobain hat sich umgebracht." Die Betroffenheit in meiner Umgebung war groß. Kaum jemand, der nicht eine Nirvana - Platte besaß, kaum jemand, der Cobains verweigernde, vermeintlich rebellische Haltung nicht ein bisschen bewunderte. Damals begann mich eine Frage zu beschäftigen, die mich bis zum heutigen Tage nicht losgelassen hat: Warum nimmt sich ein Mensch das Leben? Was muss passieren, damit die Angst vor der Zukunft, vor dem Leben jeden Erhaltungstrieb negiert?
Und bald schon wurde angesichts von Warnungen, dass Jugendliche Cobain in den Tod folgen könnten, eine neue Frage aufgeworfen: Worauf ist suizidales Nachahmungsverhalten rückzuführen - auf die Beschaffenheit eines medialen Berichts, auf die Prädisposition des Individuums, auf die Wechselwirkung von beidem, oder spielen hier ganz andere Faktoren eine Rolle? Diese Fragestellungen waren wohl rückblickend die Geburtsstunde dieser Arbeit.
Betrachtet man Suizid und Suizidversuch, so erkennt man in ihnen Verhaltensweisen, die nur dem Menschen zukommen. Voraussetzung dafür ist der selbstreflexive Gedanke, der eigenen Existenz durch bewusstes Handeln ein Ende setzen zu können. Lässt man sich auf eine tiefergehende Beschäftigung mit der Suizidproblematik ein, stößt man schnell auf eine unglaubliche Fülle an Literatur: Das Thema spannt sich von der Soziologie zur Anthropologie, von der Medizin zur Psychologie, von der Philosophie zur Religion. Bei all diesen Perspektiven, aus denen der Suizid gesehen wurde, bleibt eines doch immer gleich: Über Suizid zu schreiben ist eine schwierige und heikle Angelegenheit.
Die Auseinandersetzung mit dem Suizid ist die Konfrontation mit einer, grundlegende existentielle Belange berührenden, Materie - dem Tod, und es gibt wohl keinen Menschen, bei dem, wenn er an den Tod denkt, nicht auch Gedanken an die eigene Sterblichkeit aufflackern
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 THEORETISCHE ASPEKTE DER SUIZIDALITÄT
- 2.1 GRUNDLAGEN DER SUIZIDFORSCHUNG
- 2.2 TERMINOLOGIE
- 2.3 DEFINITION DER SUIZIDALITÄT
- 2.4 DIFFERENZ ZWISCHEN SUIZID UND SUIZIDVERSUCH
- 2.5 EPIDEMIOLOGISCHE SUIZIDFORSCHUNG
- 2.5.1 Repräsentative Erfassung von Suizid und Suizidversuch
- 2.5.2 Soziologische Suizidtheorie nach Durkheim
- 2.5.3 Risikogruppen
- 2.5.4 Resümee epidemiologischer Erkenntnisse
- 2.6 KLINISCH - PSYCHIATRISCHE ERKLÄRUNGSMODELLE
- 2.6.1 Depression und Suizid
- 2.6.2 Vererbung und Suizid
- 2.6.3 Suchterkrankungen und Suizid
- 2.6.4 Suizidale Entwicklung nach Pöldinger
- 2.6.5 Das präsuizidale Syndrom
- 2.6.6 Ärger und Hoffnungslosigkeit als Erklärungskonstrukte der Suizidalität
- 2.7 TIEFENPSYCHOLOGISCHE ANSÄTZE
- 2.7.1 Sigmund Freuds Suizidtheorie
- 2.7.2 Selbstdestruktivität als Folge einer Ich - Schwäche
- 2.7.3 Objektbeziehungspsychologische Erklärungsmodelle
- 2.7.4 Die narzisstische Krise
- 2.7.5 Die Entwicklung der narzisstischen Persönlichkeit
- 2.7.6 Suizidhandlungen im Rahmen narzisstischer Krisen
- 2.7.7 Narzisstische Suizidalitätsformen
- 2.8 LERNTHEORETISCHE ANSÄTZE
- 2.8.1 Die klassische Konditionierung
- 2.8.2 Instrumentelle Konditionierung
- 2.8.3 Modelllernen
- 3 IDENTITÄTSKONSTRUKTION UND SUIZID
- 3.1 DER BEGRIFF „IDENTITÄT“
- 3.1.1 Identitätsauffassung der Moderne
- 3.1.2 Postmoderne Identitätsauffassung
- 3.1.3 Das Konzept der narrativen Identität
- 3.1.4 Der narrative Ansatz in der Suizidforschung
- 3.2 IDENTITÄTSIDEEN
- 3.2.1 Retrospektive der Identitätsidee Grunge
- 3.2.2 Kurt Cobain im Zentrum der Identitätsidee Grunge
- 4 MASSENMEDIEN UND SUIZID
- 4.1 THEORIEN UND KONZEPTE DER MASSENKOMMUNIKATION
- 4.1.1 Wirkansatz
- 4.1.2 Nutzen - Belohnungsansatz
- 4.1.3 Der dynamisch - transaktionale Ansatz
- 4.1.4 Die systemtheoretische Sichtweise
- 4.1.5 Eine konstruktivistische Perspektive
- 4.1.6 Kulturtheoretischer Ansatz/ Cultural Studies
- 4.2 THESEN ZUR WIRKUNG MEDIALER GEWALTDARSTELLUNGEN
- 4.2.1 Thesen zur Verhinderung realer Gewalt durch mediale Gewaltmodelle
- 4.2.2 Thesen zur Begünstigung realer Gewalt durch mediale Gewaltmodelle
- 4.2.3 These zur Desensibilisierung durch mediale Gewaltmodelle
- 4.2.4 Die These der Wirkungslosigkeit
- 4.2.5 Medienpädagogische Implikationen
- 4.3 MEDIENINDUZIERTE SUIZIDHANDLUNGEN: GIBT ES DEN „WERTHER - EFFEKT“?
- 4.3.1 Empirische Evidenz für medieninduzierte Suizidhandlungen
- 4.3.1.1 DIE STUDIEN VON D. P. PHILLIPS
- 4.3.1.2 EINE STUDIE ZUR FERNSEHSERIE ,, TOD EINES SCHÜLERS\" VON A. SCHMIDTKE UND H. HÄFNER
- 4.3.1.3 EINE STUDIE ZUR FERNSEHSERIE „, CASUALTY\" VON K. HAWTON ET AL.
- 4.3.1.4 DER SUIZID DES HOTEL - SACHER - CHEFS GÜRTLER: EINE STUDIE VON B. HADINGER
- 4.3.1.5 DER SUIZID UWE BARSCHELS: EINE STUDIE DES INSTITUTES FÜR RECHTSMEDIZIN DER UNIVERSITÄT HAMBURG
- 4.3.1.6 ,,FINAL EXIT“. EINE STUDIE VON P. MAZURK ET AL.
- 4.3.1.7 DIE WIENER U-BAHNSUIZIDE: EINE STUDIE VON G. SONNECK ET AL., INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE, WIEN
- 4.3.1.8 EXKURS: MEDIENEINFLUSS AUF SUIZIDHANDLUNGEN IN JAPAN VON 1955 BIS 1985. EINE STUDIE VON S. STACK
- 4.3.2 Ein Medienwirkungsmodell zur Beeinflussung suizidrelevanter Handlungsdeterminanten von Christa Lindner-Braun
- 4.4 NACHRICHTENAUSWAHL: REALITÄT ALS MEDIALE KONSTRUKTION
- 4.4.1 Gatekeeper - Forschung
- 4.4.2 Nachrichtenwert - Theorie
- 4.5 DIE BERICHTERSTATTUNG ZUM SUIZID KURT COBAINS: EIN RÜCKBLICK
- 5 DAS FALLBEISPIEL MTV
- 5.1 FORSCHUNGSINTERESSE
- 5.2 VORSCHLÄGE FÜR EIN INHALTSANALYTISCHES UNTERSUCHUNGSDESIGN
- 5.3 ENTWURF FÜR EIN KATEGORIENSCHEMA
- 5.3.1 Formalkriterien
- 5.3.2 Inhaltliche Kriterien
- 5.4 DIE MTV - BERICHTERSTATTUNG VOM 8. APRIL 1995
- 5.5 EXPERTINNENINTERVIEW
- 5.5.1 Expertinneninterview zum Thema ,,Medieneinfluss auf Suizidhandlungen“
- 5.5.2 Auswertung des Interviews
- 5.6 STATISTISCHE VERGLEICHSDATEN. DIE AUSWIRKUNGEN DES COBAIN - SUIZIDS
- 5.7 RESÜMIERENDE INTERPRETATION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit setzt sich zum Ziel, die Problematik des Medieneinflusses auf Suizidhandlungen zu untersuchen. Im Zentrum der Arbeit steht der sogenannte „Werther-Effekt“ und dessen Bedeutung in der heutigen Gesellschaft. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Suizids von Kurt Cobain im Kontext der medialen Berichterstattung und dessen möglicher Einfluss auf die Gesellschaft.
- Theoretische Grundlagen der Suizidalität
- Identitätskonstruktion und Suizid
- Massenmedien und Suizid
- Medieninduzierte Suizidhandlungen und der „Werther-Effekt“
- Der Suizid von Kurt Cobain als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und skizziert den Forschungsstand zum Thema „Werther-Effekt“. Kapitel zwei befasst sich mit den theoretischen Aspekten der Suizidalität und beleuchtet verschiedene Erklärungsmodelle aus unterschiedlichen Disziplinen. Im dritten Kapitel werden die Konzepte der Identitätskonstruktion im Zusammenhang mit Suizidhandlungen diskutiert, wobei insbesondere die Identitätsidee Grunge und die Rolle von Kurt Cobain in diesem Kontext beleuchtet werden.
Kapitel vier behandelt die Thematik der Massenmedien und Suizid und analysiert verschiedene Theorien und Konzepte der Massenkommunikation. Darüber hinaus werden Thesen zur Wirkung medialer Gewaltdarstellungen und die empirische Evidenz für medieninduzierte Suizidhandlungen diskutiert. Im fünften Kapitel wird das Fallbeispiel des Suizids von Kurt Cobain und dessen mediale Berichterstattung analysiert. Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und interpretiert.
Schlüsselwörter
Suizid, Suizidalität, Werther-Effekt, Massenmedien, Medienwirkung, Mediengewalt, Identitätskonstruktion, Grunge, Kurt Cobain, Soziologie, Psychologie, Psychiatrie, Empirie, Fallstudie, Inhaltsanalyse, Medienpädagogik.
- Arbeit zitieren
- Clemens Stampf (Autor:in), 2002, Der Werther-Effekt. Das Problem des Medieneinflusses auf Suizidhandlungen unter besonderer Berücksichtigung des Suizids von Kurt Cobain, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4820