Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Entwicklung der Fragestellung
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Forschung zur Unterbringung von chronisch psychisch kranken Menschen
2.1 Exkurs: Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten für chronisch psychisch kranke Menschen
2.2 Chronizität
2.3 Enthospitalisierung
2.4 Alternative Ansätze im Umgang mit chronisch psychisch kranken Menschen
2.4.1 Alternative Wohnformen
2.4.2 Alternative Behandlungsansätze
2.5 Heimforschung
2.5.1 Heimkritik
2.5.2 Soziale Exklusion psychisch kranker Menschen
2.5.3 Spezialfall Übergangswohnheim
2.5.4 Studien zur Lebensqualität
2.6 Detlef Petry: Die Wanderung. Eine trialogische Biographie über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren
3 Methodisches Vorgehen
3.1 Wahl des Forschungsansatzes
3.1.1 Qualitative Forschung
3.2 Feldzugang
3.2.1 Kontaktaufnahme zu den Bewohnern des Übergangswohnheimes
3.3 Entscheidungsfindung
3.3.1 Das Übergangswohnheim
3.3.2 Robert Krocker
3.4 Unterschiedliche Perspektiven
3.4.1 Kontaktaufnahme zum Vater
3.4.2 Kontaktaufnahme zu den Geschwistern
3.4.3 Betreuerperspektive
3.4.4 Verlaufsakte
3.4.5 Krankenakte
3.4.6 Forscherin
3.5 Angewandte Methoden der Erhebung und Auswertung
3.5.1 Feldforschung und teilnehmende Beobachtung
3.5.2 Gespräche
3.5.3 Interview mit Robert Krocker
3.5.4 Interview mit der Pflegedienstleitung
3.5.5 Auswertung der Daten
3.5.6 Rekonstruktion von subjektiver Wirklichkeit
3.5.7 Die Validierung kommunikativ gewonnener Daten
3.6 Subjektivität der Forscherin
3.6.1 „going native“
3.6.2 Reaktivität im Feld
3.7 Gütekriterien qualitativer Forschung
3.8 Leseanleitung / Darstellungsentscheidung
4 Darstellung der Ergebnisse
4.1 Lebenskontext Übergangswohnheim
4.1.1 Beschreibung und Konzeptanalyse des untersuchten Übergangswohnheimes
4.1.2 Die Menschen, die im Übergangswohnheim leben
4.2 Biographischer Überblick von Robert Krocker
4.3 Leben im Übergangswohnheim
4.3.1 Tagesablauf
4.3.2 Küchendienst
4.3.3 ‚Essgewohnheiten’
4.3.4 Beschäftigungs-/Arbeitstherapiemaßnahmen
4.3.5 ‚Zimmerpflege’
4.3.6 Medikation
4.3.7 Andere Termine
4.4 Einordnung als ein „Bewohner“ des ÜWHs
4.4.1 Verpflichtungen
4.4.2 Kommunikation
4.4.3 Teilnahme am Essen
4.4.4 Medikamenteneinnahme
4.4.5 Süchte / Drogen
4.4.6 Aggressivität / Gewalt
4.4.7 Manieren
4.4.8 Fachjargon
4.4.9 Grenzen
4.4.10 Krankheit als Daseinsberechtigung
4.4.11 Dauer des Aufenthaltes
4.4.12 Familienanbindung
4.5 „Ich bin sehr extrem geartet“
4.5.1 Selbstbeschreibung als „krank“
4.5.2 Drogen / Medikamente
4.5.3 Von „Adam Cartwright“ zu „Old Shatterhand“
4.6 Exkurs: Krankenakte
4.7 Jenseits von Krankheit
4.7.1 Radio hören
4.7.2 Lesen
4.7.3 Wissen um Daten und Fakten
4.7.4 Sammelinteresse
4.7.5 Zukunftsideen
4.7.6 Reflexionsfähigkeit
4.8 Beziehungen
4.8.1 zu Profis
4.8.2 zu Frauen
4.8.3 zu anderen Menschen
4.8.3.1 Freundschaften
4.8.3.2 „Kumpelbeziehung[en]“
4.8.3.3 „Mitpatienten“
4.8.3.4 „ehemalige[...] Bewohner“
4.8.3.5 Mitbewohner
4.8.3.6 „Gruppen“
4.8.3.7 „Buchladen“
4.8.3.8 „Verkäuferin[nen]“
4.8.3.9 Apotheke
4.8.3.10 „Tante-Emma-Laden“
4.8.4 zur Familie
4.8.4.1 Vater
4.8.4.2 Mutter
4.8.4.3 Geschwister
4.8.5 zur Forscherin
5 Zusammenfassung und Diskussion
5.1 Rekonstruktion der subjektiven Wirklichkeit
5.2 Rekonstruktion der sozialen Wirklichkeit
5.3 Passung zwischen Bedürfnissen und Betreuungsangebot
5.4 Einordnung des Werdegangs von Robert Krocker in die Theorie
5.5 Methodenkritische Anmerkungen
5.6 Andere Wege
Literaturverzeichnis
Anhang
1 Einleitung
Die vorliegende Diplomarbeit wird im Rahmen des Forschungsprojektes Bestandsaufnahme der Steuerung der Unterbringung und Betreuungsqualität chronisch psychisch kranker Menschen aus Berlin in Heimen der Freien Universität Berlin (Prof. Dr. Manfred Zaumseil) und der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (Prof. Dr. Ralf-Bruno Zimmermann) durchgeführt. Die Verfasserin der Arbeit ist als Studentin des Fachbereiches Erziehungswissenschaft und Psychologie im Diplomstudiengang Psychologie der Freien Universität Berlin an diesem Projekt beteiligt.
In Folge der Psychiatrie-Enquête (1975) wurden die meisten psychiatrischen Langzeitkliniken aufgelöst und die Betten auf den psychiatrischen Stationen weitestgehend abgebaut. Das Ziel einer gemeindenahen Versorgung wurde damit jedoch nicht für alle psychisch erkrankten Menschen erreicht. In Berlin gab es eine große Anzahl psychiatrischer Krankenhausbetten, die in Pflegeheimbetten umgewandelt wurden (Hoffmann, 2003).
Nach wie vor lebt ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland in Heimen, davon ca. 140.000 Menschen in Heimen der Behindertenhilfe und etwa 660.000 in Alten- und Pflegeheimen (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, 1998). Auch in Übergangswohnheimen sind Menschen mit einer chronisch psychischen Erkrankung auf Dauer untergebracht.
Aufgrund dieses Sachverhaltes wird u.a. vom Bundesverband Psychiatrie-Erfahrene e.V. (Laupichler, 2002) und der Forschungsgemeinschaft „Menschen in Heimen“ (Dörner; Röttger-Liepmann; Hopfmüller, 2001) eine Enquête der Heime gefordert, um das bisherige Heimsystem einer Überprüfung zu unterziehen.
Da ich mich im Rahmen meines Studiums bereits im Weddinger Psychoseseminar für das Erleben von Psychosen und deren Auswirkungen auf die Biographie eines Menschen interessiert habe, verfolge ich im Rahmen des o.g. Projektes das Ziel, eine biographische Einzelfallanalyse eines Mannes, der in einem Heim für chronisch psychisch kranke Menschen in Berlin lebt, vorzunehmen.
1.1 Entwicklung der Fragestellung
Die Datensammlung zu einer Lebensgeschichte findet ja, ist sie einmal intensiv und mit Interesse am Detail begonnen, prinzipiell kein Ende. (Fuchs, 1984, S. 193)
Meine Fragestellung hat sich nach den ersten Kontakten im Feld sowie im weiteren Forschungsverlauf verändert und weiterentwickelt. „Mit der Entscheidung für eine konkrete Fragestellung ist jeweils auch eine Reduktion der Vielfalt und damit Strukturierung des untersuchten Feldes verbunden“ (Flick, 1995, S. 65). Zunächst war ich ganz allgemein an einer Rekonstruktion der Biographie von Robert Krocker[1] interessiert. Hierfür wollte ich die unterschiedlichen Perspektiven (Betroffener, Betreuer, Angehörige, Krankenakte) untersuchen und zusammenführen. Aufgrund der großen Vielfalt meiner Daten sehe ich mich gezwungen, das Anliegen zu konkretisieren. Auf welche Aspekte ich mich konzentriere, stelle ich nachfolgend dar.
Da ich mich dem Feld näherte mit der Vorstellung, Menschen, die in einem Heim für chronisch psychisch Kranke leben, wollen dieses entweder so bald wie möglich wieder verlassen oder leben dort bereits resigniert und ohne Hoffnung, es verlassen zu können, stieß ich bald auf die ersten Irritationen. Robert äußert keine Kritik an der Unterbringung im Heim und zeigt kein ersichtliches Bestreben, an seinem Lebensumfeld etwas zu verändern. Er lebt weder zurückgezogen noch hat er resigniert. Stattdessen macht er auf mich einen sehr aufgeschlossenen und selbstreflexiven Eindruck. Im Zuge der intensiven Auseinandersetzung mit dem Feld und aufgrund meines Erlebens von Robert machte ich mich auf die Suche nach Erklärungen, wie er sein Umfeld erlebt, warum er keine Gedanken in Richtung Auszug hegt und wie er sich mit dem Wohnort Heim arrangiert. Die Rekonstruktion seiner subjektiven Wirklichkeit, die ihm seinen Heimaufenthalt als so akzeptabel und selbstverständlich erscheinen lässt, soll im Vordergrund stehen. Dies wirft die Frage nach der Übereinstimmung des Angebotes mit den Erfordernissen bezüglich der Betreuung von in Heimen lebenden Menschen auf.
Diese Form der Einzelfallanalyse bzw. Darstellung aus der Sicht der Betroffenen nimmt in der Forschung neben PETRY (2003) (siehe Kapitel 2.6) und RIEMANN (1987) einen noch zu geringen Anteil ein.
Somit ergeben sich folgende forschungsleitende Fragestellungen:
Ein Ziel soll es sein, die subjektive Wirklichkeit von Robert Krocker zu rekonstruieren:
- Wie erlebt und beschreibt Robert Krocker sein Leben im Heim?
Des Weiteren möchte ich die Sicht der Mitarbeiter (soziale Wirklichkeit) rekonstruieren:
- Wie erleben und beschreiben die Mitarbeiter den Menschen Robert Krocker?
Und schließlich:
- In wieweit passt Robert Krocker sich mit seinen Bedürfnissen an das Betreuungsangebot der Institution Heim an?
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in 5 Kapitel. Die vorliegende Einleitung und Entwicklung der Fragestellung bilden bereits das Kapitel 1.
In Kapitel 2 zeige ich den theoretischen Hintergrund meiner Arbeit und den aktuellen Stand der Forschung auf. Vorweg stelle ich eine Diskussion über die verschiedenen Begrifflichkeiten, die für chronisch psychisch kranke Menschen Anwendung finden. Ich gebe einen Überblick über Studien zur Chronizität bei psychischen Erkrankungen. Des Weiteren gehe ich auf die Ziele und Auswirkungen der Enthospitalisierung ein. Ebenfalls beschreibe ich einige alternative Wohnformen und fasse Behandlungsansätze zusammen. In einem weiteren Abschnitt dieses Kapitels stelle ich die Heimforschung mit entsprechender Heimkritik dar. Ich erläutere ein neues Konzept zur Erfassung und Beschreibung der Lebenssituation von psychisch kranken Menschen und damit ihrer sozialen Exklusion. Da Robert Krocker in einem Übergangswohnheim[2] lebt, arbeite ich die Unterschiede von Pflegeheimen und ÜWHs aus. Weiterhin gebe ich einen Überblick über die Studien zur Lebensqualität von Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Letztlich stelle ich die trialogische Biographie von Detlef Petry vor.
Gegenstand des 3. Kapitels ist das methodische Vorgehen und die Durchführung der Untersuchung. Die Wahl des Forschungsansatzes, der Feldzugang, die Entscheidungsfindung und die unterschiedlichen Perspektiven auf Robert Krockers Lebensgeschichte stehen hierbei im Zentrum. Ich stelle die angewandten Methoden der Erhebung und Auswertung dar und beschäftige mich eingehend mit dem Einfluss der Subjektivität der Forscherin und wende Gütekriterien qualitativer Forschung auf meine Untersuchung an.
Kapitel 4 stellt mit der Darstellung der Ergebnisse den umfangreichsten Abschnitt dieser Arbeit dar. Zunächst zeige ich den Lebenskontext von Robert Krocker auf und gebe einen kurzen biographischen Überblick von ihm. Des Weiteren beschreibe und interpretiere ich sein Leben und seine Einordnung als ein Bewohner unter den anderen. Ebenso umfasst dieses Kapitel eine Rekonstruktion der Selbstdarstellung von Robert Krocker, einen Exkurs in seine Krankenakte und eine Rekonstruktion der Dinge, aus denen er Kraft schöpft (Kraftquellen). Ferner untersuche ich Robert Krockers Beziehungen zu seinen Mitmenschen eingehender.
Im 5. Kapitel fasse ich zunächst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen. Ich widme mich anschließend der Einordnung von Roberts Werdegang in die Theorie und der Frage, inwiefern eine Institution Einfluss auf eine Biographie nehmen kann. Ebenso umfasst dieses Kapitel eine Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen sowie eine Diskussion über mögliche andere Wege im Umgang mit chronisch psychisch kranken Menschen.
Der Anhang der Arbeit enthält die Interviewleitfäden und Datenschutzverträge sowie eine Vorlage der Transkriptionsregeln.
2 Forschung zur Unterbringung von chronisch psychisch kranken Menschen
Das folgende Kapitel hat das Ziel, den theoretischen Hintergrund zu verdeutlichen, der meinen Zugang zum Forschungsgegenstand begleitet und gelenkt hat. Vorangestellt habe ich in Kapitel 2.1 eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Begrifflichkeiten, die für chronisch psychisch kranke Menschen Anwendung finden. In Kapitel 2.2 geht es um das Verständnis von Chronizität bei psychischen Erkrankungen. Den Hergang und die Auswirkungen der Enthospitalisierung schildere ich in Kapitel 2.3. Im Weiteren werden in Kapitel 2.4 die alternativen Ansätze im Umgang mit den Betroffenen thematisiert, dies ist gefolgt vom aktuellen Stand der Heimforschung in Kapitel 2.5. Schließlich stelle ich in Kapitel 2.6 die Verfahrensweise eines professionellen Helfers dar, die mich während meiner Forschungstätigkeit inspiriert hat.
2.1 Exkurs: Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten für chronisch psychisch kranke Menschen
Ein psychisch Kranker ist ein Mensch, der bei der Lösung einer
altersgemäßen Lebensaufgabe in eine Krise und Sackgasse geraten ist, weil seine Verletzbarkeit und damit sein Schutzbedürfnis und sein Bedürfnis, Nicht-Erklärbares zu erklären, für ihn zu groß und zu schmerzhaft geworden sind (Bleuler, 1987, zitiert nach Dörner, Plog, Teller, Wendt, 2002, S. 17).
Während des Verfassens meiner Diplomarbeit bin ich immer wieder in den Konflikt geraten, welchen Begriff ich für die Menschen mit einer chronisch psychischen Erkrankung wählen soll. Je nach Umfeld variierten die Bezeichnungen. Je intensiver ich mich mit einer bestimmten Thematik (z. B. Unterbringung im Heim) auseinander gesetzt habe, umso mehr habe ich mich selbst bei der Übernahme der in diesem Bereich üblichen Benennungen (z. B. Bewohner) ertappt. Aus diesem Grunde möchte ich an dieser Stelle eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Begrifflichkeiten führen.
Ich möchte deutlich hervorheben, dass ich die Betroffenen als Menschen ansehe, die um diese Erfahrung reicher sind als ich, und von denen ich im Dialog vieles über Psychosen gelernt habe, das in keinem Lehrbuch in Erfahrung zu bringen ist.
Ich kam über das Weddinger Psychoseseminar mit Menschen in Kontakt, die sich selbst „ Psychoseerfahrene “ (Bock, Deranders, Esterer, 2001, S. 14) nennen. In diesem öffentlichen Forum tauschen sich die Menschen mit Psychose- bzw. Psychiatrieerfahrung, die Angehörigen, im psychiatrischen Bereich Tätige (sofern sie vertreten sind) und Studenten über den Themenkreis Psychosen aus, wobei in diesem Kreis die Psychoseerfahrenen als die „ Experten in eigener Sache “ (Bombosch; Hansen; Blume, 2004, S. 29) gelten.
In der Vorlesung über Psychopathologie und Psychiatrische Krankheitslehre in der Klinik werden mir diese Menschen als < Patienten > oder als < Fälle > vorgestellt.
Während der Auseinandersetzung mit diesem Thema sind mir weitere gängige Bezeichnungen von Professionellen begegnet: „ Psychiatrie-Erfahrene, [...] Patienten, Klienten, Bewohner, Betroffene, Nutzer, Teilnehmer..., paradoxerweise mitunter < Gäste > und aktuell < Kunden >“ (ebd., S. 14).
Unter den besonderen Bedingungen des Nationalsozialismus wurden die psychisch kranken Menschen als „ Minderwertige und Erbkranke “ (Buck, 1996) denunziert und zur Zwangssterilisation gezwungen. Mehr als 250.000 Menschen wurden während des zweiten Weltkrieges „Euthanasie-Opfer“ (Buck, 1999).
In der Psychopharmakotherapie spricht man von „ therapieresistenten Langzeitpatienten “ (Finzen, 2004, S. 114), auf psychiatrischen Langzeitstationen von „ ausbehandelten Menschen “ (Petry, 2003, S. 13) und in der Medizin gelten die chronisch psychisch Kranken im Vergleich mit den Akut-Kranken als die „ Unheilbaren “ (Dörner, 1998a, S. 12).
LAUPICHLER (2002) verwendet in einem Aufruf zu einer Heimenquête an den Deutschen Bundestag den Begriff „ Langzeit-Heimschicksale “. Als die „ Hoffnungslosen “ (Konrad & Jaeger, 2005, S. 17) werden die jahrzehntelang hospitalisierten psychisch kranken Menschen bezeichnet, die nicht mehr als integrierbar gelten.
In meiner Arbeit gibt es das Kapitel ‚Einordnung als ein „Bewohner“ des ÜWHs’ (4.4.), obwohl „[d]er Begriff ‚ Bewohner ’ [...] bei Strafe zu verbieten [ist]“ (Dörner, 2004, S. 24). Ich werde deutlich machen, dass ich ganz und gar nicht beabsichtige, Robert Krocker auf seine „Funktion des Wohnens zu reduzieren“ (ebd. S. 24), sondern anhand der Rekonstruktion seiner Wirklichkeit darstelle, wie er die einzelnen Begrifflichkeiten im Laufe seines Lebens durchlaufen hat.
2.2 Chronizität
Ich trage zu meiner und anderer Chronifizierung bei, wenn ich die Hoffnung auf Erleichterung, Besserung, Heilung, Erholung aufgebe und wenn ich eine Einstellung zu psychischen Erlebnissen habe, dass sich aus ihnen nichts lernen lässt. Ich chronifiziere leicht, wenn ich das Leiden der Patienten – oder mein eigenes – bekämpfe, es als unnütz betrachte.
(Plog, 2003, S. 43)
Nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (2004)[3] wird als schwerwiegend chronisch krank definiert, wer sich aufgrund seiner chronischen Krankheit wenigstens ein Jahr lang, mindestens einmal pro Quartal ärztlich behandeln lässt. Weiterhin liegt entweder eine Pflegebedürftigkeit der Pflegestufe 2 oder 3, oder ein Grad der Behinderung von mindestens 60, oder eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 Prozent vor, oder es ist eine kontinuierliche medizinische Versorgung erforderlich. Die Feststellung, dass ein Mensch an einer schwerwiegenden chronischen Krankheit leidet, wird durch die Krankenkassen getroffen.
In dem Wort <Chronizität> steckt das griechische <chronos> – die Zeit. GROTH (2004) argumentiert, dass der Zeitfaktor nicht nur in Bezug auf die Dauer einer Erkrankung von Bedeutung ist, sondern wie der Umgang mit der Zeit ganz bewusst eingesetzt werden kann, „um einen Chronifizierungsprozess eventuell entchronifizierend zu beeinflussen“ (ebd., S. 29).
Sue ESTROFF (1994) versteht unter Chronizität „the persistence in time of limitations and suffering and to the resulting disabilities as they are socially and culturally defined and lived“ (ebd., S. 250). Dieses Andauern von Behinderung und Leid und den daraus resultierenden Einschränkungen, die gesellschaftlich und kulturell definiert und gelebt werden, führt zu einer Verschmelzung von Identität mit Diagnose.
Schizophrenie gehört nach ESTROFF zu einer westlichen Kategorie von „enduring affliction“[4] (ebd., S. 256), die sie „I am illness“ (ebd., S. 253) bzw. „I am schizophrenic“ (ebd., S. 258) nennt. Dies entspricht einem symbolischen und soziokulturellen Prozess einer Transformation von Selbst und Identität. Chronizität und Behinderung werden durch das Andauern der selbst und von anderen wahrgenommenen Funktionsstörungen, durch den beständigen Kontakt mit den Mächtigen, die diagnostizieren und behandeln, durch die allmähliche aber energische Redefinition von Identität durch die Verwandtschaft und Freunde und durch das Begleiten des Verlustes an Rollen und Identitäten konstruiert.
ESTROFF argumentiert, dass therapeutische Wirksamkeit, zumindest in den Vereinigten Staaten, als Erwiderung auf die Menschen mit der Diagnose Schizophrenie in der Stabilisierung, Verschlimmerung und Beibehaltung von der kranken Rolle und dadurch der Krankheit resultiert.
CIOMPI (1980) äußert den Verdacht, dass die chronische Schizophrenie nicht zuletzt auch ein Artefakt unheilsamer Institutionen ist.
2.3 Enthospitalisierung
Ein heimtückischer Effekt langjähriger Hospitalisierung besteht gerade in der Identifikation mit der hospitalisierenden Institution. (Gromann-Richter, 1991, S. 41).[5]
In der Bundesrepublik Deutschland war die Enthospitalisierung durch die Psychiatrie-Enquête (1975) gekennzeichnet. Die Enthospitalisierung hatte das Ziel, chronisch psychisch kranke Menschen aus den Landeskliniken in ihren Heimatkreis zu entlassen, damit sie dort auf Dauer integriert leben können. Zunächst bedeutete die Enthospitalisierung, dass Krankenhausbetten abgebaut wurden und die Patienten das Krankenhaus verließen. Damit war nicht sicher gestellt, dass sie in ihrer Heimat wieder eingegliedert wurden. Nach HOFFMANN (2003) leitete die Enquête den Aufbau ambulanter und komplementärer Einrichtungen[6] ein, war jedoch erst in den 90er-Jahren von einer wirklich bedeutsamen Reduktion der Gesamtbettenzahl in den Kliniken gefolgt. Gerade in Berlin gab es zu Beginn der 90iger Jahre besonders viele psychiatrische Krankenhausbetten. Die Betten in so genannten Sonderkrankenhäusern[7] wurden teilweise in Pflegeheime umgewandelt.
Chronisch psychisch kranke Menschen wurden in den Kliniken über die Jahrzehnte hinweg zu Langzeitpatienten. Die Lebenssituation in einer Klinik ist anhand der Merkmale einer „totalen Institution“ (Goffman, 1973) zu charakterisieren. Hierzu gehören z. B. Fremdversorgung, Fremdbestimmung und völlige Abhängigkeit, bei gleichzeitiger Negation von Förderung. Von diesen Charakteristika, wie umfassende Kontrolle aller Lebensbereiche durch die Pfleger, keine Trennung der Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Freizeit, Unterbrechung des Klinikalltags lediglich durch Mahlzeiten und medizinische Versorgung, keine selbst gewählten Kontakte, sind die Menschen zum Teil über 20 Jahre geprägt. Aus dieser jahrzehntelangen Unterbringung (z. T. auf geschlossenen Stationen) resultieren zusätzlich noch besondere Verhaltensauffälligkeiten und starke Hospitalisierungsschäden.
Das Problem in Langzeitbereichen besteht offensichtlich darin, dass sich vor allem für die Patienten das Leben auf eine Art < vita minima > reduziert, dass sie im Durchschnitt schon nach ein bis zwei Jahren nur noch dort leben wollen und – ohne besondere Hilfe auch nur noch dort leben können. (Gromann-Richter, 1991, 72f)
Will man diesen gefügigen Patienten, der mit allem zufrieden scheint, nun wieder dazu ermutigen, Bedürfnisse zu erspüren und zu äußern, bedarf es der Überlegung, welche Fähigkeiten wiedererlangt werden können. Nach dem Enthospitalisierungskonzept (1982, zit. nach Gromann-Richter, 1991) geht es um das Wiedererwecken von Interesse am Mitgestalten des Tagesablaufes, am Teilnehmen am Leben innerhalb und außerhalb der Institution, am Wiederübernehmen von Verantwortung und damit am Wiedererfahren von Wert und Geltung. Dies soll helfen, auch ein Wiedererleben der Zeit, der eigenen Biographie und auch eine Ausweitung der eingegrenzten Umwelt zu ermöglichen.
DÖRNER (1998a) kommt nach der 15-jährigen De-Institutionalisierung[8] von 435 psychiatrischen Langzeitpatienten aus der Klinik Gütersloh zu der Schlussfolgerung, „dass kein chronisch psychisch Kranker dauerhaft in einer Institution (Klinik oder Heim) leben muss und darf“ (ebd. S. 8). Als eine wichtige Voraussetzung für eine wirksame De-Institutionalisierung wurde der Paradigmenwechsel erkannt, der in einer Professionalität besteht, die die chronisch psychisch Kranken zu den Lehrmeistern macht. Neben einigen erfolgreichen De-Institutionalisierungen (Dörner, 1998a; Werner, 1998; Gromann-Richter, 1991; Kruckenberg, 1995) schlug die sonstige Enthospitalisierung größtenteils in eine Re-Institutionalisierung um. Nach einer Umfrage der DGSP[9] (Zechert, 1996) sind in den Jahren 1992 bis 1995 ca. 2500 Langzeitpatienten aus 6 Bundesländern (alt und neu) enthospitalisiert worden. Davon wurden allerdings 75 Prozent in Heimen untergebracht. Auch DÖRNER (1998a) geht davon aus, dass „überwiegend (70 bis 80 %) nur in das dadurch entstehende System von Heimen für psychisch Kranke umhospitalisiert“ (ebd. S. 12) wurden.
Nach der Auflösung der Langzeitabteilungen in den psychiatrischen Krankenhäusern und der Enthospitalisierung psychisch kranker Menschen in Berlin liegen bisher keine genauen Angaben über deren Verbleib vor. 42 Prozent der Langzeitpatienten aus der in der Berliner Enthospitalisierungsstudie untersuchten Kohorte wurden in vollstationäre Einrichtungen entlassen (Kaiser, Isermann, Hoffmann & Priebe, 1998). Es hat somit fast unbemerkt und kritiklos eine gewaltige Verschiebung psychisch erkrankter Menschen aus den psychiatrischen Kliniken in Heime stattgefunden (Schulze Steinmann, Heimler, 2003). Aus den Heimen müssen die Menschen ein zweites Mal enthospitalisiert werden.
2.4 Alternative Ansätze im Umgang mit chronisch psychisch kranken Menschen
Ich habe gemerkt, dass der Alltag und <das Normale> ganz schön verrückt sind, und wir fallen gar nicht weiter darin auf!
(Laupichler, 2003, S. 246)
Unser Menschenbild ist von Bedeutung für das Verständnis von und die Umgangsweise mit chronisch psychisch kranken Menschen, weil es unser Handeln prägt. In dieses Menschen- und Gesellschaftsbild gehören alle Menschen integriert, „am dringlichsten die randständigsten“ (Dörner, 1998b, S. 70). Im Folgenden sollen alternativen Wohnformen und Behandlungsansätze nur kurz beschrieben werden.
2.4.1 Alternative Wohnformen
Trotz des Ausbaus ambulanter und teilstationärer Wohnformen, wie ambulantes Einzelwohnen, Appartementwohnen, therapeutisch betreute Wohngemeinschaften, psychiatrische Familienpflege, Tagesstätten etc. ist es nicht gelungen, die Zunahme stationärer Unterbringungen zu stoppen. Dennoch gibt es diese Angebote und einige überzeugte Verfechter, die für den weiteren Ausbau der ambulanten Betreuungsformen kämpfen (Siemen, 2002; Schulze-Steinmann & Heimler & Claassen & Cordshagen, 2003).
Der gemeindepsychiatrische Träger Brücke Schleswig-Holstein hat in Zusammenarbeit mit Betroffenen, Mitarbeitern sowie Führungskräften Wohnverbünde entwickelt. Dieses Verbundsystem stellt die ambulante, teilstationäre und stationäre Wohnform zur Verfügung. Unter den Motti „Zentral so eigenständig wie möglich wohnen“ und „Vernetzte und individuell ausgestattete Hilfen“ (Cordshagen, 2003, S. 160) bestehen z. B. die vollstationären Wohneinheiten aus Einzelappartements und Wohngemeinschaften.
2.4.2 Alternative Behandlungsansätze
Der in Skandinavien entwickelte integrative Ansatz zur Komplexbehandlung von Psychosen, das Need-adapted Treatment (Aderhold & Greve, 2004) basiert auf psychodynamischen, systemischen und sozial-konstruktivistischen Verstehensansätzen. Dabei greifen Krisenintervention, psychotherapeutische wie pharmakotherapeutische Elemente, sowie ambulante, komplementäre, teil- und vollstationäre Behandlungs- und Rehabilitationsmöglichkeiten ineinander. Dieses Modell zur bedürfnisangepassten Behandlung von Menschen mit schizophrenen Psychosen ist derzeit in Deutschland lediglich in einigen Elementen verwirklicht.
Eine weitere Alternative bietet das Home Treatment, das in Anlehnung an das Soteria-Modell (Aebi & Ciompi & Hansen, 1993) ein heilsames Milieu herstellt (Aderhold, 2004). Die hierfür wichtigen handlungsleitenden Grundprinzipien sind „Beziehungskontinuität, größtmögliche Normalisierung, größtmöglicher Einbezug des sozialen Kontextes (z. B. Familie) und größtmögliche Nutzung eigener Ressourcen (Empowerment/Salutogenese)“ (ebd., S. 305).
Letztlich soll noch ein primäres Wirkprinzip der Psychotherapie, die Ressourcenaktivierung, (Grawe & Grawe-Gerber, 1999) Erwähnung finden. Dieses Ressourcenkonzept in Anlehnung an familientherapeutische, hypnotherapeutische und lösungsorientierte Ansätze „entspricht mehr einer therapeutischen Haltung als einer therapeutischen Technik“ (ebd., S. 63).
2.5 Heimforschung
Heime leben von der Heimlichkeit, niemand schaut hin,
niemand weiß eigentlich, was dort geschieht.
(Dörner, 2002, S. 65)
Zum Einstieg in die Thematik und zur Herstellung des Zugangs zu einem Heim haben wir im Rahmen des Diplomarbeitscolloquiums eine Reihe von Heimbesichtigungen in Berlin durchgeführt. Hierunter waren Krankenheime, Alten- und Pflegeheime für psychisch kranke Menschen und ein Übergangswohnheim. Im weiteren Verlauf werde ich zunächst auf die Heimforschung im Allgemeinen, die Kritik an Heimen, die soziale Exklusion psychisch kranker Menschen, die Unterscheidung zwischen Pflegeheim und ÜWH und letztlich auf die Studien zur Lebensqualität eingehen.
In Deutschland werden die meisten hilfebedürftigen Menschen von ihren Angehörigen im privaten Haushalt versorgt. Dennoch leben 800.000 Menschen in Heimen, das entspricht einem Prozent der Bevölkerung. Über 50 Prozent sind psychisch krank und leben in Alten- und Pflegeheimen. Eine weitere Gruppe bestehend aus Menschen mit einer psychischen Erkrankung/Behinderung, lebt überwiegend in Heimen der Behindertenhilfe (Hopfmüller, 2003; Dörner, 2002).
Aufgrund des demographischen Wandels[10] wächst die Zahl der hilfebedürftigen Menschen bei gleichzeitiger Abnahme der verfügbaren Finanzmittel. Somit wird die Anzahl der Heimplätze in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Auch das Risiko für psychisch kranke Menschen, über längere Zeit im Heim untergebracht zu werden, wird ansteigen, zumal wenn die Betroffenen chronisch krank sind und noch mehr, wenn eine Doppeldiagnose gestellt wurde.
Die durch die Psychiatriereform in den 70iger Jahren angestrebte Verkleinerung von Bezirks- und Landeskrankenhäusern und deren Umwandlung in auf die akute Versorgung konzentrierte psychiatrische Klinik konnte nur gelingen, weil eine große Anzahl der chronisch psychisch kranken Menschen in gesonderte Heime verlegt wurde. Trotz des bereits 1961 im BSHG §3a festgeschriebenen Prinzips <ambulant vor stationär> werden „etwa 95 Prozent der Mittel der Eingliederungshilfe im stationären Bereich ausgegeben und etwa fünf Prozent fließen in ambulante Hilfen“ (Höpfmüller, 2003, S. 15f). Es besteht offensichtlich ein <Diktat der Ökonomie>, wenn die Entlassung in die häusliche Umgebung in den Qualitätssicherungskatalogen der Heime nicht vorkommt. Es stellt sich die Frage, warum ein Heim sich aufgrund einer „Entlassungsförderung seiner besten Bewohner selbst schädigen“ (Dörner, Röttger-Liepmann, Hopfmüller, 2001, S. 8) sollte. Hinzu kommt die <Macht der Immobilie> und zweckgebundene Investitionsmittel. Somit schließt sich die vom Gesetzgeber geforderte Beachtung der Persönlichkeitsrechte von Heimbewohnern und die Ökonomisierung des Hilfs- und Pflegemarktes aus.
Viele psychisch kranke Menschen, die im Heim leben, kommen direkt aus den Ursprungsfamilien und haben mehrere länger andauernde Klinikaufenthalte hinter sich. Es kam bei vielen gar nicht dazu, dass sie ein eigenständiges Wohnen ausprobieren konnten. Eine Befragung des Dachverbandes „Wie Heimbewohner leben wollen“, in der 110 Heimbewohner in fünf Bundesländern befragt wurden, hat ergeben, dass 60 Prozent nicht in einer Institution, sondern privat wohnen wollen (Zechert, 2003). Die meisten Heimbewohner leben „[t]rotz formal-rechtlicher Freiwilligkeit“ (Dörner, Röttger-Liepmann, Hopfmüller, 2001, S. 5) unfreiwillig im Heim, da sie ungenügend über vorhandene Alternativen informiert sind. Dass Betroffene, die lange im Heim wohnen, oft eine große Angst verspüren, wenn sie mit dem Auszug aus dem Heim konfrontiert werden, hängt u.a. damit zusammen, dass Wohnen eine materielle Lebensbedingung ist und „in seiner elementaren Daseinsqualität etwas [ist], was identitätsstiftend ist, und was Zugehörigkeit vermittelt“ (Keupp, 2002, S. 20).
2.5.1 Heimkritik
HOPFMÜLLER (2003) argumentiert, dass es nicht üblich ist, im Heim ein Einzelzimmer zu haben, sondern häufiger teilt man sich ein Zimmer mit einem oder mehreren fremden Menschen. Obwohl 67,3 Prozent der Heimbewohner sich ein eigenes Bad mit Toilette wünschen, haben es nur 8,2 Prozent (vgl. Zechert, 2002). Durch das geballte Zusammentreffen von Menschen, die Probleme haben, entsteht unnötig zusätzliches Konfliktpotential. Man bekommt vom Heim keinen Mietvertrag, sondern muss sich „an die Regeln im Gastgeberhaus halten“ (ebd. S. 15). Man wird angehalten, die Aufsteh-, Essens- und Ruhezeiten zu berücksichtigen. Wer die Regeln des Hauses, wie z. B. Alkohol- und Drogenverbot oder gewisse Hygienestandards, nicht beachtet, muss mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Hilfe kann sehr schnell in Entmündigung, Bevormundung, in Abhängigmachen und in Dominanz der eigenen Interessen des Helfenden umschlagen. Die Probleme der Betroffenen werden hauptsächlich mit Medikamenten angegangen, eine Heran- bzw. Weiterführung an Psychotherapie unterbleibt weitestgehend. Weiterhin ist die Unterbringung zeitlich nicht befristet, sondern entspricht einem „lebenslängliche[n] open end“ (Dörner, Röttger-Liepmann, Hopfmüller, 2001, S. 6).
SCHNEEKLOTH und MÜLLER (1997, zit. nach Dörner, Röttger-Liepmann, Hopfmüller, 2001) weisen empirisch nach, dass Heimbewohner zu 60 Prozent ausschließlich auf Kontakte innerhalb der Institution angewiesen sind, was die Chronifizierung psychischer Erkrankungen fördert. Weiterhin komme es dazu, dass Heimbewohner oft passive Verhaltensweisen entwickeln, um sich aus Angst vor negativen Konsequenzen den Bedingungen der Institution anzupassen. Es besteht kaum Möglichkeit zur Integration und zur individuellen Lebensgestaltung, dieser Umstand entspricht eher der von GOFFMAN (1973) beschriebenen Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. Das führt mit unter dazu, dass die Menschen in Großheimen gettoisiert und isoliert werden. Problemschwerpunkt der personenbezogenen Bedenken gegenüber dem Heim ist die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte bzw. der Grundrechte des Menschen.
Nach HÖLZKE (2003) ist die nicht vorhandene Trennung von Wohnen und Hilfe die „Hauptnebenwirkung eines Heimes“ (ebd., S. 140). Wer die Hilfsangebote eines Heimes nicht mehr nutzen möchte, muss das spezielle Wohnsetting und damit die Sicherheit und den Schutz aufgeben. Der Autor plädiert für eine Entkoppelung von Betreuungs- und Mietvertrag.
Eine Umfrage bei schizophrenen Patienten von Angermeyer et al. (1999) hat ergeben, dass die Betroffenen am meisten die Arbeit, die sozialen Kontakte und intimen Beziehungen vermissen.
2.5.2 Soziale Exklusion psychisch kranker Menschen
Es gibt ein neues Konzept zur Erfassung und Beschreibung der Lebenssituation von psychisch kranken Menschen. Unter sozialer Exklusion verstehen EIKELMANN et al. (2005) den Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt, dem Wohnungsmarkt und/oder aus der familiären Einbindung. Der Fokus dieses Konzeptes liegt nicht mehr auf den Defiziten oder Symptomen, sondern auf der „Teilhabe am sozialen Leben und [am] Gesamt der psychisch Kranken“ (ebd., S. 1104).
Die Alternative zur Beschäftigung für chronisch psychisch kranke Menschen liegt in den Angeboten des beschützenden psychiatrischen Arbeitsmarktes, die zumeist aufgrund der geringen Bezahlung und dem ungeklärten arbeitsrechtlichen Status als Stigma erlebt werden.
Einem Bericht mit dem Titel „Mental Health and Social Exclusion“ (zitiert nach Eikelmann et al., 2005) zufolge wurde festgestellt, dass 40 Prozent der Betroffenen[11] ausschließlich Kontakt zu Mitpatienten und Betreuern haben und 80 Prozent sich isoliert fühlen.
2.5.3 Spezialfall Übergangswohnheim
Im Weiteren möchte ich den Unterschied von Pflegeheimen und Übergangswohnheimen herausarbeiten (siehe auch Kapitel 4.1.1).
BRILL (1998) beleuchtet in seinem Artikel „Ein Bett ist keine Wohnung“ den historischen Verlauf eines ÜWHs: In den 70iger Jahren wurden die ÜWHs als eine Verbesserung des Hilfeangebotes angesehen, weil sich die Entwicklung der ambulanten gemeindepsychiatrischen Versorgung noch in den Anfängen befand. Finanziert wurden die ÜWHs als stationäre Einrichtungen durch die überörtlichen Sozialhilfeträger. Erst 1987 wurde ein ÜWH modellhaft als eine Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke Menschen erprobt und in der Folge erfolgreich abgeschlossen. Ein ÜWH wurde somit um ein medizinisch-psychotherapeutisches Angebot erweitert.
Aktuell ist die gesetzliche Grundlage das Heimgesetz[12], in dessen Geltungsbereich seit 01.01.2002 auch ÜWHs fallen. Im Gegensatz zu einer Pflegeeinrichtung oder einer Einrichtung der Behindertenhilfe, die nach SGB[13] XI durch die Leistungen der Pflegeversicherung finanziert wird, greift seit 01.01.05 für ein ÜWH das SGB XII §53/54[14] (zuvor BSHG[15] § 39/40). Es werden nicht wie bei der Pflegeleistung durch den MDK[16] die Einstufungen der Pflegestufen vorgenommen, sondern die Leistungen der Eingliederungshilfe alle zwei Jahre vom SpD[17] geprüft. Dieser gibt dann eine entsprechende Stellungnahme an das Sozialamt, ob der Betroffene weiter finanziert wird oder nicht. Somit liegt der wesentliche Unterschied in den Leistungen der Institutionen. Nach SGB XI steht die Pflege der Betroffenen im Vordergrund, während nach SGB XII eine vorübergehende Eingliederungshilfe geleistet wird.
Speziell an meiner Wahl des ÜWH ist, dass hier auch Menschen leben, die im Rahmen des Enthospitalisierungskonzeptes eine langfristige Wohnform gefunden haben. Sie unterliegen zwar der Eingliederungshilfe, können aber abgesehen von den zweijährlichen Anträgen auf Kostenübernahme beim SpD lebenslang dort wohnen (siehe auch Kapitel 3.3.1).
2.5.4 Studien zur Lebensqualität
Subjective quality of life represents the result of an ongoing
process of adaptation, during which the individual must
continuously reconcile his own desires and goals with the conditions of his environment and his ability to meet the social demands associate with the fulfilment of these desires and goals.[18]
(Angermeyer & Kilian, 1997, S. 23)
Nach KATSCHNIG (2000) scheint es bevorzugt bei Menschen mit der Diagnose Schizophrenie einen Mechanismus zu geben, die eigenen Erwartungen zu reduzieren, um mehr Selbstbewusstsein und subjektives Wohlbefinden zu erfahren. Ein Gefühl von persönlicher Kontrolle und Ermächtigung führt zu einer Verbesserung der Lebensqualität, während ein wahrgenommenes Stigma mit einer geringeren Lebensqualität einhergeht. Stigmatisierung führt notgedrungen zur Exklusion aus dem sozialen Leben (siehe auch Kapitel 2.5.2). Betroffene sind demnach vor die Wahl gestellt, entweder das Stigma zu akzeptieren und sich mit der Rolle des psychiatrisch Erkrankten zu identifizieren, was sie dazu befugt, professionelle Unterstützung (medizinische Versorgung, therapeutische Behandlung und ggf. Unterbringung) zu erlangen. Oder sie weigern sich, diese Rolle anzunehmen, um ihre Autonomie zu wahren, geben dabei aber ihr Recht auf organisierte Hilfe auf. Welche Strategie auch immer sie wählen, es bleibt am Ende ein irritierender und kraftzehrender Prozess, der die Chance für sie weiter reduziert, eine adäquate Lebensqualität zu erreichen. Letztendlich weist der Autor darauf hin, dass die Lebensqualität eines Menschen nicht nur vom subjektiven Wohlbefinden abhängig ist, sondern auch von dem <Funktionieren> in verschiedenen Lebensbereichen und der Fähigkeit, auf Ressourcen und Gelegenheiten zurückzugreifen.
CORIN (1997) hat unterschiedliche Weisen verglichen, wie chronisch psychisch kranke Menschen sich selbst in Bezug auf ihre Besonderheit verstehen. Demnach haben jene, die Heilung und ein Leben mit Arbeit und Familie anstreben, höhere Rückfallraten als die, die sich mit ihrem Besonderssein arrangiert haben.
In einer Studie von KILIAN & MATSCHINGER & ANGERMEYER (2001) wurde gefunden, dass Schizophrenie eine bedeutsame negative Wirkung auf physische Gesundheit, psychologisches Wohlbefinden, soziale Beziehungen, Umgebung und auf die allgemeine Lebensqualität hat. Betroffene stufen ihre Lebensqualität im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung als bedeutend geringer ein. Die Autoren vermuten, dass die wahrgenommene Wirkung zu einem großen Grad in ihren schlechten Lebensbedingungen besonders im Bereich der finanziellen Ressourcen und der Unterbringungsbedingungen resultiert. Somit ist eine Reduktion der negativen Wirkung chronischer Krankheit auf die Lebensqualität durch medizinische oder psychosoziale Dienste allein nicht möglich.
In der Studie „Quality of life in schizophrenia“ haben GEE & PEARCE & JACKSON (2003) herausgearbeitet, dass die Betroffenen in interpersonalen Beziehungen vor folgende Barrieren gestellt werden: Sie fühlen sich alleine und isoliert, werden von Freunden und Familienangehörigen aufgrund ihrer Erkrankung gemieden. Die Erwerbsunfähigkeit verstärkt das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Die schlechte finanzielle Situation verhindert die Möglichkeit zu reisen oder zu wählen, wo man wohnen und leben möchte.
2.6 Detlef Petry: Die Wanderung. Eine trialogischeBiographie über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren
Ich suche keinen professionellen Helfer, ich suche einen Bundesgenossen.[19]
Wenn du offen und ehrlich bist, kann ich lernen dir zu vertrauen.
Wenn du mich respektierst als Experte in meinem eigenen Körper
und Leben, kannst du mit meiner aktiven Mitarbeit rechnen.
Wenn du mir genügend Raum gibst, treffe ich meine eigene Wahl.
Wenn du nicht meine Grenzen überschreitest,
lerne ich diese vielleicht auch zu respektieren.
Wenn ich die Kontrolle verloren habe, hilfst du mir suchen.
Wenn du mir vertraust, dann baue ich Selbstvertrauen auf.
Wenn du nicht zu streng bist mit meinen Fehlern, tue ich das auch nicht.
Wenn du deine Grenzen deutlich zeigst, kann ich lernen, diese zu respektieren.
Wenn ich dich nötig habe, weiß ich, wie ich dich finden kann.
Und wenn ich nichts mehr zu tun haben will mit der ganzen Welt,
dann mache ich für dich eine Ausnahme!
(Marlieke de Jonge, ehemalige Patientin, zitiert nach Petry, 2003, S. 74)
Detlef PETRY (2003) ist Psychiater und war seit 1978 in Maastricht in den Niederlanden in der Rehabilitation von psychiatrischen Langzeitpatienten tätig. 1980 lernte er dort Bert Boers, einen Betroffenen auf der Langzeitstation, kennen und begab sich mit ihm und seiner Familie auf eine 20ig jährige <trialogische Wanderung>. 2003 veröffentlicht er diese trialogische Biographie, in der nicht nur die persönliche Geschichte von Bert Boers und seiner Großfamilie erzählt wird, sondern PETRY stellt seine eigene Geschichte als Psychiater daneben.
Ausgehend von seinem Wissen um die menschenunwürdige Verwahrung von chronisch psychisch kranken Menschen träumt PETRY davon, „dass die chronischen Patienten wieder vollkommen gleichwertige Menschen werden und dass ihre Lebensgeschichten wichtiger werden mögen als ihre Krankengeschichten“ (ebd., S. 24). Professionelle Helfer benötigen seines Erachtens anstelle einer eingeschränkten Sichtweise auf das psychopathologische Bild eine „breite Haltung“ (ebd., S. 100). Mit dieser Haltung wird der Patient zum Mit-Menschen „mit einer Vergangenheit, einer Familie, Freunden, mit Sehnsüchten, Werten und Wünschen – und mit einer Zukunft“ (ebd., S. 100). Eine Stigmatisierung wird somit aufgehoben. Mit mehr Respekt, mehr persönlichen Gesprächen und durch das Einbeziehen der Familie und des Umfeldes entsteht erst ein Trialog.
PETRY spricht von „Rehistorisierung“ (ebd., S. 121) und meint damit die Rekonstruktion einer vergessenen oder nur fragmentarisch vorhandenen Lebensgeschichte. Für diese lange Begleitung der Betroffenen benötigt man neben Empathie und Ausdauer vor allem Geduld. Nach PETRY muss ein professioneller Helfer zum „Spezialisten der Geduld“ (ebd., S. 147) werden, da er Rehabilitation als ein Wechselspiel von <Fallen und Aufstehen> versteht. Letztendlich entsteht eine aktive Gemeinschaft über viele Jahre, man führt nicht nur zahlreiche Gespräche in natürlichen Situationen, sondern nimmt Teil am täglichen Leben. Hierzu gehört, dass der professionelle Helfer – auch Lebensbegleiter von PETRY genannt – bei der Begleitung im übertragenen Sinne das eine Mal mit der Hand bis in den Himmel greift und ein anderes Mal im Staub wühlt.
Durch dieses langsame Zurückgehen in die Vergangenheit entstehe ein Abbild eines individuellen Lebens. Daraus hervor gehen neue Beziehungen und ein neuer Entwurf für das Zusammenleben. PETRY regt an, neu über Chronizität nachzudenken (siehe auch Kapitel 2.2).
Dieses trialogische Erarbeiten einer Biographie eines chronisch psychisch kranken Menschen ist bisher in der Forschung meinem Wissen nach einmalig. Die damit einhergehende Darstellung der Sichtweise von Betroffenen wird neben PETRY (2003) auch von RIEMANN (1987) aufgezeigt.
3 Methodisches Vorgehen
Im folgenden Kapitel begründe ich meine Wahl des Forschungsansatzes, erläutere den Einstieg ins Feld und stelle meine Entscheidungsfindung dar. Anschließend werde ich auf die Auswahl und Beschreibung der qualitativen Methoden der Datenerhebung und der Auswertungsmethode für meine Arbeit eingehen.
[...]
[1] Aus Anonymisierungsgründen ist im Folgenden der Name des Betroffenen in einen von ihm selbst gewählten abgeändert.
[2] Im Folgenden: ÜWH
[3] Quelle: http://www.uwendler.de/vsb/gesetz/chrkankeril.htm [letzter Zugriff: 23.09.2005]
[4] anhaltendem Befallensein [Übersetzung der Autorin]
[5] Enthospitalisierung bedeutet die Wiederherstellung normalisierter Lebensumstände für Menschen mit Behinderungen nach langdauerndem Aufenthalt in Psychiatrischen Krankenhäusern.
[6] komplementäre Einrichtungen: ergänzend zum stationären oder ambulanten Bereich, z. B. gemeindepsychiatrische Einrichtungen wie Tagesstätten oder therapeutische Wohngemeinschaften, in denen die Menschen betreut aber nicht medizinisch behandelt werden.
[7] „Sonderkrankenhäuser waren Einrichtungen, die nicht im Krankenhausplan enthalten waren und in denen chronisch psychisch Kranke betreut wurden. Sie ähnelten Krankenheimen, verfügten aber im Unterschied zu diesen über einen besseren Personalschlüssel und über therapeutisches Personal (Ärzte, Psychologen)“ (Hoffmann, 2003, S. 28).
[8] „Kurz: ‚Enthospitalisierung’ bedeutet (selbst wenn gut gemeint) Abwendung von, ‚De-Institutionalisierung’ Zuwendung zu den Bedürfnissen der chronisch psychisch Kranken.“ (Dörner, 1998, S. 111).
[9] Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V.
[10] Der Anstieg der Lebenserwartung der Menschen bis zum Jahr 2050 um mindestens vier Jahre (Frauen 81 / Männer 75 Lebensjahre) bei rückläufigen Geburtenraten führt zu einer zunehmenden Alterung der Bevölkerung in Deutschland.
[11] In diesem Fall: Erwachsene mit psychischen Störungen in Großbritannien, die mit gemeindepsychiatrischen Institutionen in Kontakt stehen.
[12] Heimgesetz laut Bundesgesetzblatt G 5702 vom 09.11.2001
[13] Sozialgesetzbuch
[14] Quelle: http://www.bmgs.bund.de/download/gesetze_web/sgb12/sgb12xinhalt.htm
[15] Bundessozialhilfegesetz
[16] Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
[17] Sozialpsychiatrischer Dienst
[18] „Subjektive Lebensqualität stellt das Ergebnis eines andauernden Prozesses der Anpassung dar, während dessen die Person ihre eigenen Begierden und Ziele stetig mit den Bedingungen ihrer Umgebung und ihrer Fähigkeit, den sozialen Anforderungen, verbunden mit der Erfüllung dieser Begierden und Ziele, gerecht zu werden, vereinbaren muss.“ [Übersetzung der Autorin]
[19] Trialog: partizipatives Denken und Handeln dreier Hauptgruppen (Psychose-Erfahrene, Angehörige und professionellen Mitarbeiter) im (sozial)psychiatrischen Entwicklungsprozess, die im Idealfall gleichberechtigte Partner sind.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Psychologin Heike Ronowski (Autor:in), 2005, Wenn ich mit meiner Krankheit noch was bewirken kann - Biographische Einzelfallanalyse eines Mannes, der in einem Heim für chronisch psychisch kranke Menschen in Berlin lebt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64821
Kostenlos Autor werden





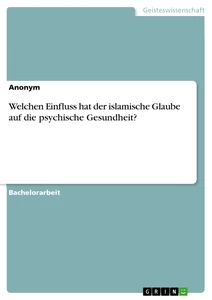


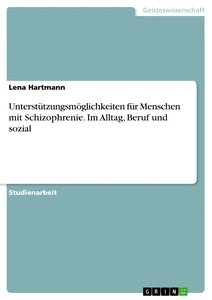




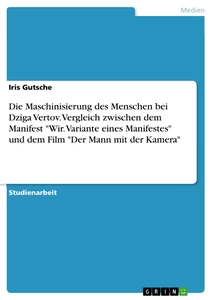




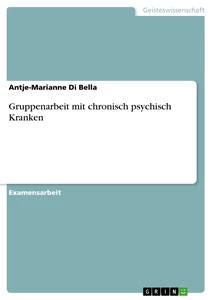



Kommentare