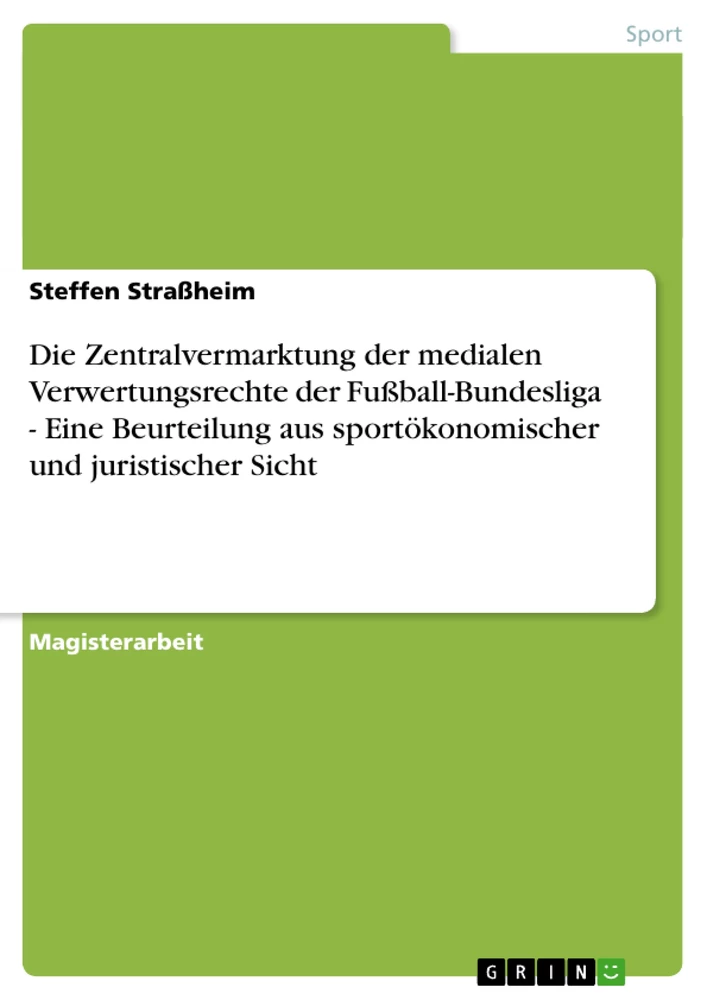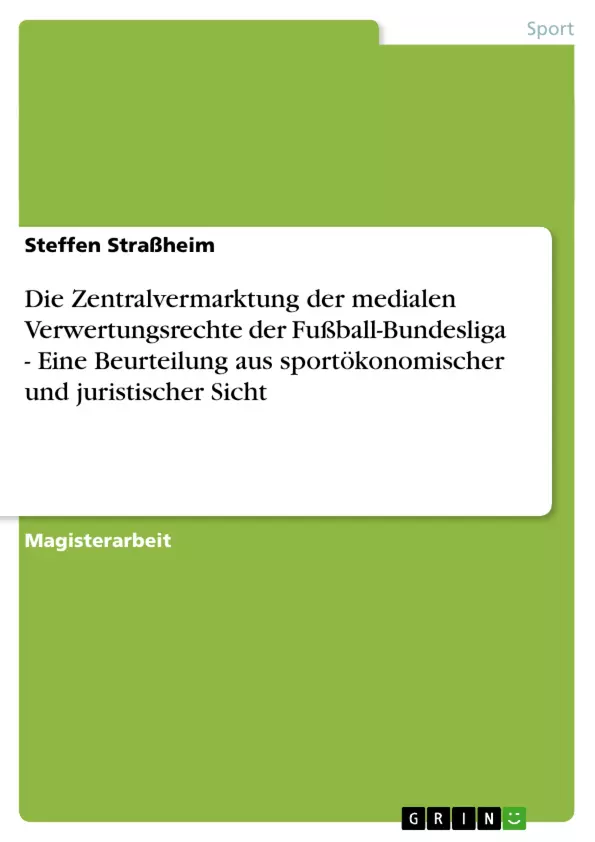Einleitung
Die Fußball-Bundesliga ist ein Phänomen, das in Deutschland eine herausragende Popularität genießt und einen festen Platz in der Gesellschaft einnimmt. In der gerade abgelaufenen Saison 2004/05 pilgerten in der 1. Bundesliga regelmäßig mehr als 300.000 Menschen pro Spieltag in die vielerorts neugebauten bzw. runderneuerten Fußball-Arenen. Durchschnittlich feuerten pro Spiel über 35.000 Zuschauer ihre Mannschaft an.1 Mit diesem Zuschauerschnitt nimmt die Fußball-Bundesliga die europäische Spitzenposition ein - überbietet gar die durchschnittlichen Besucherzahlen pro Spieltag der spanischen „Primera Division“ und der englischen „FA Premiership“. 2 Samstagabends schauten durchschnittlich sechs Millionen Zuschauer die Zusammenfassung der Spiele vom Nachmittag in der ARD-Sportschau. Und auch die 2. Bundesliga hat in den letzten Jahren vor allem durch die Berichterstattung im Deutschen Sport Fernsehen (DSF) eine Aufwertung erfahren. 3 „König Fußball“ steht zweifelsfrei im Mittelpunkt des Sportinteresses in Deutschland und ist zu einem der wichtigsten Bereiche der Unterhaltungsindustrie geworden, was sich auch mit wirtschaftlichen Zahlen eindrucksvoll belegen lässt. Der Verkauf der Fernsehrechte, die erweiterten Möglichkeiten im Sponsoring und die Forcierung des Merchandisings haben in der 1. und 2. Bundesliga eine Umsatzentwicklung von umgerechnet 185 Millionen Euro in der Saison 1989/90 auf knapp 1,3 Milliarden Euro in der Saison 2003/04 gebracht.4
Doch es gibt auch negative Schlagzeilen über die beiden Fußball-Lizenzligen. Einige Klubverantwortliche mussten bitter erfahren, dass ein gesteigerter Umsatz nicht automatisch eine Verbesserung der finanziellen Situation mit sich bringt. So beliefen sich die aufsummierten Verbindlichkeiten der 36 Bundesliga-Vereine für die Saison 2003/04 auf knapp 700 Millionen Euro.5 Um wieder ins finanzielle Gleichgewicht zu kommen, sparen die Vereine auf der Ausgabenseite in erster Linie im Bereich der Spielergehälter.6 Außerdem verlangen die 36 Bundesliga-Klubs eine deutliche Erhöhung der derzeitigen Einnahmen aus der von der Deutschen Fußball-Liga GmbH (DFL) zentral vermarkteten Fernsehrechte. Daran knüpft diese Arbeit an, deren Problemstellung und Aufbau nachfolgend erläutert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte an der Fußball-Bundesliga
- 1.1 Die Deutsche Fußball-Liga GmbH als Zentralvermarkter
- 1.2 Einschränkung der Zentralvermarktung durch Vermarktungsmodell seit dem 1. Juli 2004
- 1.3 Alternative Vermarktungsformen der medialen Verwertungsrechte
- 2. Bedeutung der medialen Verwertungsrechte für die wirtschaftliche Situation der Vereine der 1. und 2. Bundesliga
- 2.1 Beschreibung der wirtschaftlichen Situation
- 2.2 TV-Verwertungsrechte
- 2.2.1 Begrifflichkeiten
- 2.2.2 Entwicklung der Preise der Bundesliga-TV-Verwertungsrechte
- 2.2.3 Ausblick auf die Vertragsverhandlungen der TV-Verwertungsrechte ab 2006/07
- 2.2.4 TV-Geld-Verteilerschlüssel
- 2.3 Wirtschaftliches Potential des neuen Vermarktungsmodells – empirische Untersuchung
- 2.3.1 Untersuchungsgegenstand und Aufbau des Fragebogens
- 2.3.2 Auswertung des Fragebogens
- 2.3.2.1 Auswertung Verwertungsrecht 1 (Free-TV)
- 2.3.2.2 Auswertung Verwertungsrecht 2 (Internet)
- 2.3.3 Erläuterung der Vereine
- 2.3.4 Interpretation der Ergebnisse
- 2.4 Weitere Einnahmequellen
- 2.4.1 Sponsoring
- 2.4.1.1 Trikot-Sponsoring
- 2.4.1.2 Namens-Sponsoring
- 2.4.2 Merchandising
- 2.4.3 Spieltag
- 3. Beurteilung der Zentralvermarktung aus wirtschaftlicher Perspektive
- 3.1 Spannender Wettkampf als Voraussetzung für ein hohes Vermarktungspotential
- 3.2 Zentralvermarktung sorgt durch den TV-Verteilerschlüssel Spannung
- 3.3 Weitere Gründe für die Zentralvermarktung
- 4. Vereinbarkeit der Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte mit dem geltenden Recht
- 4.1 Vereinbarkeit der Zentralvermarktung mit Art. 81 EGV
- 4.1.1 Der Lizenzvertrag zwischen Ligaverband und Verein als Vereinbarung im Sinne des Art. 81 EGV
- 4.1.2 Ligaverband und Vereine als Unternehmen im Sinne des Art. 81 EGV
- 4.1.3 Prüfung des Vorliegens einer Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Art. 81 EGV
- 4.1.3.1 Art. 81 I lit. a EGV
- 4.1.3.2 Gesamtumstände
- 4.1.4 Ergebnis
- 4.2 Vereinbarkeit der Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte mit deutschem Recht
- 4.2.1 Wirksamkeit der Lizenzverträge zwischen Ligaverband und den Vereinen
- 4.2.1.1 § 138 II BGB
- 4.2.1.2 § 138 I BGB
- 4.2.2 Vereinbarkeit der Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte mit deutschem Kartellrecht
- 4.2.3 Vereinbarkeit der Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte mit den Grundrechten
- 5. Zusammenfassung
- Die Organisation der Zentralvermarktung durch die DFL und das Zusammenspiel mit DFB und Ligaverband
- Die Auswirkungen der Zentralvermarktung auf die wirtschaftliche Situation der Bundesliga-Vereine, insbesondere die Einnahmequellen und deren Entwicklung
- Die Bedeutung der TV-Verwertungsrechte, das Verteilerschlüssel-System und das wirtschaftliche Potenzial der neuen Vermarktungsmodelle
- Die Vereinbarkeit der Zentralvermarktung mit dem europäischen und deutschen Recht, insbesondere im Hinblick auf Kartellrecht und Grundrechte
- Eine kritische Beurteilung der Zentralvermarktung aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht
- **Einleitung:** Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Zentralvermarktung im deutschen Fußball vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesliga-Vereine dar und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- **Kapitel 1:** Dieses Kapitel erläutert die organisatorische Struktur der Zentralvermarktung, insbesondere die Rolle der DFL und die neuen Vermarktungsmodelle, die den Vereinen individuelle Verwertungsrechte einräumen. Außerdem werden alternative Vermarktungsformen vorgestellt.
- **Kapitel 2:** Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der medialen Verwertungsrechte für die wirtschaftliche Situation der Bundesliga-Vereine. Es beleuchtet den Umsatz und die Verbindlichkeiten der Vereine, die wichtigsten Einnahmequellen und insbesondere die Einnahmen aus den TV-Verwertungsrechten. Des Weiteren werden die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung vorgestellt, die das Vermarktungspotenzial der neuen Verwertungsmodelle im Bereich Free-TV und Internet untersucht.
- **Kapitel 3:** In diesem Kapitel wird die Zentralvermarktung aus wirtschaftlicher Perspektive beurteilt. Es werden Argumente für und gegen die Zentralvermarktung sowie deren Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Spannung in der Bundesliga diskutiert.
- **Kapitel 4:** Dieses Kapitel untersucht die rechtliche Vereinbarkeit der Zentralvermarktung mit europäischem und deutschem Recht. Es werden die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Argumente für und gegen die rechtliche Zulässigkeit der Zentralvermarktung dargestellt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte an der Fußball-Bundesliga aus sportökonomischer und juristischer Perspektive. Dabei wird die aktuelle Situation unter Berücksichtigung der neuen Vermarktungsmodelle ab dem Jahr 2004 beleuchtet.Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet das Thema Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte in der Fußball-Bundesliga aus sportökonomischer und juristischer Sicht. Die Kernthemen umfassen die wirtschaftliche Bedeutung der medialen Verwertungsrechte für die Bundesliga-Vereine, das Verteilerschlüssel-System der Einnahmen aus der Zentralvermarktung, alternative Vermarktungsformen, die rechtliche Zulässigkeit der Zentralvermarktung im Rahmen des europäischen und deutschen Rechts sowie die Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Spannung in der Bundesliga. Die Arbeit stützt sich auf empirische Daten zur Entwicklung der Bundesliga-Vereine sowie auf rechtliche Analysen der relevanten Gesetze und Rechtsprechung.Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Zentralvermarktung im deutschen Fußball?
Es bedeutet, dass die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die medialen Rechte (z. B. TV-Rechte) für alle Vereine der 1. und 2. Bundesliga gemeinsam verkauft und die Einnahmen nach einem Schlüssel verteilt.
Warum ist die Zentralvermarktung kartellrechtlich umstritten?
Es wird geprüft, ob die gemeinsame Vermarktung eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Art. 81 EGV darstellt, da die Vereine ihre Rechte nicht individuell anbieten können.
Welchen Einfluss hat die Zentralvermarktung auf die sportliche Spannung?
Durch den TV-Geld-Verteilerschlüssel soll eine gewisse finanzielle Ausgewogenheit geschaffen werden, die den Wettbewerb spannend halten und die Dominanz einzelner Klubs begrenzen soll.
Welche alternativen Vermarktungsformen gibt es?
Alternativen wären die Einzelvermarktung durch die Klubs selbst oder hybride Modelle, wie sie seit 2004 teilweise für Internet- und Club-TV-Rechte existieren.
Wie wichtig sind TV-Einnahmen für die Bundesliga-Vereine?
Sie sind eine der wichtigsten Einnahmequellen und entscheidend für die wirtschaftliche Stabilität, insbesondere angesichts hoher Verbindlichkeiten in der Branche.
Was wurde in der empirischen Untersuchung dieser Arbeit analysiert?
Es wurde das wirtschaftliche Potenzial neuer Vermarktungsmodelle für Free-TV und Internet aus Sicht der Vereine mittels eines Fragebogens untersucht.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Steffen Straßheim (Autor:in), 2005, Die Zentralvermarktung der medialen Verwertungsrechte der Fußball-Bundesliga - Eine Beurteilung aus sportökonomischer und juristischer Sicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68582