Wenn hinlänglich in der modernen Gesellschaft die Begriffe Körper, Ästhetik, Geschlecht und Sexualität fallen, erregen sie stets die vielfältigsten sozialwissenschaftlichen und politischen Diskussionen. Vereinigt man nun diese Kategorien mit der Institution des Militärs, so prallen auf den ersten Blick traditionelle Ordnungen mit radikalen Verwandlungen aufeinander. Obwohl beide Phänomene – betrachtet man sie autark - im Rampenlicht postmoderner Gesellschaften stehen, umhüllt sie, miteinander vereint, ein Schleier aus fälschlich wahrgenommenen Deutungsmustern und bewusster Ignoranz. Die ‚Eroberung’ der militärischen Schiene durch die Frau hat nun nicht nur das gesamte militärische System transparenter gemacht, sondern ein generelles Interesse auf eine bis dato wenig bedeutsame und gekannte Institution gelenkt. Und doch scheint sich immer noch - oder gerade jetzt - eine Art Subkultur zu etablieren, die vieles nach außen wirft, aber auch einiges im Dunkeln verborgen lässt, so auch die Geschlechtersituation. Die Studie zeigt in theoretischer und empirischer Weise die Rolle des menschlichen Körpers im Militär auf. Es wird sowohl danach gefragt, inwieweit die Frau als Soldatin und ihr Bezug zum Körper im militärischen System bestehen kann, als auch danach, was den Geschlechtskörper eines Soldaten im Allgemeinen ausmacht, ohne den pädagogischen Gesichtspunkt zu vernachlässigen. Ferner wird die Frage, ob im soldatischen Alltag ein Leben zwischen Verunsicherung und Belastung mit der neuen Situation existiert und inwiefern die Integration von Frauen bestehende Wertvorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit verändert, beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Entwicklung der Fragestellung
3. Dimensionen des menschlichen Körpers
3.1 Der Körper im Wandel der Zeit
3.2 Körperdefinitionen
3.2.1 Der Körper aus physiologischer Sicht
3.2.2 Der Körper aus psychologischer Sicht
3.2.3 Der Körper aus sozialwissenschaftlicher Sicht
3.3 Männerkörper vs. Frauenkörper
3.3.1 Dimorphe Betrachtungen
3.3.2 Geschlechtsidentität
3.3.3 Transsexualität
3.4 Ästhetik
3.4.1 Ästhetik des Körpers
4. Militärische Ausbildung und Erziehung
4.1 Die Kohärenz von Erziehung und Ausbildung
4.1.1 Militärische Erziehung
4.1.2 Militärische Erziehung im historischen Kontext
4.1.3 Militärische Ausbildung
4.1.4 Militärische Ausbildung im historischen Kontext
4.2 Die Ausbildung der Soldaten in der Bundeswehr
4.2.1 Institutionelle und politische Rahmenbedingungen
4.2.2 Die allgemeine Grundausbildung
5. Erziehung des Körpers
5.1 Der Körper zwischen Militär und Gesellschaft
5.2 Militärische Körpererziehung
5.3 Objektbezogene Körpererziehung
5.4 Subjektbezogene Körpererziehung
5.4.1 Extrinsische Statusrelevanz
5.4.2 Der eigene Körper als Statusfunktion
6. Der Antagonismus von Weiblichkeit und Militär
6.1 Die Geschichte der Soldatin
6.1.1 Mythologische und methodische Aspekte der Frau im Kriegsdienst
6.1.2 Integration von Frauen in die Bundeswehr
6.1.3 Frauen in anderen Armeen – Ein Exkurs
6.2 Der weibliche Körper im Spannungsfeld maskuliner Konstruktionen
6.2.1 Physische Betrachtungen
6.2.2 Die Körpersache als sexuelle Friktion einer Geschlechterintegration S. 78 7. Geschlechtersituation in der Bundeswehr - Empirische Untersuchung
7.1 Methodik der empirischen Untersuchung
7.2 Auswertung der empirischen Untersuchung
7.2.1 Integration von Frauen in die deutschen Streitkräfte
7.2.2 Die Körperfrage
7.2.3 Männlichkeit und Weiblichkeit im Militär
7.2.4 Verunsicherung und Belastung der Soldaten
8. Zusammenfassung und Ausblick
9. Literaturverzeichnis
Anhang
1. Einleitung
Wenn hinlänglich in der modernen Gesellschaft die Begriffe Körper, Ästhetik, Geschlecht und Sexualität fallen, erregen sie stets die vielfältigsten sozialwissenschaftlichen und politischen Diskussionen. Die Generierung dieses Diskussionspotenzials entwickelt sich fast ausschließlich aus gesellschaftlichen Kommunikationsmedien, wenngleich eine kollektive Schuldzuschreibung über den Ursprung ausbleibt. Vereinigt man nun diese Kategorien mit der Institution des Militärs, so prallen auf den ersten Blick traditionelle Ordnungen mit radikalen Verwandlungen aufeinander. Obwohl beide Phänomene – betrachtet man sie autark - im Rampenlicht postmoderner Gesellschaften stehen, umhüllt sie, miteinander vereint, ein Schleier aus fälschlich wahrgenommenen Deutungsmustern und bewusster Ignoranz. Man könnte meinen, die wachsende gesellschaftliche Transparenz gegenüber beiden Phänomenen steht im Gegensatz zur wenig durchschaubaren, aktuellen integrativen Entwicklung in der Armee. Dennoch kann man nicht von einem unlogischen Rückschritt in präemanzipatorische Verhaltensschemata sprechen. Vielmehr rüttelt das unaufhaltsame Sexualschema und Körperbewusstsein an den starren Säulen tradierter Militärpädagogik und unterstreicht einmal mehr den schwierigen Verlauf des Modernisierungsprozesses alteingesessener Institutionen. Dabei ist der Umgang mit militärischen Elementen in unserer Gesellschaft offener geworden, was nicht nur die Mode zeigt: Militärlook ist ‚angesagter’ denn je. Jedes gut sortierte Bekleidungsgeschäft bietet dieser Tage Tarnfleckhosen und Camouflageaccessoires zum Verkauf an. Grund dafür ist vor allem der kürzlich vollzogene, längst überfällige Transformationsprozess in den deutschen Streitkräften, was wiederum unterstreicht, dass der emanzipatorische Wandel vor keiner Situation oder Profession halt machen wird[1]. Die ‚Eroberung’ der militärischen Schiene durch die Frau hat nicht nur das gesamte militärische System transparenter gemacht, sondern ein generelles Interesse auf eine bis dato wenig bedeutsame und gekannte Institution gelenkt. Wurden Wirkungskraft und Fähigkeiten der ‚Truppe’ bis in die späten Achtziger Jahre eher noch als überflüssig belächelt, kann sie sich heute, aufgrund neuer Aufgaben und Aufträge, einer stetig steigenden Reputation im In- und Ausland erfreuen. Dies macht sich vor allem an der exponentiell wachsenden Zahl an Bewerbern für eine militärische Laufbahn in Deutschland bemerkbar. Die Bundeswehr wirbt in diesem Zusammenhang äußerst erfolgreich mit Schlagwörtern wie ‚Schutz des Arbeitsplatzes’, ‚hohe Qualifizierungs- und Karrierechancen’ sowie ‚Teamarbeit’ und ‚soziale Absicherung’ und ist vielleicht gerade deshalb vor allem für junge Erwachsene und Schulabgänger attraktiv wie selten zuvor. Insbesondere bei Frauen erfreut sich die Möglichkeit für eine Laufbahn jenseits tristester Büroarbeiten und hauswirtschaftlichen Anstellungen immer größerer Beliebtheit.
Und doch scheint sich immer noch - oder gerade jetzt - eine Art Subkultur zu etablieren, die vieles nach außen wirft, aber auch einiges im Dunkeln verborgen lässt, so auch die Geschlechtersituation. Nach dem finalen Einzug der Frauen in eine der wohl letzten männlich geprägten Institutionen, müssen sich ex aequo zwangsläufig die Geschlechterverhältnisse respektive das Verhältnis zu Körper und Sexualität umgestalten, beziehungsweise anpassen. Eine Situation, die von vielen Beteiligten lieber totgeschwiegen wird, denn Fakt ist, dass ein Mann ein Mann bleibt und eine Frau eine Frau, ganz gleich ob Uniformen oder Rangabzeichen getragen werden. Eine prekäre Situation, die unter dem Aspekt der Einbeziehung beider Geschlechter und ohne den Vorwurf einer ideologischen Infiltration in die Armee als ein schlichter und schleichender Prozess abläuft. Des Weiteren ist unklar, wem diese Art der Reformation nun mehr abverlangt: den Frauen, die gegen das männlich-militärische Ethos ankämpfen, oder gar den Männern, die sich nun - wie bereits vor einem Vierteljahrhundert in Reaktion auf die Frauenbewegung - erneut reflexiv der eigenen Geschlechtlichkeit zuwenden müssen (vgl. Meuser 2000).
Auch der Körperbegriff muss dementsprechend neu formuliert werden. Die Austrainierung des männlichen Körpers und der Begriff der Männlichkeit, für den das Militär seit jeher steht, scheint an einem Wendepunkt mit dem ‚Einfall’ des weiblichen Schönen[2]. Nach Foucault (1994) ist das Militär ein Ort, an dem der männliche Körper produziert wird, also ein Ort der Männlichkeit. Dies hat mehrere Gründe: Obschon es auf den ersten Blick zweckentfremdet erscheinen mag, muss in diesem Zusammenhang der ästhetische Gesichtspunkt angesprochen werden, der das Soldatentum nach innen wie nach außen hin repräsentiert. Repräsentation nach außen, im Sinne einer Rezeption von Respekt und Ansehen gegenüber der eigenen, wie der fremdländischen Bevölkerung und ihren Bürgern. Körperliche Ästhetik dient aber auch nach innen zu einem einheitlichen Selbstbewusstsein und zur Identifizierung mit dem Soldatenstand. Zum anderen suggeriert die intentionale Formung des Körpers ein Höchstmaß an Widerstandskraft zum Zwecke des im Kampf erfolgreichen Soldaten. Nur ein körperlich sehr gut ausgebildeter Soldat ist in der Lage die physischen aber auch die psychischen Strapazen, die eine militärische Extremsituation mit sich bringen, leichter zu bewältigen. Körperbewusstsein und Körperlichkeit sind fundamentale Phänomene des Alltags, normiert und ausdifferenziert durch das Voranschreiten technologischer sowie sozialwissenschaftlicher Umstellungen, die ebenso das Militär beeinflussen.
Der militärische Bereich, mitsamt seiner institutionalisierten Formen und dogmatischen Ordnungen ist demnach – um nicht in ein vorzeitliches Vorurteil der Männerdomäne zu verfallen - gezwungen, Veränderungen der postmodernen Gesellschaft auch in das pädagogisch-psychologische Aufklärungsgerüst seiner Soldatinnen und Soldaten zuzulassen. Die vorliegende Studie soll einen objektiven und tatsächlichen Einblick in das Leben der ‚Staatsbürger in Uniform’, mit oben genannten Erscheinungen und Veränderungen, geben.
Die pädagogische Beschreibung eines jeden Phänomens der heutigen Gesellschaft ist gleichzusetzen mit der Gegenüberstellung klassischer Interpretationen unter Zuhilfenahme theoretischer Strickmuster, mit der Neuartigkeit der Abläufe. Mit Mitteln empirischer Operationen können so theoretische Akzentuierungen untermauert oder verworfen werden. Daher wird auch diese Arbeit theoretische Strukturen aufgreifen und mit empirischen Untersuchungen vergleichen. Es sollen die Körper- und Geschlechterverhältnisse von Soldatinnen und Soldaten, von Frauen und Männern in der deutschen Bundeswehr pädagogisch analysiert und innerhalb eines Interpretationszusammenhangs gesetzt und verständlich gemacht werden. Die Studie soll theoretisch und empirisch die Rolle des menschlichen Körpers im Militär aufzeigen. Es wird sowohl danach gefragt, inwieweit die Frau als Soldatin und ihr Bezug zum Körper im militärischen System bestehen kann, als auch danach, was den Geschlechtskörper eines Soldaten im Allgemeinen ausmacht, ohne den pädagogischen Gesichtspunkt zu vernachlässigen. Ferner soll die Frage, ob im soldatischen Alltag ein Leben zwischen Verunsicherung und Belastung mit der neuen Situation existiert und inwiefern die Integration von Frauen bestehende Wertvorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit verändert, beantwortet werden. Führt der Weg gar in eine androgyne Subkultur mit ‚Kämpfern’ ohne zwischenmenschliches Empfinden? Und wenn ja, ist dies realisierbar und ist es für die eigentliche Arbeit eines Soldaten – nämlich zu kämpfen - wert zu realisieren? Um den dargelegten theoretischen Themenkomplex empirisch zu füttern und einen kurzen Überblick über die aktuelle Lage der Männer und Frauen in den Streitkräften zu bekommen, soll schließlich eine Befragung von zufällig ausgesuchten Soldatinnen und Soldaten mittels eines standardisierten Fragebogens dienen.
Die Arbeit ist so strukturiert, dass zuerst - nach Beschreibung der Fragestellung - ein historischer Kontext formuliert werden soll. Hierbei geht es um geschichtliche Aspekte und Definitionen der militärischen Ausbildung und des menschlichen Körpers. Danach werden die Sinnzusammenhänge zur Erziehung des Körpers aufgegriffen, bevor im 6. Kapitel das Geschlecht eingehend untersucht wird. Die empirisch beantworteten Geschlechterdifferenzen und die Folgen im militärischen Bereich nehmen das siebente Kapitel ein. Zum Schluss werde ich die gesammelten Informationen zusammenfassen, einer kritischen Betrachtung aussetzen und auswerten. Die vorliegende Magisterarbeit ist Teil des pädagogischen Studiums an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.
2. Entwicklung der Fragestellung
Attraktivität wird heutzutage vor allem an der Beschaffenheit des menschlichen Körpers festgemacht. Danach konkretisieren sich Image und Status eines Individuums meist am körperlichen Ausdruck (vgl. Koppetsch 2000). Der Einfluss des Körpers auf das gesellschaftliche Leben mag zwar einem Abdriften in die Oberflächlichkeit gleichkommen, ist aber für die geisteswissenschaftliche Analyse von großer Bedeutung. Der Körper ist nicht mehr ausschließlich ein Hort von Authentizität und unhintergehbarem Bezugspunkt von Identität (vgl. Borkenhagen 2001), sondern wird vielmehr zunehmend konsumträchtig instrumentalisiert. Diese gegenläufige Tendenz definiert Borkenhagen (2001) mit der Bezeichnung „Körper als Projekt“ bzw. „Körper als Konstruktion“ (S. 1), wobei dadurch der Körper nicht mehr als „authentisches Zentrum“ (ebd.) erlebt wird, sondern als weitgehend (ver)änderbar[5]. Diese Aufwertung des Körpers markiert den Wendepunkt der modernen Gesellschaft, denn bis in das 20. Jahrhundert hinein gab es nur wenig ernstzunehmende sozialwissenschaftliche Diskurse (vgl. Bolz 2000). Schönheit und Attraktivität identifizieren sich durch die Gestaltung des eigenen Körpers. Die Körperform scheint demnach „eines der wesentlichen Schönheitskriterien zu sein“ schreibt Baumgartner (2006, S. 18) in seinem Buch »Attraktivität von Körperformen« und fügt weiter an: „wer schön ist, ist auch gut“ (S. 11). Ein aufmerksamer Beobachter erkennt hierbei mühelos die außerordentliche Problematik dieser Aussage. Ein gut aussehender Mensch hat größere Chancen bei der Partnerwahl, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit eingestellt, verfügt im Durchschnitt über einen höheren Verdienst und besitzt bessere Voraussetzungen für den beruflichen Aufstieg (vgl. Koppetsch 2000)[6]. In Anbetracht dieser Tatsache ist es wenig verwunderlich, dass Körperbewusstsein und Schönheitswahn unseren Alltag mitunter radikal beeinflussen. So sieht Koppetsch (2000) körperliche Attraktivität nicht als gottgegeben an: „Erscheinungsweisen sind wählbar geworden und Körperschönheit wie auch Attraktivität werden durch die Verbreitung von Fitness, kosmetischer Chirurgie und ‚body-styling’ immer weniger als Schicksal erfahren, sondern zunehmend zum Gegenstand der bewussten Gestaltung gemacht“ (S. 102). Eine ähnliche These zur Wandlung der Rolle des Körpers vertritt auch Bolz (2000). Demzufolge wird der Körper und seine Gegenwart für das Funktionieren unserer Gesellschaft immer unwichtiger. Betrachtet man in der heutigen virtualisierten Welt das Phänomen des Körperkults, so verkommt der menschliche Körper primär zum Statussymbol und wird zum „Schauplatz des Sinnes verzaubert“ (Bolz 2000, S. 210). Analog zur Variation sozialer Rollen und Rollenschemata ist ebenso der Aspekt des körperlichen Habitus (vgl. Clam 2000) von dynamischer Veränderung gekennzeichnet. Die eigentliche Funktion des Leibes zum Zwecke der Nutzbarmachung seiner Umwelt und der Natur, deplatziert die postmoderne Gesellschaft fast schon unbewusst ans Ende, um sie durch Begriffe wie Optimierung, Schönheit und Gesundheit zu ersetzen (vgl. Bolz 2000). Genormte Schönheitsideale und das Streben nach körperlicher Perfektion werden bereits in der Kindheit und im Jugendalter in Zusammenhang mit der elterlichen Erziehung, der Reaktion von Seiten Älterer und Gleichaltriger zur Bildung eines Körperbildes sowie eines Körper-Selbstwertgefühls (vgl. Nestvogel 2000) gebraucht. Nur unwesentlich sind dabei geschlechtsdifferente Aspekte von Bedeutung. Sowohl Frauen als auch Männer drängen gleichermaßen auf körperliche Schönheit und Vollkommenheit, auch wenn aus anatomischer und anthropologischer Sicht geschlechtsspezifische Unterschiede existieren[7].
Uneins ist die Geschlechterfrage allerdings in Dimensionen, betreffend der Zweckmäßigkeit des Körpers, jenseits jeglicher körperlicher Zurschaustellung. So brauchen „Frauen nicht so stark sein wie die Männer, sie müssen für sie stark sein, damit die Männer die sie gebären, es auch sind“ (Rousseau 1998, S. 395). Damit ist gemeint, dass beide Geschlechterkörper, rein biologisch betrachtet, für ungleiche Aufgaben antizipiert sind. Erst im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich, ungeachtet der Beschaffenheit der Anatomie des weiblichen Körpers, die berufliche Situation grundlegend geändert, wonach die emanzipierte Frau vermehrt die Initiative ebenfalls in der männlich-dominierten Berufswelt ergreifen konnte[8]. Dass dieser Zustand nicht ohne Folgen für beiderlei Geschlecht bleibt, ist unschwer vorauszusehen. Frauen in ‚Männerberufen’ müssen „aufgrund des Sichtbarseins ihre Kompetenz bzw. Professionalität unter besonderen Beweis stellen“ (Riegraf 2005, S. 146) und zugleich „[…] das Geschlecht zurücknehmen, um Anerkennung zu bekommen und Abgrenzung abzumildern […]“ (ebd.).
Ähnlich verhält es sich für Frauen in der militärischen Laufbahn und dem Berufsbild des Soldaten. Verglichen mit anderen Arbeitsbereichen ist das militaristisch-elitäre Denken vom Idealbild eines Soldaten ohne Frage männlicher Natur. Die gleichgestellte Integration von Frauen in das Militär greift demnach nach tief verankerten symbolischen Anordnungen der Geschlechterhierarchie und damit in institutionelle Zusammenhänge, wie beispielsweise Männlichkeit und Gewalt (vgl. Seifert/Eifler 2003). Allerdings klammern die gleichstellungspolitischen Entscheidungen Erklärungen über die körperlichen Bedingungen und Eigenschaften weitestgehend aus. „Die Idealfigur des Soldaten trägt Zeichen“ statuiert Foucault in seinem Werk »Überwachen und Strafen« (1994, S. 173) deutlich: „Die natürlichen Zeichen seiner Kraft und seines Mutes und seines Stolzes“ (ebd.). Der Körper ist dabei das „Wappen seiner Stärke und seiner Tapferkeit“ (ebd.). Der Soldat besitzt „ein starkes Haupt, ein hohen Magen, breite Schultern, lange Arm, starke Finger, kleinen Bauch, dicke Hüfte, geschmeidige Schenkel und trockene Füß“ (ebd.). Nicht gerade körperliche Merkmale, die einer Frau zuzuschreiben wären, worauf sich neue Diskrepanzen, besonders im Sektor der militärischen Ausbildung auftun. Exakt in diesem Gebiet ist die Formung des Körpers von essentieller Bedeutung. Foucault spricht vom „gelehrigen Körper“ (S. 173), vom Körper als einen formbaren Mechanismus zur Nutzbarmachung und zum Zwecke kriegsdienlicher Tätigkeiten bestimmter Machthaber (vgl. Foucault 1994). Und diese tradierte Einstellung zum soldatischen Körper hat sich bis heute in das Bewusstsein militärischer Ausbildungstechniken eingebrannt. Körperliche Ertüchtigungen sind unverrückbare Bestandteile der Ausbildung zum Soldaten und haben einen festen Platz im Dienstplan jeder Einheit. Die Erziehung des Körpers für militärische Zwecke, zur physiologischen und psychologischen Stärkung des Soldaten, wird programmatisch ausgearbeitet und, anhand von Leitsätzen, für das gesamte Militärpersonal erreichbar, in zentrale Dienstvorschriften gepackt. Andere Richtungen in der körpersoziologischen Forschung werden in dieser gesellschaftstheoretischen Perspektive auf den Körper allerdings ausgeblendet. So wird der Körper hier nur als Objekt gesehen, gewissermaßen als Gegenstand der Überwachung und Kontrolle (vgl. Foucault 1994, Koppetsch 2000) und weniger als „Träger des sozialen Sinns“ (Koppetsch 2000, S. 8) oder als „performativer Charakter“ (ebd.). Dies bedeutet, dass die Empfindungs- und Gefühlsebene des Körpers im militärischen Bereich nicht nur unbeachtet bleibt, sondern auch bewusst ausgeschlossen wird[9]. Für die Analyse der Bedeutung des soldatischen Körpers und damit gleichermaßen für die Fragestellung in dieser Arbeit, sollen hingegen beide Felder beleuchtet werden. Das Interesse gilt nicht alleine dem Objekt Körper, des Objekts Soldat; gerade mit der Frau in einer männlich-konnotierten Einrichtung wie dem Militär, ist auch ein unbedingter Blick auf die Sicht des Subjekts notwendig.
3. Dimensionen des menschlichen Körpers
3.1 Der Körper im Wandel der Zeit
Die Geschichte des menschlichen Körpers und deren theoretische und praktische Auseinandersetzung mit ihm, verläuft lang anhaltend und wechselhaft (vgl. Meyer-Drawe 2004). Der Körper „wurde und wird als athletischer und kriegerischer ertüchtigt, […] im religiösen Sinne glorifiziert, im Rahmen der Entwicklung bürgerlicher Gesellschaften zivilisiert und diszipliniert sowie unter der Maßgabe einer fortschrittlichen Wissenschafts- und Technikgeschichte objektiviert und manipuliert“ (Meyer-Drawe 2004, S. 603). Antike schriftliche Überlieferungen bekunden in initiierender Weise die Bedeutung der Leiblichkeit, anfänglich synonym für den toten Körper einer Leiche, über die „Ganzheitlichkeit der menschlichen Existenz“ (ebd.) und der „Differenz zwischen lebendigem Leib und totem Körper“ (ebd.), bis hin zu Platons philosophisches Konzept des Leib-Seele-Verhältnisses[8] (vgl. Meyer-Drawe 2004). Für Platon dominiert der Geist den Körper, da nur der Geist in der Lage ist die Idee des Wahren, Guten und Schönen zu erfassen und prangert damit die sinnliche Lebensführung an, die den ethischen Anspruch verletzt und zur weitgehenden Ausschaltung von Lust und Leidenschaft führt[9] (vgl. Beckers 1997).
Das Mittelalter bezieht ihre körperlichen Auffassungen aus der Christenlehre und tabuisiert sinnlich-körperliche Lebensweisen, bis in das Zeitalter des Humanismus, als mit fortschreitender Autonomie und Individualität des Menschen prosexuelle Lebensweisen toleriert werden (vgl. Beckers 1997). Meyer-Drawe (2004) unterscheidet dahingehend mehrere Tendenzen mit dem Umgang der Leiblichkeit im Mittelalter. „Neben eine weltzugewandte Erkenntnis tritt die Askese, die sich vor allem gegen eine verführbare Sinnlichkeit richtet, die von Gott ablenkt. Mit Selbstkasteiungen, Geständnispraktiken und harter körperlicher Arbeit wird der Kampf mit dem Teufel aufgenommen“ (S. 609). Ferner verweist Meyer-Drawe auf die wichtige Rolle der Repräsentation, „die Widerspiegelung des Himmels auf Erden“ (ebd.). Erst mit Luthers Reformation stellt sich der Mensch und seine Individualität wieder in den Mittelpunkt und kommt ab vom augustinischen Denken (vgl. Meyer-Drawe 2004). „Erst etwa im 14. Jahrhundert an tritt – verbunden mit den Intentionen der Renaissancebewegung – die bisher verborgene oder gar unterdrückte Sinnlichkeit wieder offen zutage“ (Beckers 1997, S. 135).
Dreihundert Jahre später beeinflusst das Körperthema nicht mehr nur medizinische und künstlerische Teilgebiete, sondern bewegt auch Geschichts-, Sozial- und Literaturwissenschaftler zu theoretischen Konzepten. Die Herauslösung aus der „mikrokosmischen Bezogenheit“ (Niestroj 1990, S. 153) bricht mit dem weitläufigen Verständnis des Körperbildes und forciert den „in der Sozialdisziplinierung durch den frühmodernen Staat maschinisierten Körper“ (ebd.). Die Erforschung des eigenen und fremden Leibes wird mehr und mehr Bestandteil der Sozialisation, in einem Prozess „in dem ein Individuum auf der Grundlage seiner biologischen Ausstattung Körperlichkeit, Körperbewusstsein und Körperausdruck, in wechselseitiger Auseinandersetzung mit seiner Umwelt entwickelt“ (Nestvogel 2000, S. 35). Der Überschuss des Sinnlichen als „Geilheit“ (Niestroj 1990, S. 153) und die Stellung der Masturbation wird ermöglicht, offen angesprochen und thematisiert, wenn auch nicht unbedingt geduldet. Obgleich „die Selbstbefriedigung nach Auffassung der (zeitgenössischen, Anm. des Autors) Ärzte und Pädagogen in die Ökonomie der Säfte zerstörend eingreift und das Individuum unter dem moralischen Imperativ steht, diese, aus der richtigen Zusammensetzung und der ungestörten Zirkulation der Körpersäfte resultierende Wirksamkeit, von der letztendlich der Fortschritt der Menschheit abhängt, nicht zu gefährden“ (Niestroj 1990, S. 154), ist der Umgang mit der Sexualität des eigenen Körpers nicht mehr aufzuhalten.
Die Wissenschaft der Neuzeit entwickelt psychosomatische Lehrmeinungen und stellt den weiblichen und den männlichen Körper, mit Hilfe fortschrittlicher Interaktions- und Medientechnologien, in das zentrale gesellschaftliche Rampenlicht. Die Konfrontation mit der eigenen Körperlichkeit und das Erfahren und Erkennen geschlechtsspezifischer Umbrüche – insbesondere in der Adoleszenz – erhebt den Körper zum „Träger kultureller Symbole“ (Kolip 1997, S. 124) und versetzt ihn in eine „zentrale Rolle als Darstellungsmedium“ (ebd.). Der Umgang mit dem Körper wird für das Individuum von immenser Bedeutung, da ohne ihn weder das Aushandeln der persönlichen Identität im gesellschaftlich-sozialen Umfeld, noch eine damit verbundene Manifestierung von Meinungs- und Machtkonstellationen möglich wäre. Inklusive der Verinnerlichung des Umgangs mit dem Körper entsteht aber auch die Kritik an der eigenen Erscheinung und der Wunsch nach statusfördernder Schönheits- und Ästhetikideale (vgl. Liebau 2000). Weiblichkeit und Männlichkeit rücken in einen, die Oberflächlichkeit protegierenden, Vordergrund. Was zählt ist der „Erscheinungsleib“ (Liebau 2000, S. 69) und sportliche Aktivitäten zur Ästhetisierung des Körpers werden zum Schlüssel der Vorzeigbarkeit.
3.2 Körperdefinitionen
Wie die Verschiedenartigkeit der zeitgeschichtlichen Einstellungen zur Leiblichkeit, muss daher auch die Bedeutung des Begriffes Körper für die vorliegende Arbeit aus unterschiedlichen Richtungen betrachtet werden. Pragmatisch formuliert unterteilt sich der menschliche Körper in viele einzelne Systeme, die wiederum aus Untersystemen bestehen und in der Anatomie des Menschen beschrieben werden (vgl. Faller 1980). Für die vorliegende Studie ist diese Art der anatomischen und physiologischen Definition nur beschränkt ausreichend, da der Organismus als solcher mehr ist, als ein Zusammenspiel von Organen, oder eine „Summe von Bausteinen“ (Faller 1980, S. 2). Verschiedene Kategorisierungen des Körpers erlauben den Blick in verschiedenste wissenschaftliche Richtungen; unterschiedliche Erklärungsansätze vereinnahmen je spezifische Theoriemodelle. Die Sinnhaftigkeit aller theoretischen Überlegungen wird letzten Endes durch die Koexistenz der organischen und sozialen Physik hervorgerufen und beweist eine grobe Spaltung der körperlichen Wissenschaft in zwei Stränge, die als Ausgangspunkte zum weiterführenden Denken betrachtet werden können (vgl. Bernard 1980). Es existiert also neben dem biologischen Körper „eine phantasiegebildete Anatomie, die sich nicht auf jene vom Biologen objektiv definierte zurückführen lässt“ (Bernard 1980, S. 70). Ähnlich wie die Ambivalenzen der kirchlichen Betrachtungsweise des Leibes als Hüter der Seele und der gesellschaftlichen Sicht, des Körpers als triebhaftes, nutzbares und verletzbares Objekt, so muss auch der wissenschaftliche Fokus auf physiologische und soziale Gebiete gerichtet werden. „Eben diese Nichtreduzierbarkeit“, schreibt Bernard, „die Kluft zwischen dem phantasiegebildeten und dem biologischen Körper ist ein wesentliches und begründetes Element der analytischen Vorgangsweise, und zwar der theoretischen, ebenso wie der klinischen“ (S. 70). Im Folgenden werden die Hauptstränge körperlicher Definitionen kurz angesprochen.
3.2.1 Der Körper aus physiologischer Sicht
Die körperliche Realität des Leibes und seine materiellen Elemente konkretisieren sich in der Anatomie am Modell „eines toten, unbeweglichen, in all seinen äußeren und inneren Organen zur Gänze sichtbaren und daher sezierbaren Körpers“ (Bernard 1980, S. 70). Die „Auflösung des Körpers in sein Leichenbild“ (ebd.) impliziert daher die Vergänglichkeit der Materie, jenseits eines imaginären Phantasiegebildes. Physiologisch gesehen existiert jeder Organismus aus Zellen, den „kleinsten Bausteinen unseres Körpers mit Lebenseigenschaften, welche eine innere Einheit gewährleisten“ (Faller 1980, S. 2). Die grundlegenden Eigentümlichkeiten der Zellen[10] sorgen für Gestaltung und Strukturierung verschiedener Gewebe, „die ihrerseits in mannigfaltiger Mischung zu Organen zusammentreten“ (ebd.) und durch die Einheitlichkeit ihrer Form und ihrer Funktionen charakterisiert werden. Die menschliche Entwicklung begreift sich demnach als „Entstehung der eigenen Seinsgestalt durch Ausformung, ausgehend von der befruchteten Eizelle. Die damit einsetzende Entwicklung führt zu Zellvermehrung, Zellverschiebungen und verschiedenartiger Ausbildung der Zellen“ (ebd.). Ganz allgemein werden so die Systeme des menschlichen Körpers ausgebildet, die als sinnvolle Ausgliederung in Werkzeuge des Lebens, dem Menschen die Einwirkung und Reaktion auf seine Umwelt gestatten. Der Körper – oder hier der biologische Leib – beherbergt sämtliche überlebenswichtige Organe und versteht sich demnach durch das aktive und passive Zusammenspiel aller Systeme als Organismus (vgl. Bernard 1980). Wenn auch die lebenserhaltenden Körperfunktionen von Frau und Mann gleich sein mögen, unterscheidet sich der weibliche Körperbau außerordentlich von dem des Mannes und kann geschlechtsspezifisch differenziert werden[11]. „Durch den Geschlechtsapparat und die von ihm ausgehende hormonale Wirkung wird der Mensch männlich oder weiblich geprägt“ (Faller 1980, S. 255). Das bedeutet, dass das Geschlecht in der menschlichen Welt eine entscheidende Rolle spielt. Die Verschiedenartigkeit des weiblichen und männlichen Körpers ist aber eigentlich eine Analogie und dient vor allem der hormongesteuerten triebhaften Fortpflanzung des instinktreduzierten Menschen (vgl. Kaiser/Kaiser 1998). Anders ausgedrückt ist die körperliche Unterschiedlichkeit von Mann und Frau der Auslöser für die Entstehung neuen Lebens und steht damit - biologisch betrachtet - für die Aufrechterhaltung der eigenen Art.
3.2.2 Der Körper aus psychologischer Sicht
Neben den materiellen Merkmalen eines menschlichen Lebewesens, betonen Bleich/Bleich (2005) allerdings vor allem die enorme Wichtigkeit des psychischen Systems: „All diesen Organsystemen ist die Psyche oder Seele des Menschen übergeordnet. Sie gibt unserem Denken und Handeln ein Ziel, bestimmt unsere Stimmungen und Gedanken“ (S. 5). Der abstrakte Bestandteil der menschlichen Psyche findet andererseits keinen Raum im physiologischen Erscheinungsbild und im Organismus sensorischer Funktionen. Auch wenn altertümliche Vorstellungen von einem festen Platz der Seele im menschlichen Körper ausgehen, ist das elementare, visuelle Vorhandensein nicht beweisbar. Und doch erfährt der seelische Aspekt des Menschen einen höheren Stellenwert, als der funktionale Körperbau. Die im Laufe des Heranwachsens entstehende Selbstkategorisierung und Unterscheidung des eigenen Leibes von der Außenwelt, ist ein Schritt zur Genese des Bewusstseins des individuellen Körpers (vgl. Bernard 1980), also eine Verknüpfung der organischen und psychischen Systeme, bzw. in anderen Worten ausgedrückt: der „psychobiologische Aspekt des Körpers“ (Bernard 1980, S. 31). Die Motorik, oder auch die „postulare Funktion des Körpers in der psychischen Entwicklung des Kindes“ (ebd.) zeigt auf, „wie das Kind sich Schritt für Schritt seines Körpers als einer ungeteilten und dynamischen Realität, die sich von den Dingen und von den anderen menschlichen und nicht menschlichen Lebewesen unterscheidet, bewusst wird“ (ebd.). Bernard verweist in diesem Fall auf die Notwendigkeit der reflexiven Betrachtungsweise, mit Hilfe der Sichtbarwerdung des eigenen Körpers im Spiegel und dem Erleben des visuellen oder exterozeptiven Bildes. Dieser phänomenologische Aspekt der Bewusstwerdung im Laufe des Heranwachsens ist auch Vorausbedingung der Körperlehre in sozialwissenschaftlicher Hinsicht, was das folgende Kapitel einnehmen soll.
3.2.3 Der Körper aus sozialwissenschaftlicher Sicht
Wenn Plessner (1965) von der „exzentrischen Stellung des Menschen in der Naturordnung“ (S. 290) spricht, meint er die unweigerliche Möglichkeit der Reflexion und des Heraustretens aus dem eigenen Ich, mit der Eventualität der Selbstbeobachtung und Selbstbetrachtung. Die psychosoziologische Aufbereitung der individuellen Körperanalyse versteht „beim Erwachsenen wie beim kindlichen Individuum die visuelle Nötigung durch das Bild seines Körpers und weiters die narzisstische Suche nach Identifikation mit dem anderen“ (Bernard 1980, S. 91). Unter Zuhilfenahme des Körpers und der Sinne entstehen Wahrnehmungsmuster, die uns helfen natürliche und gesellschaftliche Sachverhalte zu lernen und zu verstehen; ein Prozess, der allein über den Weg der Sprache und des Bewusstseins weniger einschneidende und grundsätzliche Ansprüche und Strukturen erfährt (vgl. Barlösius 2000). Gesellschaftliche Normen sind dabei die Träger körperlicher Formung und Anpassung an die Anforderungen der Umwelt, ganz gleich ob bei wilden Eingeborenenstämmen in den Wäldern Südamerikas, oder in der zivilisierten westeuropäischen Kultur. Es wird deutlich, dass „das soziale Urteil und die Werte, die es mit sich bringt, unser Verhalten in Bezug auf den Körper bedingen, und zwar nicht durch die innere Zensur, welche diese Werte ausüben und das Schuldgefühl, welches sie hervorbringen und im Anschluss daran die sublimierten Ideale, welche sie projizieren und fördern; sie strukturieren unseren Körper indirekt sogar in der Form, dass sie sein Wachstum, seine Gesunderhaltung, seine Präsentation und seinen Gemütsausdruck lenken“ (Bernard 1980, S. 107). Die Sozialisation ist für das Individuum ein unentbehrlicher Schritt zur Aufnahme in die gesellschaftliche Gemeinschaft. Die körperliche Sozialisation kann hier nicht weniger wichtig bewertet werden, vor allem wenn es sich dabei um weibliche Jugendliche handelt und ihre Erfahrungssuche und Entdeckung des eigenen Körpers (vgl. Schuhmacher-Chilla 2000). Körpersozialisation ist demnach der Prozess, „in dem ein Individuum auf der Grundlage seiner biologischen Ausstattung Körperlichkeit, Körperbewusstsein und Körperausdruck in wechselseitiger Auseinandersetzung mit seiner Umwelt entwickelt“ (Nestvogel 2000, S. 35). Dabei werden vom Individuum gesellschaftliche Symbolisierungen interpretiert, verkörpert und verarbeitet (vgl. Nestvogel 2000). Körperdiskussionen vereinen heutzutage das gesellschaftliche Gefälle, lassen keinen Raum für milieuspezifische Annahmen und erwecken somit das universale soziale Interesse. Anders sieht das dagegen Bourdieu (1993), für den der menschlichen Körper ein offensichtliches Klassenzugehörigkeitszeichen darstellt und damit auch eine unverzichtbare Grundlage der Hierarchisierungs- und Differenzierungsmechanismen der modernen Gesellschaft (vgl. Bourdieu 1993). Das Individuum nimmt sich selbst in dem je persönlichen sozialen Raum wahr und erfährt dadurch seine Umwelt und Lebenswelt, die von Geburt an Einfluss auf den Menschen nimmt. Dadurch werden sowohl die Wertvorstellungen als auch das individuelle Verhalten maßgeblich beeinflusst, welche signifikant zur Position des Menschen im sozialen Raum bestimmt werden.
Philosophische Annahmen sehen die Werte des menschlichen Leibes dagegen weder in seinem sozialen, noch in seinem biologischen Nutzen, denn in einem simplen Aufbewahrungsort für das wirklich essentielle Gut eines Menschen, seine Seele. Im Gegensatz zum Körper ist die Seele eine immaterielle, nicht zusammengesetzte Substanz, die nicht zerfallen und vergehen kann[12]. Wenn auch die Meinungen und Vermutungen über das Körper-Seelen-Phänomen auseinander gehen, besitzt dieser Untersuchungsgegenstand in der geisteswissenschaftlichen Körperforschung auch heutzutage noch ein hohes Maß an Aktualität.
3.3 Männerkörper vs. Frauenkörper
Die Verschiedenartigkeit von männlichen und weiblichen Körpern wird sowohl in biologischen, als auch psychosozialen, soziologischen und pädagogischen Forschungsbereichen kontrovers diskutiert. Dabei werden als Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht nur klar sichtbare Phänomene, sondern auch Differenzen in Werte- und Moralvorstellungen, die Eigenschaften wie Männlichkeit und Weiblichkeit konstruieren, aufgezeigt. Die folgenden drei Abschnitte sollen auf visuelle und soziale Geschlechtsunterschiede zwischen Männern und Frauen gleichermaßen eingehen.
3.3.1 Dimorphe Betrachtungen
Der „anthropologische Dimorphismus“ (Jacobi 2004, S. 422) stellt keine Erfindung der Neuzeit dar, wie schon antike Aufzeichnungen Platons belegen, der in der Politeia das Geschlecht zum Gegenstand der Betrachtung über Gleichheit und Ungleichheit macht (vgl. Jacobi 2004). Zentrale Merkmale der Differenz zwischen dem männlichen und dem weiblichen Körper sind die zur Reproduktion benötigten Indikatoren: „Männer produzieren Sperma und ejakulieren, Frauen menstruieren, verfügen über Eizellen, tragen den Fötus aus und stillen das Baby“ (Zimbardo 1995, S. 85). Exaltiert formuliert beginnt die Trennung der Geschlechter und die Hierarchisierung von Mann und Frau bzw. männlichen und weiblichen Körpern bereits in den Anfängen der Menschheitsgeschichte, vorausgesetzt wir schenken den biblischen Aufzeichnungen über ‚Adam’ und ‚Eva’ im Paradies wissenschaftlichem Glauben[13]. Im frühen Mittelalter findet diese unbestätigte Theorie der Geschlechterfrage rege Zustimmung – zumindest in Regionen, die mit dem Christentum assoziiert sind - da das niedergeschriebene Wort Gottes in der Bibel, ein unumstrittenes Gesetz darstellt, deren Missachtung und Anzweiflung als Gotteslästerung bezeichnet werden und schmerzvolle Strafen nach sich ziehen kann. Jacobi (2004) gibt an, dass im christlichen Mittelalter zunächst die Gottesebenbildlichkeit des Menschen die Grundlage „aller Diskussionen über den Status der Frau bildet, so dass in dieser Bestimmung des Menschen der entscheidende Dreh- und Angelpunkt des Diskurses über das erste und zweite Geschlecht liegt“ (S. 422). Da Gottes menschliches Ebenbild männlicher Schöpfung ist, sieht sich die Frau in der Rolle der vernachlässigten, unwichtigen Person, die eigentlich nur für die Arterhaltung des Mannes einstehen muss. Dementsprechend erhalten die Frauen weniger Rechte und mehr Pflichten, sind im öffentlichen Leben bedeutungslos und dienen nur dem Mann und der Fortpflanzung. „Ausgangspunkt ist ein einseitiges Bild der Frau: Frauen gelten als labil, führen andere in Versuchung, sind zänkisch und herrisch. Von Natur aus minderwertig, erschienen sie der mittelalterlichen Männerwelt als körperlich und geistig unterlegen. Frauen gelten als ungebändigt, zügellos und widerspenstig und sollen erst vom Vater und später vom Ehemann zu Demut und Gehorsam erzogen werden“ (Meier 2005, S. 10). Die Diffamierung der Frau erstreckt sich über sämtliche gesellschaftliche Bereiche, so auch bezüglich ihres Körpers und ihrer Sexualität, letztere durch die Institution der Ehe reglementiert (vgl. Meier 2005). Der weibliche Körper wird verteufelt und gilt im Gegensatz zu dem des Mannes als unrein und schmutzig; nur die Oberfläche strahlt Schönheit aus, blendet den Mann und lässt ihn von der wahren Gefahr des Bösen ablenken (vgl. Meier 2005).
Der Männerkörper dagegen gilt als stark, rein und potent, wonach auch die Rolle des Mannes im Mittelalter eine übermächtige Position einnimmt. Männliche Sexualität wird uneingeschränkt ausgelebt, was den weiblichen Körper zu einem Lustobjekt degradieren lässt. „Mägde sind oft Sexualobjekte ihrer Herren und deren Söhne. Während für die Frau das Gebot der ehelichen Treue gefordert wird, gelten uneheliche Kinder als ein Zeichen männlicher Potenz und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit“ (Meier 2005, S. 16). Es sei allerdings erwähnt, dass die mittelalterliche Kirche zu dieser Zeit eine regelrechte Sexual- und Körperfeindlichkeit betreibt, was nicht nur in der einfachen Bevölkerung auf Unverständnis stößt. Der Geschlechtsakt als reine Fortpflanzungsfunktion solle demnach keinen Zugewinn an sexueller Lust und erotischer Stimulation beinhalten. Die mittelalterliche Frau und ihr Körper stecken in einem paradoxen Verhältnis zwischen einem Männer anziehenden Wesen, aufgrund maskulin-erzwungener sexueller Objektisierung und dem Männer abstoßenden Geschöpf, dass infolge der Beherbergung des Bösen und der Sünden, einen für den Mann wertlosen und schädigenden Charakter besitzt. Somit bildet sich die Differenz zwischen männlich und weiblich vorrangig aus der Vorstellung von Gut und Böse heraus, wenngleich die körperlich-sexuelle Ebene immer mehr Gewichtung erhält. Spätestens im 18. Jahrhundert wird die „Unordnung der Geschlechter“ (Jacobi 2004, S. 425) dahingehend neu klassifiziert, dass mythische Vorstellungen von der Sünde im Frauenkörper, zugunsten wissenschaftlicher Befunde gänzlich weichen und die Verteidigung des weiblichen Geschlechts zulassen. Es geht im übertragenen Sinne nicht um eine Heranführung der Frau an die Position des Mannes, sondern um eine komplette Neuorientierung des weiblichen Geschlechts, ihrer Rolle und die abnehmende Übermachtstellung des männlichen Körpers. Damit waren „auf der Basis der körperlichen natürlichen Differenz mehr oder weniger komplexe psychosoziale Geschlechtscharaktere konstruiert worden, die vor allem für den weiblichen Geschlechtscharakter weiterhin diskursiv bearbeitet wurden, während der männliche Geschlechtscharakter sich deutlich abnehmender Aufmerksamkeit erfreute, ja man schließlich in Nachschlagewerken nach Einträgen zu ‚Mann’ vergeblich sucht“ (Jacobi 2004, S. 425f.). Jacobi erklärt anhand dieser Entwicklungen die Entstehung einer „grundsätzlichen Dichotomie und Polarisierung der Geschlechter“ (ebd.), welche sich bis zur Postmoderne noch erheblich ausbreiten soll. Die Frage nach der Funktion der geschlechtlichen Differenz, bleibt auch in der Neuzeit eine biologische; und der biologische Körper ist derjenige, „der auf der Grundlage eines abstrakten Modells die Zuschreibung eines wahren Geschlechts zulässt, das für den Einzelnen notwendig ist, damit er/sie seinen oder ihren richtigen Platz in der Gesellschaft einnehmen kann, indem er/sie die entsprechenden Funktionen nach Maßgabe biologischer Normen ausführt, die dann zur Grundlage von normativen, d.h. moralischen Urteilen werden“ (Gatens 1995, S. 36).
Neuere Diskurse zählen eine Vielfalt von Gründen für geschlechtliche Körperdifferenzen auf und bedienen sich verschiedenster morphologischer Theorien und Ansichten. Freuds psychoanalytische Annahmen über die anatomischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, wurzeln im Verständnis der Geschlechtsrollenentwicklung. Demnach haben Jungen einen Penis und Mädchen nicht, weshalb sie sich verstümmelt, kastriert und minderwertig fühlen und das andere Geschlecht um diese anatomischen Unterschiede beneiden (vgl. Freud 1991). Die Jungen dagegen befürchten den Verlust ihres Genitals bei fortwährendem Wunsch der genitalen Inbesitznahme der Mutter, hervorgerufen durch die Kastrationsdrohung des Vaters[14]. Geschlechtsunterschiede hält Freud für einen Teil des biologischen Bauplans des Menschen, und den anatomischen Unterschied nur beim Durchleben der ödipalen Situation für bedeutend. Auch wenn Freud mit seinen Ausführungen für eine Zäsur in der psychologischen Wissenschaft sorgt, bleiben Behauptungen über die Konsequenzen der körperlichen Unterschiede von Mann und Frau marginal. Fischer-Homberger (1984) geht da noch einen Schritt weiter, greift die Minderwertigkeitsgefühle der Frau auf und spricht von der Frau gar von einem Mängelwesen im Vergleich zum Mann. Die Assoziation zu Plessners anthropologischer Theorie des instinktreduzierten Menschen (vgl. Kaiser/Kaiser 1998) scheint übertrieben und diskriminierend, meint aber eigentlich die Frau und das Leiden an ihrem Geschlecht, als veräußerlichte Form des sexuellen Prinzips (vgl. Fischer-Homberger 1984; Schmid 1990). Biologische Differenzen des menschlichen Körpers stehen dagegen aus ethologischer Sicht in einer Wechselbeziehung zueinander und können in aktiv/passiv oder auch penetrierbar/nicht penetrierbar kategorisiert werden (vgl. Gatens 1995). „Dies bedeutet, dass das, was ein Körper zu tun und ein Individuum zu fühlen vermag, zumindest teilweise von seinen Verhältnissen zu den anderen Körpern und von den Mächten und Affekten, die nach seinen Vorstellungen diese legitimieren, abhängt“ (S. 48).
3.3.2 Geschlechtsidentität
An und für sich scheint die Geschlechterfrage eine Entdeckung der postmodernen Gesellschaft, jedenfalls findet sie erst im 20. Jahrhundert immense wissenschaftliche Anerkennung, nach der emanzipatorischen Befreiung der Frau vom klassischen Rollendenken. Die punktuelle Auseinandersetzung mit dem Geschlecht führt nicht nur zu einem erstarkten Bewusstsein von Frauen, sondern auch zu strukturalistischen und theoretischen Analysen und Konzepten, die beispielsweise mit Einführung von Mode- und Kunstwörtern die Literatur überschwemmen. „Geschlecht ist nicht etwas, was wir haben, schon gar nicht etwas, was wir sind“, sagt die deutsche Psychologin Gitta Mühlen Achs (1998, S. 21), und verdeutlicht damit die sozialkonstruktivistische Theorie, wonach Geschlecht nicht biologisch vorprogrammiert oder kulturell erzwungen ist, sondern ein Produkt kontinuierlicher – bewusster wie unbewusster – Interaktionsarbeit darstellt. Die Unterscheidung vom biologischen Geschlecht (engl. sex) und dem psychologisch, sozialen und kulturellen Geschlecht (engl. gender), bestätigt die Vermutung, dass eine geschlechtliche Identität jenseits offensichtlicher Merkmale liegen muss[15]. Vieles von dem, was man für typisch männlich oder weiblich hält, ist gelernt, beeinflusst und geformt durch die besondere Kultur in der ein Individuum lebt (vgl. Williams 1983). Zur Geschlechtsidentität, als Teil des Selbstkonzeptes, das wir als weiblich oder männlich bezeichnen, gehört die Bewusstwerdung und Akzeptanz des eigenen Geschlechts (vgl. Zimbardo 1995), dass uns nicht nur durch den bloßen Blick in den Spiegel vor Augen gehalten wird. „Geschlechtsidentität ist das Erleben, männlich oder weiblich zu sein; das Konzept bedeutet, dass man sich seines biologischen Geschlechts bewusst ist und dass man es akzeptiert“ (Zimbardo 1995, S. 85). „Im Allgemeinen fällt diese Identität mit dem bei der Geburt identifizierten und zugeschriebenen biologischen Geschlecht zusammen. In der menschlichen Entwicklung können wir eine unverzichtbare und entscheidende Etappe feststellen, die etwa um das fünfte, evtl. auch das sechste Lebensjahr, jedenfalls mit Schuleintritt, erreicht ist. Dies ist die Übernahme der eigenen Geschlechtsidentität und die Erkenntnis, dass sie unveränderlich und konstant ist“ (Alfermann 1996, S. 57). Vera King (2002) verzichtet in ihrer Definition der gender identity auf einen zeitlich vorgegebenen Initialparameter. Für sie ist Geschlechtsidentität „die Kontinuität des Selbsterlebens eines Individuums in Hinblick auf sein Geschlecht und umfasst die Gesamtheit jener Aspekte des Selbst oder der Identität, die als mit dem Geschlecht genuin verbunden angesehen werden“ (King 2002, S. 245). Sichere Befunde lassen aber darauf schließen, dass die Geschlechtsfindung bereits in frühem Alter festgelegt sein muss, da sich mit der Entwicklung des Sprachverständnisses, auch ein eindeutig geschlechtsspezifisches Selbstkonzept entwickelt (vgl. Becker-Schmidt/Knapp 1987). „Was hier Geschlechtsidentität oder auch Kern-Geschlechtsidentität genannt wird, ist zunächst nicht viel mehr, als ein Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einem der beiden biologischen Geschlechter […] und ein sich über entsprechende Erfahrungen vermittelndes Zugehörigkeitsgefühl, dass sich über Prozesse der Selbstsozialisation, des Sich-bewegen-Lernens innerhalb einer geschlechtlich differenzierten Realität mit all ihren Gesten, Symbolen, Gegenständen anreichert“ (Becker-Schmidt/Knapp 1987, S. 152). Angerer (1995) dagegen verweist auf Butler, die eine reine kulturelle Bedeutung der Genderfrage anzweifelt, da die „Identitätskonzeptionen, die sex und gender […] trennen, um es durch das Begehren untrennbar wieder zu verquicken“ (S. 26), den Körper zu einem passiven Moment machen und ihn als bloßes Instrument oder Medium darstellen, „dass nur äußerlich mit einem Komplex kultureller Bedeutungen verbunden ist“ (ebd.). Somit ist der Prozess ein Geschlecht zu werden, abhängig von der Inszenierung und Wiederholung performativer Akte[16] – einer „diskursiven Performativität“ (ebd.) - von Mann und Frau und unterstreicht geschlechtliche Identitäten als ein fortwährendes, sich ständig verschiebendes und kontextuelles Phänomen (vgl. Angerer 1995).
Die dauerhaften Wandlungen, denen das Geschlechterverhältnis bis in die heutige Zeit ausgesetzt ist, lassen dennoch keine Lockerung einer „binären Oppositionierung“ (Rendtorff/Moser 1999, S. 29) von Mann und Frau, oder männlich und weiblich zu. Gerade neofeministische Untersuchungen deuten auf bestehende Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern, auch wenn ein gesellschaftliches Hinsteuern zur Gleichberechtigung und Angleichung immer lebendiger wird. Rendtorff/Moser (1999) stellen daraufhin ernüchternd fest, dass sich möglicherweise die Interpretation von Weiblichkeit gewandelt hat, nicht aber der Dualismus des Geschlechtersystems. Dass die Unterscheidung von Mann und Frau in erster Linie am männlichen bzw. weiblichen Körper festgemacht wird, haben die voran gegangenen Analysen gezeigt. Die Identitätsfrage stellt aber klar heraus, dass für das Individuum sozialisatorische und pädagogische Ansätze unabdingbar vorhanden sein müssen, um das eigene Geschlecht in mitten der je spezifischen Umwelt herausfiltern und in der Gesellschaft positionieren zu können.
Fakt bleibt somit, dass allein die leibliche Voraussetzung, einen männlichen oder weiblichen Körper zu haben, nicht zu einer charakteristisch differenten psychischen Entwicklung, zu unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben und Konflikten mit geschlechtspezifisch unterschiedlichen Bewältigungsformen führt. Bestätigung findet diese Aussage vor allem im Phänomen der Transsexualität.
3.3.3 Transsexualität
Der anatomische Geschlechterunterschied wird nach Bublitz (2000) als eine Konstante des sozialen Geschlechtersystems begründet, was bedeutet, dass in Anbetracht der Tatsache was wir sehen, wir dementsprechend schlussfolgern, um was es sich handelt. Zum Beispiel folgern wir aus dem sozialen Verhalten eines Individuums auf dessen biologisches Geschlecht. Dabei wird unterstellt, dass die für eine geschlechtliche Zuordnung erforderlichen körperlichen Geschlechtsmerkmale vorhanden sind (vgl. Hagemann-White 1988). Demzufolge bleibt festzuhalten, dass das soziale Geschlecht einen noch viel größeren Stellenwert besitzt, als das biologische. Deutlich wird diese Tatsache an der Erforschung transsexueller Phänomene. „Hier behaupten physisch normale Personen, seelisch eigentlich dem Gegengeschlecht anzugehören und daher im falschen Körper gefangen zu sein“ (Runte 1998, S. 119). Transsexuelle Menschen glauben, dass sie einem anderen als ihrem Geburtsgeschlecht angehören und wollen dahingehend leben. Es existieren viele individuelle Wege, die häufig mit einer Umgestaltung des eigenen Lebens, des äußeren, persönlichen Erscheinungsbildes und mit dem Wunsch nach verschiedenen medizinischen Eingriffen zur Angleichung an das als richtig erlebte Geschlecht einhergehen. Transsexualität ist jedoch keine von der Norm abweichende sexuelle Präferenz – wie beispielsweise Transvestismus – sondern eher eine Frage des Identitätsgeschlechts. Das Ziel dieser Menschen besteht darin, ihr soziales Geschlecht, ihr Empfinden, eigentlich ein Mann oder eine Frau zu sein, schnellstmöglich und konsequent dem biologischen Geschlecht anzupassen und folglich eine Geschlechtsumwandlung durchzuführen. Am Beispiel der Transsexualität wird aufgezeigt, dass die Geschlechterrolle bewusst umdefiniert wird (vgl. Bublitz 2000). Es wird aber auch deutlich, „welch hohe Kunst in einer natürlichen Geschlechterzugehörigkeit steckt“ (Hirschauer 1996, S. 248). Es geht hierbei um einen „Habitus, der unsere Verkörperung der Zweigeschlechtlichkeit unterstützt und […] einen geschulten Blick, der uns routinemäßige Geschlechtsunterscheidungen ermöglicht“ (ebd.). Das was uns als Natur erscheint, ist also nichts anderes als sozial produziertes, kulturelles Wissen (vgl. Bublitz 2000).
3.4 Ästhetik
Ein Diskurs über die Tragweite und den sozialen und kulturellen Nutzen des menschlichen Körpers wäre ohne die Begrifflichkeit der Ästhetik kaum ausreichend thematisiert. Dabei definiert sich Ästhetik in einem breiten Spektrum unterschiedlichster Kontexte, durch unterschiedlichste Epochen und Gesellschaften hindurch, verbindet sich mit gegensätzlichen Phänomenen, lässt jedoch die Resultate im Auge des Betrachters. Entsprechend postuliert Kant: „Geschmack ist das Vermögen der ästhetischen Urteilskraft, allgemeingültig zu wählen. Er ist also ein Vermögen der gesellschaftlichen Beurteilung äußerer Gegenstände in der Einbildungskraft“ (zitiert in Weischedel 2001, S. 565). Dadurch fällt auch eine einheitliche Definition des Ästhetikbegriffs schwer, da der Sinngehalt mehr aussagt, als die wörtliche Übersetzung der sinnlichen Wahrnehmung aus dem Griechischen hergibt. Im alltäglichen Sprachgebrauch verbinden wir Ästhetik synonym mit etwas Schönem, Ansprechendem, so dass zumeist ein Objekt, eine Form oder ein Kunstwerk damit gemeint ist. Allerdings werden oft auch menschliche Handlungen und Bewegungen, oder Abstraktionen ästhetisch bezogen. Hutcheson (1986) sieht beispielsweise die Ästhetik in einer moralischen Handlung, die sowohl subjektiv als auch von außen als schön empfunden wird, weil die Ziele der beiden Weltenzugänge – nämlich Moral und Kunst – stets gemeinsam auftreten und der moralische Charakter in schönen Gesichtern oder schönen Kunstwerken moralische Anteile im Menschen ansprechen (vgl. Hutcheson 1986). Dem entgegnet Burke (1989), dass Geschmacksunterschiede nur scheinbar und oberflächlich betrachtet existieren. Die sinnliche Ebene der Wahrnehmung markiert ein objektives Vorhandensein von Ästhetik, klammert aber Dinge, welche die Einbildungskraft eines Menschen einbeziehen, gegenüber seiner bis dato erlebten Erfahrungswerte aus (vgl. Burke 1989). Im alten Griechenland hatten die Mythologie und die Naturwissenschaften erheblichen Anteil an der Entwicklung der Ästhetik und die damit verbundene Entfaltung der Künste, wenn auch ohne einer theoretischen Fixierung. Für Aristoteles dient die schöne Kunst der „Ergötzung und Erholung, indem sie reine Gefühle auslöst, Bedürfnisse nach gefühlsmäßigem Ausleben befriedigt und so die Seele von ihren Affekten (und deren Übermaß) reinigt, sie (und die Affekte selbst) auf ein ruhiges Maß herabstimmt, eben durch den Ablauf der Affekte“ (Eisler 1977, S. 165). Platon etwa, fordert einen Aufgriff der pythagoräischen Ästhetik und damit Merkmale wie Maß, Ordnung, Symmetrie, die Teile des Schönen sollen begrenzt und ebenmäßig, sowie in einem proportionierlichen Verhältnis zueinander sein (vgl. Parmentier 2004). Die neuere Philosophie beschreibt Ästhetik dagegen als die Theorie und Philosophie der sinnlichen Wahrnehmung, mit dem Bestreben nach Ausbildung einer sensitiven Vernunft (vgl. Rousseau 1995), um die „sinnlich erfassbaren Beziehungen zwischen den Dingen und sich selbst kennen zu lernen“ (Rousseau 1995, S. 111). In seiner kontemplativen Analyse stellt Alexander Gottlieb Baumgarten mit der Aesthetica erste grundlegende theoretische Expertisen auf, wonach er Ästhetik als Theorie der freien Künste, als untere Erkenntnislehre, als Kunst des schönen Denkens, als Kunst des der Vernunft analogen Denkens und damit als die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis definiert (vgl. Baumgarten 1983). Als Ziel setzt sich die ästhetische Wissenschaft nach Baumgarten die „Vervollkommnung der sinnlichen Erkenntnis“ (S. 13) und damit die Vollkommenheit allgemeiner Schönheit, im tieferen Sinne das sinnlich wahrnehmbare Schöne. Um dies zu erreichen muss nach Übereinstimmungen gesucht werden, die für Baumgarten eine hierarchische Reihenfolge einnehmen. „Die Übereinstimmung der Gedanken […] d.h. die Schönheit der Sachen und Gedanken, die von der Schönheit der Erkenntnis selbst, deren ersten und wichtigsten Teil sie darstellt, wohl zu unterscheiden ist“ (ebd.), versteht sich als allgemeine Schönheit der sinnlichen Erkenntnis. Neben der Übereinstimmung von Gedanken bezeichnet sich allgemeine Schönheit für Baumgarten ferner durch die Übereinstimmung von Ordnung und Zeichen. „Die Übereinstimmung der Ordnung, in der wir die schön gedachten Sachen überdenken, mit sich selbst und mit den Sachen, soweit sie in Erscheinung tritt, d. h. die Schönheit der Ordnung und der Disposition. […] Die Übereinstimmung der Zeichen (Ausdrucksmittel) unter sich und mit der Ordnung und den Sachen, soweit sie in Erscheinung tritt, d.h. die Schönheit des Ausdrucks, zum Beispiel die Formulierung und der Stil, wenn das Ausdrucksmittel die Rede oder das Gespräch ist, und der Vortrag, wenn das Gespräch mündlich abgehalten wird“ (ebd.). Auch Thomas von Aquin formuliert im Bannkreis der antiken Vorlagen drei Merkmale, die für die Schönheit erforderlich sind: „Erstens“ zitiert Parmentier (2004) Thomas von Aquin, „die Unversehrtheit oder Vollendung; die Dinge nämlich die verstümmelt sind, sind deshalb schon hässlich“ (Parmentier 2004, S. 16). „Ferner“, und da stimmt er mit Baumgarten überein, „das gebührende Maßverhältnis oder die Übereinstimmung“ (ebd.). Und schließlich die Klarheit, da dadurch „die Dinge, die eine strahlende Farbe haben“ (ebd.), schön werden.
[...]
[1] Es sei hier anzumerken, dass nicht nur der Einstieg der Frauen in die kämpfende Truppe als essentieller Wandel in der deutschen Bundeswehr angesehen werden kann. Die Konversion der Streitkräfte von einer Verteidigungsarmee zu Zeiten Deutschlands, als Besatzungszone während des Kalten Krieges, in eine Einsatzarmee mit multinationalem Charakter unter NATO- und UN-Führung, muss auch als wesentliches Entwicklungselement verstanden werden.
[2] Freilich ist in der Historie auch von kämpfenden Frauen und Frauenvölkern die Rede (vgl. z.B. Pöllauer 2003). Eine fundamentale Beweisführung, für die Existenz der Amazonen beispielsweise, ist jedoch nicht gegeben. Bewaffnete Frauen waren meist Einzelfälle und hatten keine nennenswerten militärischen Strukturen. Der Bereich der organisierten Streitkräfte sowie Aspekte der Kriegsführung blieben, mit wenigen Ausnahmen, den Männern vorbehalten. Verwiesen sei hier trotzdem auf Kapitel 6, dass sich mit dem Phänomen Frauen und Militär ausgiebig befasst.
[5] Borkenhagen (2001) beschreibt hier vor allem Veränderungen am Körper und die vielfältigen Möglichkeiten seiner Inszenierung. Dazu gehören besonders in der modernen westlichen Zivilisation Tätowierungen, Piercings, Brandings, aber auch chirurgische Eingriffe.
[6] Ein Indiz für die immense Bedeutung von Attraktivität beschreibt Boeree (1999). So werden hübsche Kinder viel öfter von Lehrern bevorzugt als unattraktive Kinder. Lehrer besitzen eine größere Erwartungshaltung den attraktiveren Kindern gegenüber und finden gar Entschuldigungen, wenn diese nicht erfüllt wird. In diesem Zusammenhang nennt Thorndike (1920) den ‚Halo-Effekt’. Demnach bewerten wir ein einzelnes Merkmal oder eine Verhaltensweise eines Individuums positiv oder negativ, was sich wiederum auf alle anderen Merkmale oder Verhaltensweisen dieser Person auswirkt. Die so entstandene Wahrnehmungsverzerrung führt zu einer objektivlosen Beurteilung und Einschätzung, was wiederum bedeutet, dass körperlich attraktivere Personen fälschlicherweise z. B. soziale und emotionale Kompetenzen zugeschrieben werden (vgl. Thorndike 1920).
[7] Es sei überdies erwähnt, dass die anatomischen Unterschiede auch einen biologischen Charakter besitzen (vgl. dazu Kapitel 3).
[8] Riegraf (2005) gibt zu Recht an, dass der Versuch die allgemeine Dimension der Berufswelt geschlechtsspezifisch in ‚männlich’ und ‚weiblich’ zu kategorisieren, vorurteilsbehaftet sei. Auch wenn verinnerlichte Eigenschaften und Kompetenzen einem bestimmten Geschlecht zugeschrieben werden können, sagt das nicht zwingend etwas über die Besetzung eines Berufsfeldes aus. „Die Zuordnung zwischen einem vermeintlich weiblichen oder männlichen Arbeitsvermögen und den jeweiligen Arbeitsinhalten ist sozial konstruiert, keinesfalls selbstverständlich und hochgradig variabel […]“ (Riegraf 2005, S. 138).
[9] Status und Rang sind nach Koppetsch allerdings auch von „performativem Charakter“ (S. 8).
[8] Platons Seelenleben teilt sich in drei Teile, den begierlichen, den muthaften und den geistigen Teil (vgl. Beckers 1997). „Aus dem Verhältnis, der Kultivierung und Lenkung dieser Seelenteile resultiert die individuelle Persönlichkeit und zugleich die Aufgabe, die der individuelle Mensch als Mitglied der Gemeinschaft zu erfüllen hat (Beckers 1997, S. 51).
[9] In seinem wohl bekanntestem Werk, dem Höhlengleichnis beschreibt Platon den mühsamen Weg der Erkenntnis und des Bildungsprozesses durch Abwendung vom Schatten und Hinführung zum Licht, zu den Ideen des Wahren. Die Abbildung des Höhlengleichnisses teilt Platon in sechs Bewusstseinsstadien. Dabei steht das Höhleninnere für den Bereich des Sichtbaren und die Gegend außerhalb für den Bereich des Denkbaren. Das Feuer in der Höhle steht für die Sonne. Die Sonne selbst ist synonym für die ‚Form des Guten’, wie es Platon in seinem Sonnengleichnis darstellt. „Das Sehen in der Höhle entspricht dem Meinungsbild aufgrund von Sinneswahrnehmungen und das Sehen außerhalb der Höhle entspricht der Tätigkeit des erweiterten, abstrakten Denkens. Die Spiegelbilder außerhalb der Höhle stehen für die Mathematik, die nach Platon eine Grundbedingung für philosophisch abstraktes Denken ist. Die Sonne, sprich die ‚Form des Guten’, ist im Höhlengleichnis auf der höchsten Stufe angeordnet und kann erst am Ende eines langen schmerzvollen Weges erreicht werden. Für Platon ist diese Stufe auch nicht jedem vergönnt. Die Menschen stehen im Höhlengleichnis nach Platon nicht für die Menschen selbst, sondern für die Seelen der Menschen, die ihren Grad der Erkenntnis innerhalb seines Gleichnisses selbst wählen können. Platon stellt dar, dass es zum menschlichen Leben gehört, immer nur auf einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit fixiert zu sein und er fragt sich, wo die Möglichkeiten und Grenzen menschlicher Erkenntnis liegen“ (Röder 2000, www).
[10] Zu den grundlegenden Eigentümlichkeiten der Zellen rechnet Faller (1980) drei Hauptaspekte: Den Stoffwechsel und das Wachstum, zum Aufbau der zelleigenen Substanz; Empfindlichkeits- und Bewegungsreize, die von der Zelle aufgenommen, ausgewertet und beantwortet werden; und die Schaffung neuer Entfaltungsmöglichkeiten durch Fortpflanzung.
[11] Faller (1980) unterscheidet die beiden Geschlechter insbesondere durch primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale. Primäre Geschlechtsmerkmale sind die Geschlechtsdrüsen, die „in ihrer Ausbildung von den Geschlechtschromosomen abhängen“ (S. 255). Sekundäre Geschlechtsmerkmale sind abhängig von der Einwirkung der Geschlechtsdrüsen, d. h. sie sind teils geschlechtlicher, teils außergeschlechtlicher Natur. Die Gestaltung der sichtbaren Geschlechtsorgane, die Schambehaarung und der Geschlechtstrieb sind genitaler Natur, während Maßverhältnisse der Körperteile, Verteilung der Fettpolster, Entwicklung der Brustdrüsen, Wachstum des Kehlkopfes, das sexuelle Verhalten und die besondere Affektivität als außergeschlechtliches sekundäres Geschlechtsmerkmal beschrieben werden (vgl. Faller 1980).
[12] Im Laufe der Zeit wurden unter den Philosophen verschiedenste Meinungen und Behauptungen zur Seelenthematik aufgestellt. Die Pythagoreische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele wird bereits von Platon widerlegt und in drei Teile unterteilt, von denen nur die Vernunftseele unsterblich sei. Mehrere Philosophen nehmen materialistische Positionen ein (vgl. de La Mettrie 2001), andere wiederum zweifeln gänzlich an der Existenz einer Seele (vgl. Kant 1986).
[13] In den Kapiteln 2 bis 5 der Genesis im Alten Testament erschuf Gott Adam, den ersten Menschen, aus dem Lehm eines Ackerbodens und aus einer Rippe formte er daraufhin Eva. „Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. […] Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein / und Fleisch von meinem Fleisch. / Frau soll sie heißen, / denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander“ (Die Bibel, Buch Genesis, Kapitel 2). Die Erzählung über den biblischen Schöpfungsbericht enthält gewissermaßen die allererste Diskriminierung der Frau, da sie als schwächer und unwichtiger wie der Mann dargestellt wird.
[14] Für Sigmund Freud lag der entscheidende Wendepunkt in der Entwicklung der Geschlechter im Kastrationskomplex: Somit veranlasst die Kastrationsdrohung durch den Vater den Jungen, den Wunsch, die Mutter genital zu besitzen, aufzugeben (Ödipus-Komplex). Das Ende der ödipalen Phase ist beim Jungen stark mit der Internalisierung elterlicher Wertvorstellungen und einem Aufbau des Über-Ichs verbunden sowie mit der Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. Die Empfindung des Mädchens, kastriert zu sein, führt zu einer Abwendung von der Mutter und zur Zuwendung zum Vater, in der Hoffnung doch einen Penis zu erhalten (Penisneid). Das Erreichen des weiblichen Zustands mündet beim Mädchen in die Identifikation mit der Mutter und damit zur Überwindung der ödipalen Situation (vgl. Freud 1991).
[15] Sex bezieht sich hierbei auf biologisch determinierte Merkmale die Männer und Frauen unterscheiden, nämlich die zur Reproduktion benötigten Geschlechtsteile. Mit gender werden dagegen erlernte geschlechtsbezogene Verhaltensweisen, Stereotype und psychologische Eigenschaften von Männern und Frauen gemeint. Stoller (1968) definiert ausführlicher sex als das biologische Körpergeschlecht, das während der ersten beiden Lebensjahre konfliktfrei entsteht und das sprachlose Erleben, einem Geschlecht anzugehören, beschreibt und gender als den Begriff der Geschlechtsrollenidentität gender role identity oder gender identity, der Ausgestaltung auf höherem symbolischen Niveau.
[16] Ein Geschlecht werden (to become a gender) sowie ständige Akte der Wiederholung (doing gender) bilden für Angerer (1995) die Schlüsselwörter der Geschlechteridentitätsfrage.
-

-
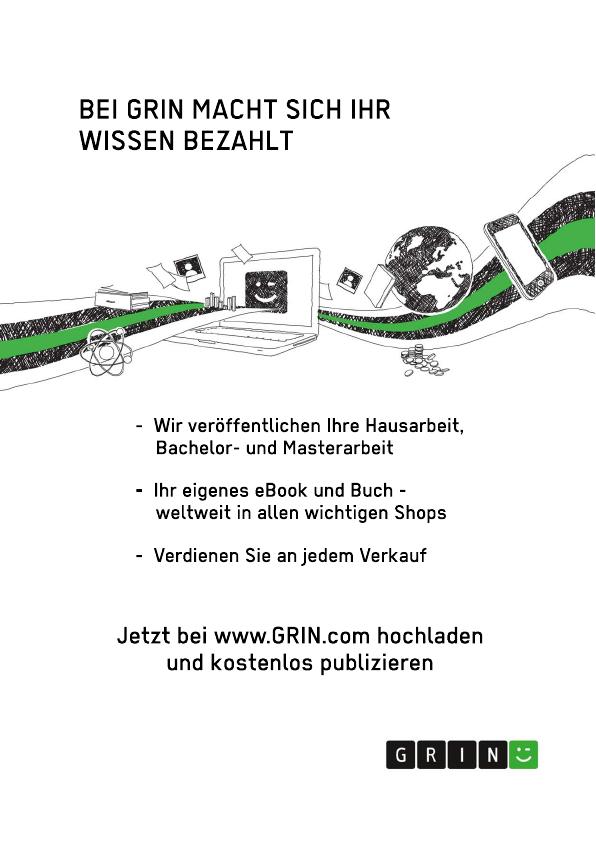
-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.

