In der vorliegenden Diplomarbeit beschäftige ich mich mit geistig behinderten Menschen, die in stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe leben. >Gegenstand< dieser Arbeit sind somit Menschen mit geistigen Behinderungen. Im ersten Kapitel entscheide ich mich für eine potentialorientierte Menschenbildannahme als Grundlage dieser Abeit. Da ein Großteil der erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung in stationären Wohneinrichtungen lebt, ergibt sich die Frage, welche Möglichkeiten oder Angebote für sie bestehen, ihre Lebenswelt >Heim< aktiv zu gestalten. Eine Möglichkeit zur aktiven Gestaltung des Heimalltag für die Nutzer ist durch die ehrenamtliche Mitwirkung in einem gewählten Heimbeirat gegeben. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben. Um diese Fragestellung bearbeiten zu können, wird in Kapitel 3 ein Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen der Heimbeiratstätigkeit angeboten. In Kapitel 4 wird auf die Mitwirkungspraxis eingegangen. Wie sich in Kapitel 4 herausstellt, werden Heimbeiräte derzeit meist gewählt. Hinter dem hohen Insttutionalisierungsgrad verbirgt sich jedoch eine sehr große Heterogenität, wenn nach der Umsetzung der rechtlichen Forderungen gefragt wird. Im Kapitel 4.5 werde ich deshalb auf die Spannungsfelder zwischen den gesetzlchen Vorgaben und der Mitwirkungspraxis eingehen.
Im Zentrum der Heimbeiratsarbeit liegen die gesetzlich vorgeschriebenen Heimbeiratssitzungen. Hier laufen alle >Fäden< zusammen. Auf den regel-mäßigen Treffen werden Informationen ausgetauscht, aktuelle Themen besprochen und Entscheidungen getroffen usw.. In der Praxis werden die Heimbeiratsmitglieder von Mitarbeitern, die sich vorwiegend aus dem Stammpersonal der Einrichtungen rekrutieren, dauerhaft unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt deshalb in der Beantwortung der Frage, welche Bedingungen erfolgreiche Heimbeiratssitzungen fördern. Als erfolgreich werden in diesem Abschnitt solche Bedingungen bezeichnet, die die unterstellten Potentiale der Sitzungsteilnehmer fördern. In Kapitel 5 wer-den Vorschläge zur Gestaltung von Heimbeiratssitzungen gemacht, die dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Menschenbild entsprechen. In Kapitel 5.5 wird ein Beispiel für die praktische Umsetzung angeboten. Die Arbeit schließt in Kapitel 6 mit einer Zusammenfassung und einer abschließenden Betrachtung.
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung und Fragestellung
1. Theoretischer Standpunkt dieser Arbeit
1.1 Anthropologische Grundannahmen
1.1.1 Menschenbildannahmen
1.1.2 Die Verwendung des Begriffs >Menschenbild<
1.2 Pädagogische Grundannahmen
1.2.1 Folgen für die Sichtweise von Behinderung
1.2.2 Konsequenzen für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen
2. Möglichkeiten zur Mitwirkung und Selbstbestimmung in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe
2.1 Der Begriff >Wohneinrichtung<
2.2 Zur Bedeutung von Mitwirkung und Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen
2.2.1 Wohnen unter erschwerten Bedingungen
2.3 Möglichkeiten zur Mitwirkung und Selbstbestimmung im Heimalltag
2.3.1 Mitwirkung und Selbstbestimmung über Heimbeiräte
3. Gesetzliche Rahmenbedingungen der Heimbeiratstätigkeit
3.1 Das neue Heimgesetz
3.2 Die neue Heimmitwirkungsverordnung
3.2.1 Begriffbestimmung >Heimbeirat<
3.2.2 Begriffsbestimmung >Mitwirkung<
3.2.3 Tätigkeiten und Aufgaben des Heimbeirates
3.2.4 Bildung des Heimbeirates / alternative Mitwirkungsformen
4. >Mitwirkungspraxis< in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe
4.1 Mitwirkungsformen
4.2. Heimaufsichtsbehörden
4.3 Unterstützung durch Einrichtungsträger
4.3.1 Kostenübernahme der Heimbeiratstätigkeit
4.3.2 Personelle Unterstützung des Heimbeirates
4.3.2.1 Aufgabenbereiche der Unterstützungspersonen
4.4 Konkrete Inhalte der Heimbeiratstätigkeit
4.4.1 Heimbeiratssitzungen
4.4.2 Mitwirkungsbereiche
4.5 Spannungsfelder zwischen gesetzlichen Vorgaben und Mitwirkungspraxis
5. Gelingensbedingungen für die erfolgreiche Gestaltung von Heimbeiratssitzungen
5.1 Carl Rogers – Klientenzentrierte Gesprächspsychologie
5.2 Ruth Cohn – Themenzentrierte Interaktion (TZI)
5.3 Friedemann Schulz von Thun – Kommunikationspsychologie
5.4 Konsequenzen für die Gestaltung von Heimbeiratssitzungen
5.4.1 Gruppenregeln und visualisierte Symbole
5.4.2 Aufgabenverteilung
5.4.3 Einfachheit, Verständlichkeit und angemessenes Tempo
5.4.4 Selbstkundgabe
5.4.5 Innere Einstellung bzw. Haltung
5.5 Beispiel für die praktische Umsetzung
5.5.1 Tagesordnung
5.5.2 Unterstützende Hilfsmittel
5.5.2.1 Der Sprechball
5.5.2.2 Aufgabenverteilung durch Aufgabenkarten
5.5.2.3 Mottokarten
6. Abschließende Zusammenfassung
7. Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zusammensetzung des Heimbeirats
Abbildung 2: Mitwirkungsformen in Heimen
Abbildung 3: Globe / Kugel nach COHN (verändert)
Abbildung 4: Das Kommunikationsquadrat
0. Einleitung und Fragestellung
In der vorliegenden Diplomarbeit beschäftige ich mich mit geistig behinderten Menschen, die in stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe leben. >Gegenstand< dieser Arbeit sind somit Menschen mit geistigen Behinderungen.[1] Da im weiteren Verlauf Vorschläge zum pädagogischen Umgang mit diesen Menschen gemacht werden sollen, ist es notwendig, dass ich mein Gegenstandsverständnis kläre. Im ersten Kapitel entscheide ich mich für eine potentialorientierte Menschenbildannahme als Grundlage dieser Arbeit. Nach diesem Verständnis bestehen zwischen geistig behinderten und nichtbehinderten Menschen insofern keine prinzipiellen Unterschiede, da beide ihre Umwelt subjektiv wahrnehmen. Je nach ihrem Erfahrungshintergrund entwickeln sie Pläne und orientieren die Handlungen dementsprechend. Beide, d.h. geistig behinderte und nichtbehinderte Menschen haben gleichermaßen das Bedürfnis oder den Wunsch und deshalb auch das Recht, ihre Lebenswelt aktiv zu gestalten. Da ein Großteil der erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung in stationären Wohneinrichtungen lebt, ergibt sich die Frage, welche Möglichkeiten oder Angebote für sie bestehen, ihre Lebenswelt >Heim< aktiv zu gestalten.
Eine Möglichkeit zur aktiven Gestaltung des Heimalltag für die Nutzer ist durch die ehrenamtliche Mitwirkung in einem gewählten Heimbeirat gegeben. Diese Form der Bewohnerbeteiligung ist prinzipiell für alle stationären Wohneinrichtungen, die sich nach dem Heimgesetz als Heim definieren, gesetzlich vorgeschrieben. In der Heimmitwirkungsverordnung werden die Vorschriften des Heimgesetzes konkretisiert. So haben Heimbeiräte als Bindeglied zwischen Heimbewohnern und Einrichtungsträger die Interessen und Belange der Mitbewohner zu vertreten. Einrichtungsträger haben einen Heimbeirat z.B. personell zu unterstützen, ihn rechtzeitig mit mitwirkungsrelevanten Informationen zu versorgen und die Kosten der Heimbeiratstätigkeit zu übernehmen. Die Heimaufsichtsbehörden, als gesetzüberwachende Instanz, sind verpflichtet Heimbeiräte aktiv zu beraten. Hier stellt sich die Frage, wie die gesetzlichen Vorgaben von den Mitwirkungsakteuren in der Praxis, d.h. in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe umgesetzt wird. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt deshalb in der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben. Um diese Fragestellung bearbeiten zu können, wird in Kapitel 3 ein Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen der Heimbeiratstätigkeit angeboten. In Kapitel 4 wird auf die Mitwirkungspraxis eingegangen. Wie sich in Kapitel 4 herausstellt, werden Heimbeiräte derzeit meist gewählt. Hinter dem hohen Institutionalisierungsgrad verbirgt sich jedoch eine sehr große Heterogenität, wenn nach der Umsetzung der rechtlichen Forderungen gefragt wird. Im Kapitel 4.5 werde ich deshalb auf die Spannungsfelder zwischen den gesetzlichen Vorgaben und der Mitwirkungspraxis eingehen.
Im Zentrum der Heimbeiratsarbeit liegen die gesetzlich vorgeschriebenen Heimbeiratssitzungen. Hier laufen alle >Fäden< zusammen. Auf den regelmäßigen Treffen werden Informationen ausgetauscht, aktuelle Themen besprochen und Entscheidungen getroffen usw.. In der Praxis werden die Heimbeiratsmitglieder von Mitarbeitern, die sich vorwiegend aus dem Stammpersonal der Einrichtungen rekrutieren, dauerhaft unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt deshalb in der Beantwortung der Frage, welche Bedingungen erfolgreiche Heimbeiratssitzungen fördern. Als erfolgreich werden in diesem Abschnitt solche Bedingungen bezeichnet, die die unterstellten Potentiale der Sitzungsteilnehmer fördern. In Kapitel 5 werden Vorschläge zur Gestaltung von Heimbeiratssitzungen gemacht, die dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Menschenbild entsprechen. In Kapitel 5.5 wird ein Beispiel für die praktische Umsetzung angeboten. Die Arbeit schließt in Kapitel 6 mit einer Zusammenfassung und einer abschließenden Betrachtung.
1. Theoretischer Standpunkt dieser Arbeit
Nach SCHLEE (1998, S. 2) kann davon ausgegangen werden, dass das Verständnis darüber wie Menschen prinzipiell >funktionieren<, pädagogisches Denken und Handeln nachhaltig beeinflusst. Es ist deshalb wichtig, dieses Verständnis darzulegen. In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen beschrieben, welche die Basis für spätere Überlegungen und Konsequenzen zur erfolgreichen Heimbeiratsarbeit bilden.
1.1 Anthropologische Grundannahmen
In diesem Abschnitt steht das Menschenbild dieser Arbeit, d.h. die anthropologische Frage, >wie entwickelt sich, bzw. wie funktioniert der Mensch<, im Vordergrund. Dazu ist es notwendig, bereits bestehende anthropologische Grundannahmen zu skizzieren.
1.1.1 Menschenbildannahmen
Menschenbilder sind mehr oder weniger bewusste Annahmen wie Menschen >gestrickt< sind, bzw. >funktionieren< . Es sind Unterstellungen und somit (Vor-)Urteile, wie Menschen sind oder sein sollten, warum sie so und nicht anders handeln, wie sie sich entwickeln und verändern, bzw. welche Chancen ihnen dabei eingeräumt werden. Diese (Wert-)Vorstellungen bilden die Grundlage für alle weiteren Handlungen, Überlegungen oder Konzepte.
1.1.2 Die Verwendung des Begriffs >Menschenbild<
Das behavioristische und das handlungsorientierte Modell
In der Literatur wird u.a. zwischen dem behavioristischen und dem epistemologischen Menschenbild unterschieden.
Gegenstand des Behaviorismus ist das Verhalten. Von Interesse ist deshalb nur das von außen sicht- oder messbare Verhalten. Im klassischen Behaviorismus wird der Mensch als ein von außen steuerbares Wesen, d.h. auf äußere Reize reagierend, verstanden. Untersucht werden deshalb nur die Zusammenhänge zwischen einem äußeren Reiz und einer beobachtbaren Reaktion. Lernprozesse werden daher durch Verhaltensbeobachtung erklärt. Empirische Untersuchungen zum Lernen durch positive Verstärkung bzw. Bekräftigung zeigen jedoch, dass beispielsweise Schüler ihr Lob durch Lehrer durchaus subjektiv interpretieren. Sie setzen es in Beziehung mit ihren eigenen Bewertungsmaßstäben von Leistungen und schätzen die Wirkung auf die übrige Klasse ein (vgl. GUDJONS, 1999, S. 219). Schüler denken also darüber nach, was positive Verstärkung ist und richten ihr Handeln entsprechend aus. Genau dieser Aspekt wird beim epistemologischen Menschenbild betont. Hier wird menschliches Handeln als absichtsvolle und sinnvolle Verhaltensweise verstanden. Im Gegensatz zum behavioristischen Menschenbild werden dem Menschen „...Sinn, Wille und Motiv als Handlungsgründe...“ unterstellt (GUDJONS, 1999, S. 220). Wenn Menschen handeln, so wägen sie zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten ab. Sie verfolgen dabei ein bestimmtes Ziel und gestalten ihr Handeln entsprechend ihrer eigenen Logik. So wird der Mensch als aktiver „... (Um)Gestalter der Umwelt nach eigenen Handlungsabsichten und –plänen...“ gesehen (LENZEN, 1998, S. 1006).
GROEBEN (1988, S. 185) fasst den Unterschied zwischen behavioristischem Verhaltens- (im folgenden als Verhaltensmodell bezeichnet) und epistemologischem Handlungsmodell (im folgenden als Handlungsmodell bezeichnet) so zusammen: „Im Gegensatz zum „Handeln“ unterstellt „Verhalten“ keine (bewußte oder unbewußte) Intentionalität... .“
Das Handlungsmodell des Forschungsprogramms Subjektive Theorien
Nach dem Handlungsmodell wirken äußere Reize nicht direkt auf Menschen ein. Umwelteinflüsse werden vielmehr vom Menschen wahrgenommen, interpretiert, gewichtet und bewertet, wodurch sie eine persönliche Bedeutung bekommen und Handlungen auslösen. Menschliches Handeln wird somit von internen Vorstellungen und Überlegungen, so genannten Subjektiven Theorien gesteuert. Sie dienen zur Erklärung der Voraussage über die Umwelt und bilden damit die Grundlage menschlichen Handelns. Subjektive Theorien können deshalb auch als stellvertretendes Handeln bezeichnet werden. Im Forschungsprogramm Subjektive Theorien, von GROEBEN und SCHEELE (1977) bzw. GROEBEN (1986), werden dem Menschen hierfür folgende Potentiale unterstellt:
- Reflexivität (d.h. die Fähigkeit sich selbst wahrnehmen zu können, des Nachdenkens über sich selbst bzw. das Potential, sich von sich selbst zu distanzieren und somit zum Objekt eigener Gedanken zu machen)
- Autonomie (d.h. die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Handeln bzw. eigenständige Entscheidungen treffen zu können)
- Rationalität (d.h. die Fähigkeit zu einem stimmigen Verhältnis von Denken, Fühlen und Handeln bzw. >richtige< oder >vernünftige< Entscheidungen für sich treffen zu können)
- Kommunikation (d.h. die Fähigkeit sich durch Sprache, Mimik und / oder Gestik mitteilen zu können (vgl. GROEBEN, 1988 S. 16).
Zieldimensionen
Mit dem Hinweis auf den Alltag schränkt SCHLEE (1998, S. 39) ein, dass Menschen ihre Potentiale nicht immer realisieren können und in ihrem „... Handeln häufig unter ihren Möglichkeiten bleiben...“. Sein Ziel ist deshalb, „... dass Menschen befähigt werden, ihre Potentiale immer häufiger, in immer mehr Situationen in immer größerem Ausmaß zu verwirklichen.“ (SCHLEE, 1998, S. 40). Zu der Annahme, wie Menschen sind (nämlich, dass sie prinzipiell über diese Fähigkeiten verfügen) kommt die Beschreibung, wie sein sollten: Zunehmend reflexiver, autonomer, rationaler und kommunikativer.
Nach dem epistemologischen Handlungsmodell des Forschungsprogramms Subjektive Theorien werden die unterstellten Potentiale nicht wertneutral, sondern als „... positive Zieldimension konstruktiver Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen postuliert.“ (ebd., S. 16).
Parallelitätsannahme
Nach den Grundannahmen des Handlungsmodells wird der Alltagsmensch in Parallelität zum Selbstbild des Wissenschaftlers entworfen. Beide werden als Theoriekonstrukteure und Theoriebenutzer gesehen (vgl. GROEBEN, 1988, S. 16). Diese Annahme geht auf KELLY (1955) zurück. In seiner Psychologie der persönlichen Konstrukte ging er davon aus, dass Alltagsmenschen und Wissenschaftler nach den gleichen Grundprinzipien >funktionieren<. Die Übereinstimmung besteht darin, dass Alltagsmenschen und Wissenschaftler gleichermaßen Theorien zur Erklärung und Voraussage von Sachverhalten bilden. Sie leiten Handlungsprinzipien ab, die immer wieder überprüft und ggf. verändert werden. Im Unterschied zu den Alltagsmenschen erheben Wissenschaftler in ihren Theorien den Anspruch auf Objektivität. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit soll dabei durch methodisches Vorgehen gesichert werden, d.h. jeder soll unter vergleichbaren Bedingungen zu denselben Ergebnissen kommen. Für Alltagsmenschen, die oft unter größerem Handlungsdruck stehen und Entscheidungen sofort fällen müssen, kann dies hingegen nicht gelten. Ihre Theorien sind deshalb tendenziell unsachlich und subjektiv, d.h. sie werden von persönlichen Bewertungen, Gefühlen, Interessen, Vorurteilen usw. beeinflusst. Dennoch >funktionieren< nach dem Handlungsmodell Alltagsmenschen und Wissenschaftler nach den gleichen Grundprinzipien. Man spricht deshalb von der Parallelitätsannahme.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das epistemologische Menschenbild auf alle Menschen übertragen lässt. Da laut GROEBEN (1988, S. 61) hingegen der „...Behaviorist ... nicht in der Lage [ist], sein Forschen mit der eigenen Theorie zu erklären“, somit voneinander getrennte Menschenbildannahmen und Wertvorstellungen zugrunde legt und den Menschen auf ein reines sich verhaltendes Reiz-Reaktionswesen reduziert, erscheint mir das epistemologische Handlungsmodell des Forschungsprogramms Subjektive Theorien als die geeignetere Basis für die Beantwortung der für diese Arbeit relevanten Fragen. Die anthropologische Frage: „Wie entwickelt sich der Mensch? und hier: Welche Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten haben Menschen mit einer Behinderung und welche gestehen wir ihnen zu?“, wird in dieser Arbeit deshalb mit dem epistemologischen Menschenbild beantwortet und diese bildet die Grundlage für alle weiteren Überlegungen.
1.2 Pädagogische Grundannahmen
Werden die oben beschriebenen - aus der humanistischen Psychologie stammenden – Annahmen in die Pädagogik übertragen, so ergeben sich Konsequenzen für die Sichtweise und den Umgang mit behinderten Menschen. In den folgenden Punkten werde ich hierauf eingehen.
1.2.1 Folgen für die Sichtweise von Behinderung
GIESE (2002, S. 186) weist darauf hin, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung „... durchaus über eine ausreichende Sprach- und Kommunikationskompetenz, Reflexivität, potentielle Rationalität sowie Handlungsfähigkeit verfügen“. Sie besitzen somit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Fähigkeit, über sich nachzudenken, mit anderen Kontakt aufzunehmen und selbstverantwortlich zu handeln. Sie nehmen ihre Umwelt subjektiv wahr und entwickeln, je nach ihrem Erfahrungshintergrund, Pläne und orientieren die Handlungen entsprechend (vgl. ebd., S 186). Nach SCHLEE (1992, S. 151) bestehen somit „ ... keine prinzipiellen Unterschiede zwischen behinderten und nicht-behinderten Menschen ... .“ Wenn angenommen wird, dass alle Menschen grundsätzlich gleich >funktionieren< sind die Unterschiede nicht prinzipieller, sondern gradueller Art. So differieren, bedingt durch die Subjektivität, z.B. menschliche Sichtweisen, individuelle Bedürfnisse, Vorlieben oder (Ab-)Neigungen. Auch die Ausprägungsgrade der unterstellten Entwicklungspotentiale können unterschiedlich ausfallen. Die Frage ist dann nicht, ob jemand sinnvoll handeln kann, sondern inwieweit und unter welchen Bedingungen die vorhandenen Fähigkeiten erweckt werden (können).[2] Für SIEGENTHALER (1993, S. 74, zit. n. CRÖSSMANN, 2002, S. 456) hat das Aufdecken von „... allen Menschen gemeinsamen Grundstrukturen ... etwas unerhört befreiendes, weil in ihnen die Möglichkeit steckt, alle individuellen Schattierungen, die voreinander aufbauen, zu übersteigen.“.
Wenn die Betrachtung, wie oben beschrieben wurde, darauf gelenkt wird, „... welche Merkmale allen Menschen zu eigen sind, kann Abstand genommen werden von der Defizitperspektive. Dies kann nur dann gelingen, wenn der Blick weg von den Unterschieden, hin zu den Gemeinsamkeiten gelenkt wird ... .“ (ebd. S. 456). SPECK (1993, S. 248) spricht von dem, was Menschen „verbindet“, d.h. von den Gefühlen der „Freude ... Liebe, Auftrieb, Zuversicht, Vertrauen, Beglücktsein.“ In diesem Zusammenhang können, neben einer Vielzahl subjektiv bedingter Bedürfnisse oder Neigungen, dennoch verbindende Grundbedürfnisse angenommen werden. Als Beispiele können die Bedürfnisse nach Sicherheit und Geborgenheit, nach Liebe und Zugehörigkeit, nach Verantwortung, Status und Anerkennung, nach Selbstverwirklichung usw. genannt werden (vgl. MICROSOFT ENCARTA 98 ENZYKLOPÄDIE, Stichwort "Motivation").
So resümiert HINZ (1991, S. 126), die Pädagogik brauche keinen Behinderungsbegriff, wenn sie die Vielfalt dieser Menschen als >Normalität< betrachten würde, sie „als Quelle gegenseitiger Anregung zu nutzen sucht und das bisherige Lernen im Gleichschritt aufgibt; wenn sie ihren Blick auf Fähigkeiten statt auf Defizite, Defekte und Probleme richtet...“.
1.2.2 Konsequenzen für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen
Auf den ersten Blick mag es unrealistisch oder praxisfremd wirken, wenn auch Menschen mit (schwerer) geistiger Behinderung die tendenzielle Fähigkeit zum reflexiven, kommunikativen, autonomen und rationalen Handeln unterstellt wird. Wird ein Mensch mit geistiger Behinderung aber aus einem defizitorientierten oder defektologischen Blickwinkel betrachtet und gefördert, so besteht laut THEUNISSEN (1995, S. 61) die Gefahr, „... daß er in einen Teufelskreis gerät, sich so verhält, wie es von seinem Nicht-Können her erwartet wird.“ Entwicklungschancen würden verschenkt, d.h. Wachstum würde, im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, nicht über die fremdbestimmten Grenzen hinaus kommen können.
Defizitäre Betrachtungsweisen
Als weiterer Aspekt aus der defizitären Betrachtungsweise ergibt sich die >erlernte Hilflosigkeit<. Durch die Weigerung, Menschen mit geistiger Behinderung über ihre Belange selbst entscheiden zu lassen, da man ihnen derartige Entscheidungen schlichtweg nicht zutraut, wird ihnen die Chance zum selbstbestimmten Handeln von vornherein genommen. Aus dieser verordneten Fremdbestimmung heraus wird Selbstbestimmung als sinnlos empfunden, weshalb die Betroffenen immer passiver werden und somit permanente Hilfe, im Sinne einer „erlernten Hilflosigkeit“ einfordern (SELIGMAN, 1986, zit. n. THEUNISSEN, 1995, S. 60). Vor diesem Hintergrund gilt es dagegen besonders, Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht zu überfordern, d.h. ihre „... berechtigten Bedürfnisse nach Schutz und Hilfe“ anzuerkennen und ihre Potentiale zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu erwecken und nicht in utopischer Weise einzuschätzen (THEUNISSEN, 1995, S. 20). Somit ist das handlungsorientierte Menschenbild keine Garantie, zu hohe bzw. unrealistische Ziele zu erreichen. Es kann jedoch dazu beitragen, „... tatsächlich vorhandene Grenzen ... so weit als möglich hinauszuschieben.“ (SCHLEE, 1992, S. 151).
Parallelitätsannahme in der Pädagogik
Überträgt man die Parallelitätsannahme in die Pädagogik, so >funktionieren< Pädagogen und deren Adressaten nach den gleichen Grundprinzipien. SCHLEE (1999, S. 20) nimmt deshalb an, „... dass alles, was diese fördert, prinzipiell auch jene unterstützt. Und was diese beeinträchtigt, wird prinzipiell auch jenen nicht nützen.“ Im Hinblick auf das pädagogische Selbstanwendungsprinzip lässt sich daraus schließen, „... dem anderen nicht etwas zuzumuten, was man für sich selbst und seine Position als nicht gerecht empfinden würde.“ (GROEBEN, 1988, S. 116). Für Pädagogen und ihr Klientel gilt dann das gleiche Menschenbild, durch das hierarchischen Unterteilungen in >Wir – Die< bzw. >Behinderte – Nichtbehinderte< in Richtung einer symmetrischen oder gleichberechtigten Beziehung entgegengewirkt werden kann. Es sind deshalb nur solche Begriffe und Methoden anzuwenden, die Pädagogen für sich selbst akzeptieren würden und umgekehrt.
Behinderte und Nichtbehinderte als subjektive Theoretiker
Wenn angenommen wird, dass Behinderte und Nichtbehinderte gleichermassen „... ihre eigene subjektive Wahrheit“ entwickeln , so besteht eine Vielfalt von individuellen Sichtweisen oder Haltungen nebeneinander, ohne dass letztlich entschieden werden kann, wessen Wahrheit die bessere oder richtige ist (SCHLEE, 1998, S. 44). Wenn niemand im Besitz der >Wahrheit< ist, so ist Respekt und Toleranz vor anderen Haltungen oder Meinungen geboten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass andere Handlungen und Sichtweisen akzeptiert oder als korrekt beurteilt werden müssen. Respekt und Toleranz des einen enden dort, wo die Freiheit des anderen, d.h. die Menschenrechte bzw. die „Grundwerte von Interaktion und sozialem Austausch“ verletzt werden (HERRIGER, 2002, S. 74, zit. n. THEUNISSEN, 2003, S. 59). Hier muss es dann darum gehen, den subjektiven Sinn zu verstehen, um gemeinsam andere Wege zu finden, bevor notfalls „unmissverständlich Grenzen“ zu setzen sind (ebd., S. 59). Das bedeutet aber gleichzeitig, „... daß Verhaltensweisen, die Menschen entwickeln (egal wie „verrückt“ wir sie vielleicht finden), immer auf vernünftigen Entscheidungen basieren.“ (DEHLFING, 1997, S. 235)
Verstehen
„Alle Aussagen nicht geistig behinderter Personen über den geistig behinderten Menschen sind... nur mit Vorbehalt adäquate Aussagen“ (SPECK, 1993, S. 43). Da nach dem Menschenbild dieser Arbeit alle Menschen als prinzipiell auskunftsfähig bezeichnet werden können, ist die Rekonstruktion bzw. Interpretation des Sinns einer Handlung im Dialog mit der betreffenden Person anzustreben. Das gegenseitige Verstehen rückt so in den Mittelpunkt, welches vielfach deshalb scheitert, „... weil wir Nicht-Geistigbehinderten Schwierigkeiten haben, ihn zu verstehen ... dann [ist] allzu leicht die Rede davon, geistig behinderte Menschen seien nicht kommunikationsfähig.“ (SPECK, 1993, S. 124).
Lernen als Veränderung von Subjektiven Theorien
In der Pädagogik geht es, ganz allgemein formuliert darum, menschliche „... Vorstellungen, Gewohnheiten, Einstellungen, Verhaltensweisen und Fähigkeiten aufzubauen bzw. zu verändern.“ (GIESECKE, 1999, S. 48). Dies beinhaltet, dass allen Menschen grundsätzlich das Potential zur Veränderung, d.h. die Fähigkeit zum (Um-)Lernen, positiv zugesprochen wird.
Diese Annahme findet sich auch im Handlungsmodell wieder. Lernen wird hier als Veränderung von Subjektiven Theorien bezeichnet. Wenn Menschen als prinzipiell autonom entworfen werden und selbst darüber entscheiden können, was z.B. sinnvoll ist und was nicht, so bedeutet das, dass Außenstehende keinen direkten Einfluss oder Zugriff auf die Veränderung von Subjektiven Theorien haben: Nur „... die Subjektive Theoretikerin selbst kann ihre Subjektiven Theorien verändern“ (SCHLEE, 1999, S. 21). Wenn kein direkter Einfluss auf die Veränderung oder Entwicklung von Menschen mit einer geistigen Behinderung besteht, so bleibt nur die Möglichkeit, die äußeren Bedingungen zu verändern. Es gilt daher, ein Umfeld oder einen Raum zu schaffen, in dem die Potentiale zum aktiven Handeln erweckt bzw. gefördert und nicht eingeschränkt werden; in dem aktives Handeln angeregt, erprobt und gegebenenfalls verändert werden kann.
2. Möglichkeiten zur Mitwirkung und Selbstbestimmung in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe
Die HEIMSTATISTIK 2001 (BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND, 2001) nennt im gesamten Bundesgebiet 4.107 Heime der Behindertenhilfe mit insgesamt 160.346 Plätzen für erwachsene Menschen mit einer Behinderung. In Niedersachsen gab es 469 Einrichtungen mit 21.283 Wohnplätzen. DÖRNER (2002, S.4) geht davon aus, dass „... im Bereich der Eingliederungshilfe über 95% der Kosten auf den stationären Bereich entfallen ... .“
Wenn angenommen wird, dass stationäre Wohnformen dominieren, so ist im Hinblick auf das in dieser Arbeit verwendete Menschenbild zu fragen, welche Möglichkeiten oder Angebote für die Nutzer bestehen, ihre Lebenswelt aktiv zu gestalten, inwieweit sie im Heimalltag mitbestimmen oder an Entscheidungen beteiligt werden und mitwirken können. Bevor auf diese Frage eingegangen wird, soll jedoch der Begriff >Wohneinrichtung< näher bestimmt werden.
2.1 Der Begriff >Wohneinrichtung<
In der Behindertenhilfe sind verschiedene Wohnformen für volljährige Menschen mit Behinderungen bekannt. Diese können in Angebote, die einen selbständigeren Lebensstil einfordern bzw. ermöglichen (ambulante Wohnformen) und solche, die eine stärkere Betreuung (stationäre Angebote) bieten, unterteilt werden (vgl. CRÖSSMANN, 2002, S. 56). Während bei den ambulanten Angeboten, wie z.B. dem Betreuten oder Unterstützten Wohnen, der Nutzer in seiner eigenen gemieteten Wohnung bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nimmt, stellen Träger von stationären Wohneinrichtungen, wie es z.B. in (Wohn-)Heimen mit Wohngruppen der Fall ist, den Wohnraum, das Betreuungspersonal und die Verpflegung als ein Pauschalangebot zur Verfügung (vgl. BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE E.V., 2003, S. 26). Diese Einrichtungen werden aus gesetzlicher Sicht i.d.R. als Heime definiert. Sie müssen deshalb die Auflagen des Heimgesetzes erfüllen.
Die Begriff >Heim< teilt dem >Bewohner< eine eher passive oder hilfsbedürftige Rolle in einer beschützenden oder verwahrenden Lebenswelt zu. Durch die neuere Bezeichnung >(Wohn-)Einrichtung< wird dieses Bild im Alltagsdenken weniger stark transportiert. Die Begriffe >Nutzer<, >Wohnpartner<, >Kunde< usw. symbolisieren im Alltagsdenken einen eher aktiven und nicht primär abhängigen Menschen. Da diese Begrifflichkeiten (noch) nicht in die Gesetzestexte übernommen wurden und im weiteren Verlauf dieser Arbeit daraus zitiert werden wird, halte ich die parallele Verwendung von Heim und (Wohn-)Einrichtung in dieser Arbeit für angemessen.
2.2 Zur Bedeutung von Mitwirkung und Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen
Wenn das Ziel darin besteht, dass „... Mitbürger mit geistigen oder körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen ... ein Leben führen können, das dem ihrer nichtbeeinträchtigten ... Mitbürger entspricht...“, so gebietet es zugleich diesen Menschen keinen besonderen Status oder Raum ausserhalb der Gesellschaft zuzuteilen (THIMM, 1995, S. 1). Vielmehr gilt es, ihre Lebensverhältnisse oder -bedingungen an die Standards aller Gesellschaftsmitglieder anzugleichen. Hier ergibt sich nach WACKER (vgl. 1998, S. 20) ein allgemeiner gesamtgesellschaftlicher Standard hinsichtlich der Versorgung, wie z.B. der materiellen Ressourcen, der Bildungsmöglichkeiten, der Wohnbedingungen, der medizinischen und pflegerischen Versorgung, der Beschäftigungs- oder Arbeitsmöglichkeiten, usw.. Normativ betrachtet lassen sich Standards hinsichtlich gesamtgesellschaftlicher Werte und Leitideen ausmachen. Hierzu zählen beispielsweise die Grundrechte, d.h. die Würde, die Privatsphäre und die Freiheitsgrade und Selbstbestimmung des Menschen in den verschiedenen Lebensbereichen, wie z.B. dem Wohnen (vgl. ebd., S. 20).
Wohnen ist „... die Manifestation eines menschlichen Grundbedürfnisses ... .“ (LENZEN, 1998, S. 1627). Dies ist für Menschen mit einer wohnzentrierten Lebensweise, wie z.B. für Menschen mit geistiger Behinderung oder alte Menschen, Hausfrauen und kleine Kinder, für die die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellt, von besonderer Bedeutung. Entsprechend hoch sollte die Selbstbestimmung, zumindest aber die Mitwirkung, d.h. die aktiven Beteiligungsmöglichkeiten an Entscheidungen, die das Wohnen im Heim betreffen, eingeschätzt werden. Das bedeutet umso mehr, dass hierbei die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten , „... bei der Frage, wie man wohnen will, die Nichtbehinderte für sich selbstverständlich in Anspruch nehmen, auch für Menschen mit Behinderung möglich werden müssen.“ (WACKER, 1998, S. 21).
Nachdem kurz auf die Bedeutung von Selbstbestimmung und Mitwirkung beim Wohnen für Menschen mit Behinderung eingegangen wurde, werden im Kapitel 2.2.1 einige gesamtgesellschaftliche Wohnaspekte den Wohnbedingungen in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe gegenübergestellt .
2.2.1 Wohnen unter erschwerten Bedingungen
Wohnen als elementares Grundbedürfnis
„Wohnen befriedigt ein elementares menschliches Grundbedürfnis nach Geborgenheit, Sicherung vor Witterung und Anfeindungen. Die eigenen „vier Wände“ bieten Schutz vor den Anderen, vor sozialer Kontrolle, vor Einmischungen ins eigene Leben. Sie stellen „den passenden Rahmen“ für einen eigenen Lebensstil dar.“ (ebd., S. 22).
Die Bedürfnisse nach Sicherheit und Geborgenheit, nach einer störungsfreien Privat- oder Intimsphäre, nach Liebe, Sexualität und Anerkennung, nach Entspannung und Erholung, nach Freizeitgestaltung, nach Selbstverwirklichung usw. werden in der Wohnung befriedigt (vgl. BADER, 1997, S. 41). Die Wohnung bietet die Möglichkeit Individualität auszuleben, schafft Rückzugsmöglichkeiten, „... ist der Ort maximaler individueller Souveränität und persönlicher Integrität. Freiräume für Selbstdarstellung für Emotionen ohne soziale Kontrolle ... sind ... in besonderer Weise gegeben.“ (WACKER, 1998, S. 22). Die Wohnung kann als ein Kernstück des Lebens bezeichnet werden. Von ihr gehen alle Aktivitäten, wie z.B. das Einkaufen, Arbeiten usw. aus.
Werden diese Aspekte nun auf die Lebensbedingungen von Menschen in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe übertragen, so entstehen u.a. folgende Fragen: Können sie ihre Wohnung auswählen? Werden Wohnalternativen angeboten? Wird Ihnen ein Mitspracherecht eingeräumt, wenn es z.B. darum geht das eigene Zimmer oder die übrigen Räume einer Wohngruppe zu gestalten? Haben sie einen Einfluss darauf, mit wie vielen und welchen Menschen sie zusammen wohnen? Werden sie an der Entscheidung beteiligt, wer sie in ihrem Alltag unterstützt? Nach welchem Menschenbild richten dann die Mitarbeiter ihr Handeln aus? Ist dies defizit- oder entwicklungsorientiert? Wer bestimmt die Aufgaben und Regeln des Miteinanders, die Sozialkontakte und den Tagesablauf? Wird ihnen eine Privat- oder Intimsphäre geboten? Haben sie eine Möglichkeit ihre Freizeit individuell zu gestalten?
Erschwerte Wohnbedingungen in Wohngruppen
SCHWARTE/OBERERSTE-UFER (1997, S. 41) berichten, dass Menschen aufgrund eines hohen pflegerischen und lebenspraktischen Hilfebedarfs in der Regel in Heime eingewiesen werden. Eine Wahlfreiheit hinsichtlich alternativer Wohnformen, wie z.B. dem betreuten Wohnen, besteht für diesen Personenkreis demnach nicht. Nach wie vor dominiert das klassische Wohnheimmodell mit Wohngruppen. Es werden z.B. bei „... der Einstellung von Beschäftigten ... die Bewohner(innen) in der Regel in keinster Weise konsultiert, obwohl sie es sind, die mit den neuen Beschäftigten unter Umständen für lange Zeit leben müssen.“ (MILES-PAUL, 1999, S. 223) Ein Mitspracherecht, welcher Mitarbeiter sie betreut oder betreuen wird, besteht tendenziell nicht. Der Begriff Wohngruppe signalisiert im Gegensatz zum Begriff Wohngemeinschaft bereits, dass die Mitglieder keinen oder nur geringen Einfluss auf die Zusammensetzung der Gruppe haben (vgl. SCHWARTE/OBERSTE-UFER, 1997, S 184). Das unter diesen erschwerten Bedingungen „Reibereien ... im täglichen engen Zusammenleben in der Zwangsgemeinschaft immer wieder den Ton ...“ angeben, ist nachvollziehbar (WACKER, 1999, S. 246).
Eingeschränkte Privatsphäre in Wohneinrichtungen
Wird der Blick auf die Privatsphäre gerichtet, so wird ein weiterer Unterschied zu den gesamtgesellschaftlichen Wohnbedingungen deutlich: „So können Menschen, die in einem Wohnheim leben, das Schutzrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes rein rechtlich nicht in Anspruch nehmen, denn ein Heimplatz gilt nicht als Wohnung.“ (SCHWARTE/OBERSTE-UFER, 1997,S. 207). Das Recht auf Privatheit ist, verglichen mit >normalen< Mietverhältnissen, in denen der Mieter als >Hausherr< mit der Achtung seiner Privatsphäre usw. unbedingt rechnen kann, stark eingeschränkt. Betrachtet man die baulichen Standards und Strukturen, so besteht lediglich für ca. 38% geistig behinderter Heimbewohner die Möglichkeit, in einem Einzelzimmer zu leben (WACKER, 1998, S. 88). Und: „Selten finden sich Bad oder Dusche in Bewohnerzimmern ... Ähnliches läßt sich über die Ausstattung mit einer eigenen Toilette sagen.“ (ebd., S. 89). Während sich ein gesamtgesellschaftlicher Trend hin zur Individualisierung vollzogen hat, ist hingegen die eingeschränkte Privatsphäre in vielen Wohneinrichtungen ein deutlich sichtbares Manko.
Fremdorganisierte und verordnete Lebensbedingungen
Sicher sind „Strukturverbesserungen der organisierten Wohnwelten“, wie z.B. die Trennung von Arbeiten und Wohnen, eine wohnlichere Gruppenatmosphäre usw. unübersehbar (WACKER, 1998, S. 22). So sind Wohngruppen mehr Entscheidungskompetenzen in der Alltagsgestaltung übertragen worden, wodurch den Nutzern die Möglichkeit der zunehmenden Teilhabe oder Kontrolle an deren unmittelbaren Lebensbedingungen eröffnet wird.
Insgesamt zeichnet sich bei den Leistungsanbietern ein Trend ab weg von der reinen Versorgung, d.h. der primären Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, hin zu einem kunden- oder entwicklungsorientierten Denken und Handeln, wie es auch das Menschenbild dieser Arbeit fordert. Der Wechsel „... vom Versorgungsparadigma, von der Vorrangigkeit des Hilfe- und Pflegebedarfs, ist ... aber keineswegs vollzogen.“ (WACKER, 1998, S. 22). Fragt man nach der Nutzerorientierung, d.h. aktiven Gestaltungs- oder Beteiligungsmöglichkeiten an Entscheidungen des Heimlebens, so wird „... eine über Information und Anhörung hinausgehende Mitbestimmung der Nutzer ... eher selten praktiziert... .“ (SCHWARTE/OBERERSTE-UFER, 1997, S. 41). Anders gewendet liegt die „... Entscheidungsmacht über die Lebensbedingungen ... vorrangig bei den Helfern. Sie gestalten die Lebenswelt ihrer Klientel.“ (WACKER, 1998, S. 23).
Mitwirkung und Selbstbestimmung unter dem Schutz des (Heim)Gesetzes
Wird die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Wohnens auf die Wohnbedingungen für Menschen mit einer Behinderung übertragen, so wird „ein Grundanspruch auf Selbstbestimmung beim eigenen Wohnen nicht zuerkannt ... .“ (WACKER, 1998, S. 22).
Wenn allen Menschen in der BRD grundrechtlich die gleichen Rechte und die gleiche Würde garantiert werden, sind ableitbare Forderungen nicht verhandelbar, „... sondern rühren an die normativen und ethischen Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und sind Teil der mit politischen Mitteln abzusichernden Werte, die unsere Gesellschaftsstruktur bestimmen sollen.“ (ebd., S. 25). Wird dies nun auf stationäre Wohneinrichtungen übertragen, so ergibt sich für die Nutzer der unbedingte Anspruch der Mitwirkung und Selbstbestimmung in ihrer Lebenswelt. Vor diesem Hintergrund ist es meines Erachtens notwendig, die Grundrechte von Heimbewohnern unter den besonderen Schutz des Heimgesetzes zu stellen.
2.3 Möglichkeiten zur Mitwirkung und Selbstbestimmung im Heimalltag
„Alltag ist das, was wir „alle Tage“ tun: eine Vielzahl selbstverständlicher Handlungen, Routinen, Tätigkeiten und Interaktionen mit anderen Menschen, die unserem Leben eine verläßliche Struktur geben.“ (SCHWARTE/OBERSTE-UFER, 1997, S. 126). Im institutionellen Kontext von Wohneinrichtungen sind alltägliche Handlungen oder Tätigkeiten, wie z.B. das Einkaufen, das Kochen, die Essens- und Ruhezeiten, nach ökonomischen oder verwaltungstechnischen Vorgaben organisiert. Durch den Schichtdienst vieler Wohngruppenmitarbeiter oder die Zentralisierung von Angeboten oder Leistungen, wie z.B. die Versorgung durch Großküchen oder Wäschereien, Öffnungszeiten einrichtungsinterner Cafeterias usw. können „... die Strukturen meist nur zu einem sehr geringen Teil von den Nutzern beeinflußt oder gar gewählt werden ... .“ (ebd., S. 126). Im Hinblick auf die eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten im Heimalltag „... erscheinen Nischen in der Welt des Heims, in denen ein Umgang mit Informationen, mit Sich-Beraten und mit dem Fällen von Entscheidungen erfahren werden kann“ , um so bedeutungsvoller (WACKER, 1998, S. 223). Im Folgenden führe ich einige Beispiele auf, die für diesen Zusammenhang wichtig sind.
Haus- und Gruppenversammlungen
Eine Möglichkeit, an der Gestaltung des Alltags beteiligt zu sein, sind Haus- oder Gruppenversammlungen. In 70% aller Einrichtungen sind diese regelmäßigen Versammlungen installiert (vgl. ebd., S. 223). Inhaltlich geht es um konkrete lebensweltliche Themen, wie die Organisation und Verteilung von hauswirtschaftlichen Aufgaben, die Planung der Freizeitgestaltung, aber auch die Bewältigung von aktuellen Konflikten. In mehr als 80% aller Einrichtungen sind zusätzliche wohngruppeninterne Gesprächkreise geplant, um spezifische gruppenorientierte Fragestellungen zum Thema zu machen (vgl. ebd., S. 224).
Heimzeitungen
Eine andere Form „für gruppenübergreifenden Informationsaustausch und Meinungsbildung könnte eine Heimzeitung darstellen.“ (WACKER, 1998, S. 224). In rund 20% aller Einrichtungen erscheinen regelmäßig Heimzeitungen, in denen u.a. über besondere Ereignisse des Heimlebens, wie Feste, Basare usw., berichtet wird. In ca. 20% aller Heime werden diese vorwiegend selbst von den Bewohnern, in ungefähr 50% von Nutzern und Begleitern gleichermaßen und in den übrigen knapp 30% aller Einrichtungen von den Mitarbeitern allein erarbeitet (vgl. ebd., S. 224).
Ausschüsse & Gremien
Als weiteres Beispiel für die aktive Beteiligung an der Gestaltung des Heimalltags kann die Teilnahme an einrichtungsinternen Ausschüssen oder sonstigen Gremien genannt werden. WACKER (vgl. ebd., S. 224) berichtet in diesem Zusammenhang über Fest- und Heimausschüsse, in denen Nutzer an der Planung und Organisation von Festen oder sonstigen kulturellen Angeboten der Einrichtungen beteiligt sind.
Heimbeiräte
Eine weitere Möglichkeit zur aktiven Mitsprache und Mitgestaltung des Heimalltags in institutionalisierter, d.h. gesetzlich vorgeschriebener Form ist durch den Heimbeirat gegeben.
2.3.1 Mitwirkung und Selbstbestimmung über Heimbeiräte
„Ein pädagogisches Aufgabenfeld eröffnet sich ... bei der Mitwirkung der Bewohner einer Wohnstätte gemäß der Heimmitwirkungsverordnung ... .“ (MÜHL, 1994, S. 122). Das vom Gesetzgeber formulierte Ziel ist es, Heimbewohnern möglichst umfassend Gelegenheit zu geben, an der Gestaltung ihrer persönlichen Lebensverhältnisse über einen gewählten Heimbeirat mitzuwirken. Die vom Gesetzgeber formulierten Mitwirkungsbereiche erfassen deshalb nicht nur konkrete lebensweltliche Themen, sondern neuerdings auch komplexere oder abstraktere Sachverhalte, auf die ich im nächsten Kapitel detaillierter eingehe.
Gerade in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, in denen die „... Formen des aktiven Einsatzes für ... Bewohner eher am Rande des Heimlebens stehen ... liegt ein weites Handlungsfeld für Entwicklungen im Verhältnis von Organisation und in ihr lebenden Personen weitgehend brach.“ (WACKER, 1998, S. 225). Unter diesem Aspekt stellt die Konstituierung oder Konsolidierung eines Heimbeirates ein mögliches pädagogisches Aufgabenfeld, wie schon im Eingangszitat dieses Kapitels erwähnt, dar. Es bietet Nutzern die Chance als „Experten in eigener Sache“ ernst genommen zu werden und diese an Entscheidungen des Heimalltags teilhaben zu lassen (THEUNISSEN, 1995, S. 176). Der gesetzlich vorgeschriebene Heimbeirat kann als ein Instrument zur Umsetzung der geforderten Mitwirkung und als eine Form der potentiellen Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, auch weit über den individuellen Rahmen hinaus, gesehen werden. Idealtypisch sollen Heimbeiräte aus dem Kreise der Heimbewohner gebildet werden. Die Sichtweise des Gesetzgebers, prinzipiell den Nutzern den Vorzug vor Alternativlösungen[3] zu geben, spiegelt unübersehbar die Forderungen neuerer sonderpädagogischer Leitlinien wider. Als ein Beispiel ist das Empowerment-Konzept zu nennen. Es geht darin darum, Situationen der Machtlosigkeit zu überwinden und die (Wieder-) Gewinnung von Kontrolle oder Selbstbestimmung über die eigenen Lebensumstände zu erlangen. Hierbei wird die „... Fähigkeit, in eigener Sache zu entscheiden und zu handeln oder eigene Angelegenheiten selbst regeln zu können, also die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, ... bei jedem Menschen vorausgesetzt. Dies schließt aber nicht aus, dass sie im Einzelfall (erst) geweckt und entwickelt werden muss.“ (THEUNISSEN, 1995, S. 167). Die subjektzentrierte Sichtweise, d.h. den Menschen als >Experten seiner selbst< und somit als prinzipiell aktiv handelndes Individuum anzusehen, findet sich auch im in dieser Arbeit zugrunde liegenden Menschenbild wieder (s. Kapitel 1.1.2). Sicherlich ist ein Heimbeirat keine >typische< Form einer Selbsthilfegruppe, die im Empowerment-Konzept thematisiert wird, was aber keineswegs bedeutet, dass sich dieses Gremium nicht für so genannte Empowermentprozesse nutzen ließe. Von Vorteil kann es dabei sein, dass Heimbeiräte nicht erst um ihre Rechte oder ihre Anerkennung kämpfen müssen, sich nicht um Räumlichkeiten, Materialien usw. sorgen und sich nicht erst eigene Organisationsstrukturen erarbeiten müssen. Dem Heimbeirat werden seitens des Gesetzgebers eindeutig definierte Rechte und eine bestimmte Rolle zugesprochen, auf die im nächsten Punkt (Kapitel 3) näher eingegangen wird.
3. Gesetzliche Rahmenbedingungen der Heimbeiratstätigkeit
Alle Menschen sind Träger von Grundrechten. Das Grundgesetz schützt deshalb auch die Freiheit von Menschen mit einer Behinderung (vgl. § 2, GG). In der Verfassung wird die Umsetzung der Grundrechte gefordert. Für Menschen mit einer Behinderung bedeutet dies, dass Bedingungen so geschaffen werden sollten, dass sie Diskriminierung entgegenwirken und Freiheitsgrade möglichst nicht eingeschränkt werden. Zur Umsetzung der Grundrechte in Heimen der Behindertenhilfe dienen das Heimgesetz und die Heimmitwirkungsverordnung, in dem die Aufgaben und Mitwirkungsrechte eines Heimbeirates detaillierter beschrieben werden.
3.1 Das neue Heimgesetz
„Durch das Heimgesetz dokumentiert der Gesetzgeber, dass Heimbewohner wegen ihrer besonderen Situation existentiell eines besonders gestalteten Schutzes bedürfen und dass deshalb für sie Grundrechtsgarantien durch Gesetze konkretisiert werden müssen.“ (CRÖSSMANN, 2002, S. 26). Das Heimgesetz hat im Vergleich zu den übrigen Schutzgesetzen unseres Rechtssystems einen besonderen Status. Da beispielsweise durch „... Pflegebedürftigkeit und Multimorbidität ... der Bewohnerschaft“ die Fähigkeiten, Rechte geltend zu machen, eingeschränkt sein können, wurde im Heimgesetz ein besonderes Schutzinstrument verankert (BMFSFJ, 2002, S. 1). Nach § 18 des Heimgesetzes werden „... Heime ... von den zuständigen Behörden durch ... Prüfungen überwacht.“ Es ist Aufgabe der Länder, über sog. Heimaufsichtsbehörden die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu kontrollieren. Die Tätigkeit der Heimaufsichtsmitarbeiter soll sich nach dem Willen des Gesetzgebers jedoch nicht auf die Überwachung oder Überprüfung der gesetzlichen Vorgaben, in welcher Form z.B. in einer Wohneinrichtung die gesetzlich geforderte Mitwirkung gesichert wird, reduzieren. Vielmehr ist es ihre Aufgabe, die Akteure der Wohneinrichtungen, d.h. die Bewohner, die Heimbeiräte, die Träger, die Einrichtungsleitungen usw. zu „... informieren und [zu] beraten... .“ (HEIMG, § 4).
Anwendungsbereich des Heimgesetzes
Wie in Kapitel 2.1 bereits erwähnt, werden in der Behindertenhilfe unterschiedliche Wohnformen realisiert. Nicht alle dieser Wohnangebote sind per gesetzlicher Definition als Heim zu betrachten. Sie unterliegen deshalb auch nicht den Auflagen des Heimgesetzes. Heimbeiräte oder alternative Gremien müssen in diesen Einrichtungen daher auch nicht gebildet werden. Einrichtungen für behinderte volljährige Menschen, die in einem >all-inclusive-Angebot< Wohnraum, Betreuungspersonal, Verpflegung usw. anbieten, werden aus gesetzlicher Sicht jedoch i.d.R. als Heime definiert. Sie müssen deshalb die Auflagen des Heimgesetzes erfüllen und die Mitwirkung nach den gesetzlichen Vorgaben sichern.
Zielsetzung des Heimgesetzes
Ziele des Gesetzes sind u.a.: „...die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der... Bewohner von Heimen vor Beeinträchtigungen zu schützen... die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung der... Bewohner zu wahren und zu fördern...die Mitwirkung der Bewohner... zu sichern, eine dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse entsprechende Qualität des Wohnens und der Betreuung zu sichern....“ (HEIMG, 2002, § 2, Abs. (1), 1, 2, 4, 5).
Im Vergleich zur vorherigen Fassung wurden in der neuen Anfang 2002 novellierten Fassung des Heimgesetzes etliche Vorschriften verändert, d.h. ergänzt oder aktualisiert. Neu im Heimgesetz ist z.B., dass Heime der Behindertenhilfe (gem. der Neufassung des § 93, Abs. 2 BSHG) dazu verpflichtet werden die >Qualität ihrer Angebote<, d.h. Inhalt und Umfang der Leistungen, zu definieren, um auf dieser Basis über die Entgelte mit den Kostenträgern zu verhandeln und Entgeltvereinbarungen zu treffen (vgl. KLAUSS, 2002, S. 5). Die Gestaltung der Qualitätssicherung bleibt hierbei weitestgehend den Einrichtungen selbst überlassen. Da es sich hier um Entscheidungen handelt, die in direkter oder konkreter Weise das Leben der Heimbewohner betreffen, sind diese Bereiche mitwirkungspflichtig (s. Kapitel 3.2.3).
Der Gesetzgeber hat eine Vielzahl ergänzender Vorschriften erlassen, um die Nutzer z.B. vor Beeinträchtigungen zu schützen, auf die hier mit Ausnahme der Heimmitwirkungsverordnung, nicht weiter eingegangen werden soll, da sie den Rahmen der vorliegen Arbeit weit übersteigen (vgl. CRÖSSMANN, 2002, S. 115- 119).
3.2 Die neue Heimmitwirkungsverordnung
Das Heimgesetz schreibt die Mitwirkung von Heimbeiräten oder alternativen Gremien in den Angelegenheiten des Heimbetriebs vor. Die Heimmitwirkungsverordnung (HEIMMWV) konkretisiert die Vorschriften des Gesetzes. Mit der zweiten Heimmitwirkungs-Änderungsverordnung vom 1. August 2002 wurden die Mitwirkungsrechte des Heimbeirates in erheblichem Umfang ausgeweitet. Zu den wichtigsten Veränderungen, auf die noch näher eingegangen werden soll, zählen beispielsweise:
- Die Einbeziehung Dritter in den Heimbeirat. D.h. Personen, die nicht im Heim wohnen, können nun in den Heimbeirat gewählt werden (vgl. HEIMMWV, 2002, § 4). Ferner kann sich der Heimbeirat von fach- und sachkundigen Personen beraten lassen (vgl. ebd., § 17, Abs. 5).
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Förderung einer angemessenen Qualität der Betreuung (vgl. ebd., § 1, Abs. 2, § 29, Abs. 7, § 30, Abs. 11).
- Die Beteiligung an den Vergütungsverhandlungen zwischen Einrichtungs- und Kostenträger (vgl. ebd., § 1, Abs. 2, § 30, Abs. 12).
- Der Schulungsanspruch, der Heimbeiräten die Teilnahme an Fortbildungen oder Veranstaltungen zum Heimrecht sichern soll. Der Einrichtungsträger ist dabei zur Übernahme der Kosten verpflichtet (vgl. ebd., § 2, Abs. 2).
- Die Amtszeit für Heimbeiräte in Behinderteneinrichtungen wurde von zwei auf vier Jahre verlängert (vgl. ebd., § 12, Abs. 2).
3.2.1 Begriffbestimmung >Heimbeirat<
„Das Heimgesetz schreibt vor, dass die Bewohner eines Wohnheims – unabhängig von seiner Grösse – bei den Angelegenheiten des Heimbetriebs mitwirken können. Da nicht alle Bewohner mitreden wollen oder können, bestimmen sie eine Gruppe von Personen, die für alle Heimbewohner spricht. Diese Gruppe von Personen nennt man Heimbeirat. Der Heimbeirat vertritt also alle Bewohner gegenüber der Heimleitung.“ (DIETRICH, 2004, S. 5).
Für Mitglieder des Heimbeirates werden in dieser Definition in vereinfachter Sprache folgende wichtige Aspekte angesprochen:
- In jedem Heim sollte die Mitwirkung über einen Heimbeirat oder, falls dies noch nicht möglich sein sollte, über ein alternatives Gremium gesichert werden.
- Die Mitwirkung sollte nicht direkt zwischen dem einzelnen Bewohner und der Einrichtungsleitung oder dem Einrichtungsträger, sondern indirekt oder stellvertretend über Heimbeiräte ausgeübt werden. Das bedeutet, dass nur der Heimbeirat den gesetzlichen Anspruch zur Mitwirkung im Heimalltag hat.
- Heimbeiräte verstehen sich als Bindeglied und Vermittler zwischen Bewohnern und Heimleitung / Heimträger. Ihre Aufgabe ist es, die Anliegen der Bewohner gegenüber der Einrichtungsleitung zu vertreten. Der Heimbeirat ist kein gesetzlicher Vertreter der Mitbewohner, d.h. er kann für sie keine rechtsverbindlichen Erklärungen abgeben oder annehmen.[4]
- Nur Heimbewohner haben das Recht, einen Heimbeirat zu wählen.[5]
[...]
[1] In dieser Arbeit wird von dem epistemologischem Subjektmodell als anthropologische Grundlage ausgegangen, wonach sich Menschen erkennend und theoriebildend mit ihrer Welt und sich auseinandersetzen. Da ein fähigkeitsorientiertes Menschenbild in der Praxis noch keine Anwendung findet, verwende ich den defizitorientierten Begriff, >Menschen mit geistiger Behinderung<.
[2] Ein Blick in den Alltag macht übrigens sehr schnell deutlich, dass nicht jeder Mensch immer und in jeder Situation entsprechend seinen Fähigkeiten optimal handelt.
[3] Das Heimgesetz sieht neuerdings unterschiedliche Mitwirkungsgremien vor (s. Kapitel 3.2.4):
- Heimbeiräte (die sich ausschließlich aus Nutzern zusammensetzen)
- Gemischte Heimbeiräte (die sich aus Nutzern und externen Personen, die nicht im Heim leben zusammensetzen – die Majorität (Anzahl der Mitglieder und Vorsitz) bleibt idealtypisch bei den Nutzern)
- Alternative Mitwirkungsgremien wie >Heimfürsprecher< und >Ersatzgremien< (Mitwirkung von externen Personen).
[4] Der Heimbeirat ist keine eigene Rechtspersönlichkeit, d.h. er kann nicht gerichtlich klagen, um seine Rechte oder Wünsche zu erzwingen. Andererseits kann ein Heimbeirat auch nicht verklagt werden, um beispielsweise bestimmte Interessen zu vertreten bzw. Aufgaben wahrzunehmen (vgl. MARKUS, 2003, S. 115).
[5] Formalrechtlich gesehen mag es widersprüchlich erscheinen, dass Menschen, denen aufgrund geistiger Behinderung das aktive und passive Wahlrecht nach allgemeinen Grundsätzen entzogen wurde, einen Heimbeirat wählen bzw. gewählt werden und darüber im Heimalltag mitwirken. Hierbei wird jedoch einerseits übersehen, dass auch dieser Personenkreis grundrechtsmündig ist, d.h. als Träger von Grundrechten prinzipiell das Recht hat, an der Gestaltung der Lebenswelt mitzuwirken (vgl. GG Art. 1 ff.). Insofern ist dieses Wahlrecht als ein „höchstpersönliches Recht“ zu verstehen, was nicht durch einen gesetzlichen oder rechtlichen Betreuer ausgeübt werden kann und somit keine Geschäftsfähigkeit, d.h. die Fähigkeit verbindliche Rechtsgeschäfte und Verträge zu schließen, voraussetzt (MARKUS, 2003, S. 43). Werden andererseits die Mitwirkungsbereiche (s. Kapitel 3.2.3) näher betrachtet, so wird klar, dass es sich um interne, d.h. heimbewohnerbezogene Angelegenheiten handelt, die keine Geschäftsfähigkeit voraussetzen (vgl. CRÖSSMANN, 2000, S. 335).
-

-
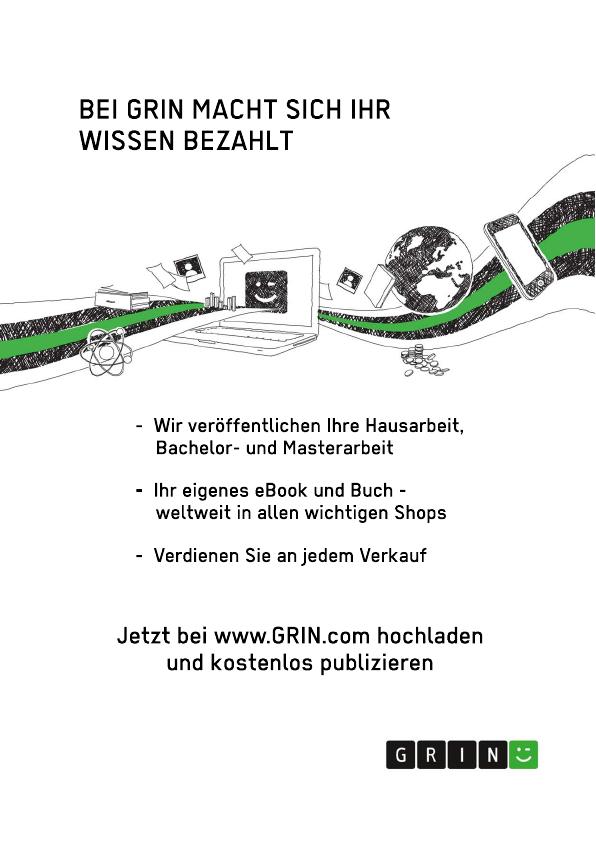
-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.

