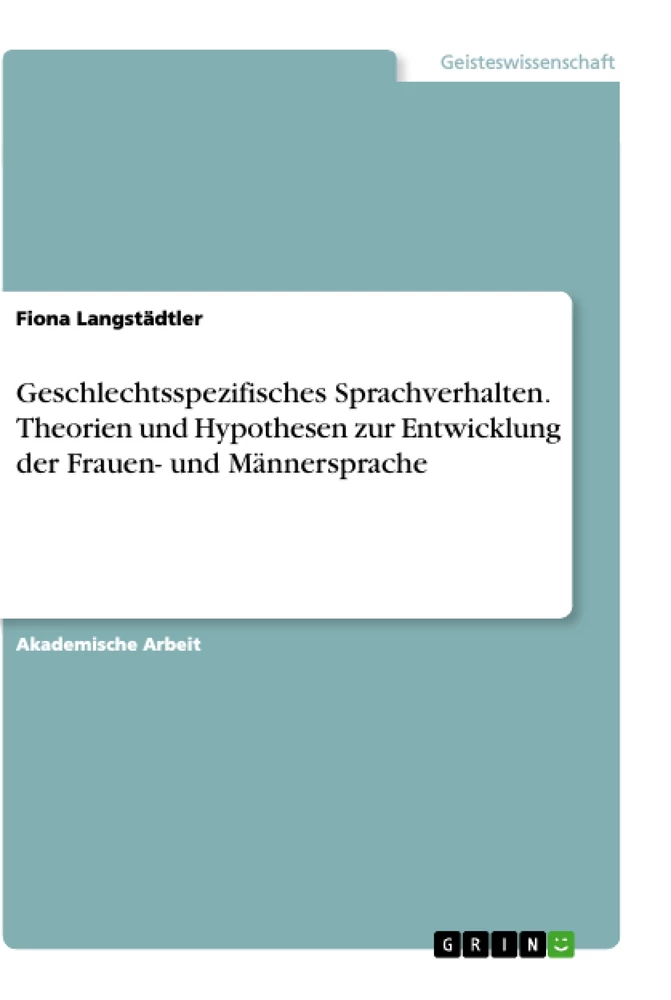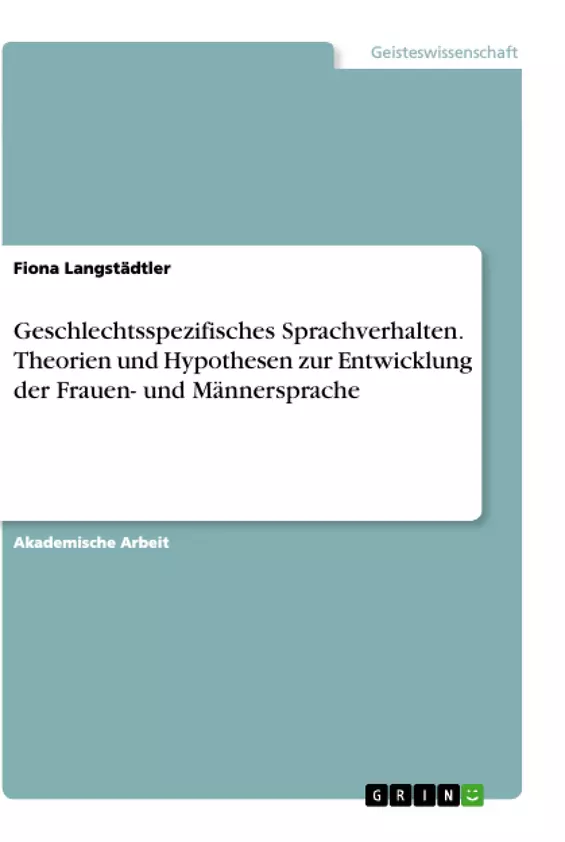Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Theorien und Hypothesen der Frauen- und Männersprache beziehungsweise mit geschlechtsspezifischem Sprachverhalten.
In den 60er Jahren war die feministische Sprachwissenschaft im Verhältnis zu anderen Wissenschaften noch ziemlich unerforscht. Frühere Untersuchungen der Sprache bezogen sich auf phonologische und morphologische Unterschiede, die unabhängig vom Geschlecht untersucht wurden. Neuere Untersuchungen der Sprache konzentrieren sich auf die Unterschiede im Sprachverhalten der Geschlechter.
Auch andere Variablen, wie der soziale Status, Alter und Religion bekamen einen anderen Stellenwert in der Sprachwissenschaft. Erst Mitte der 70er Jahre begannen Wissenschaftlerinnen aus den USA, wie Robin Lakoff und Mary Ritchie Key, Charakteristika einer "Frauen— und Männersprache" ausführlich zu diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verschiedene Welten
- Theorien und Hypothesen zur Entwicklung der Frauen- und Männersprache
- Hypothese des „Frühschicksals“
- Die Theorie der „Zwei Kulturen“
- Die Defizithypothese
- Die Differenzhypothese
- Geschlechtsspezifisches Sprachverhalten
- Berichtssprache und Beziehungssprache
- Klatsch
- die Macht des Details
- Dozieren und Zuhören
- Gemeinsam und gegeneinander: Sprechweisen im Spiel und im Streit
- Kommunikationswege öffnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Unterschiede in der Sprache von Frauen und Männern. Sie analysiert verschiedene Theorien und Hypothesen, die die Entwicklung dieser Unterschiede erklären, sowie Beispiele für geschlechtsspezifisches Sprachverhalten in verschiedenen Situationen. Dabei werden die Herausforderungen und Chancen aufgezeigt, die sich aus diesen Unterschieden ergeben.
- Entwicklung von Theorien zur Erklärung der Geschlechterdifferenz in der Sprache
- Analyse verschiedener Theorien wie der "Frühschicksals"-Hypothese und der "Zwei Kulturen"-Theorie
- Beobachtungen und Beispiele für geschlechtsspezifisches Sprachverhalten
- Herausforderungen und Chancen in der Kommunikation zwischen Frauen und Männern
- Mögliche Ansätze zur Verbesserung der Kommunikation und zum Abbau von Missverständnissen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der feministischen Sprachwissenschaft und die wachsende Bedeutung der Untersuchung von Geschlechterunterschieden in der Sprache. Sie stellt die Motivation für die Erforschung dieses Themas dar, insbesondere die Rolle der Frauenbewegung und das Bedürfnis nach einer weiblichen Stimme in der Sprache.
- Verschiedene Welten: Dieses Kapitel erörtert die unterschiedlichen Welten, in denen Frauen und Männer leben, und ihre Auswirkungen auf die Kommunikation. Es werden die Konzepte der Statuswelt und der Beziehungswelt vorgestellt und diskutiert, wie diese unterschiedlichen Perspektiven die Sprechweisen von Frauen und Männern prägen.
- Theorien und Hypothesen zur Entwicklung der Frauen- und Männersprache: Dieses Kapitel stellt verschiedene Theorien und Hypothesen vor, die die Entstehung der Unterschiede in der Sprache von Frauen und Männern erklären wollen. Dabei werden die "Frühschicksals"-Hypothese, die "Zwei Kulturen"-Theorie und weitere Ansätze diskutiert.
- Geschlechtsspezifisches Sprachverhalten: Dieses Kapitel beleuchtet konkrete Beispiele für geschlechtsspezifisches Sprachverhalten in verschiedenen Situationen, z.B. in der Berichtssprache und Beziehungssprache, im Klatsch und im Dozieren. Es untersucht die Rolle des Geschlechts bei der Kommunikation und die möglichen Ursachen für die Unterschiede in der Sprache.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Sprachwissenschaft, Geschlechterunterschiede, Kommunikationsstile, "Frühschicksals"-Hypothese, "Zwei Kulturen"-Theorie, geschlechtsspezifisches Sprachverhalten, Berichtssprache, Beziehungssprache, Klatsch, Dozieren, Missverständnisse, Kommunikation, Frauenbewegung.
- Citation du texte
- Fiona Langstädtler (Auteur), 2002, Geschlechtsspezifisches Sprachverhalten. Theorien und Hypothesen zur Entwicklung der Frauen- und Männersprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1000065