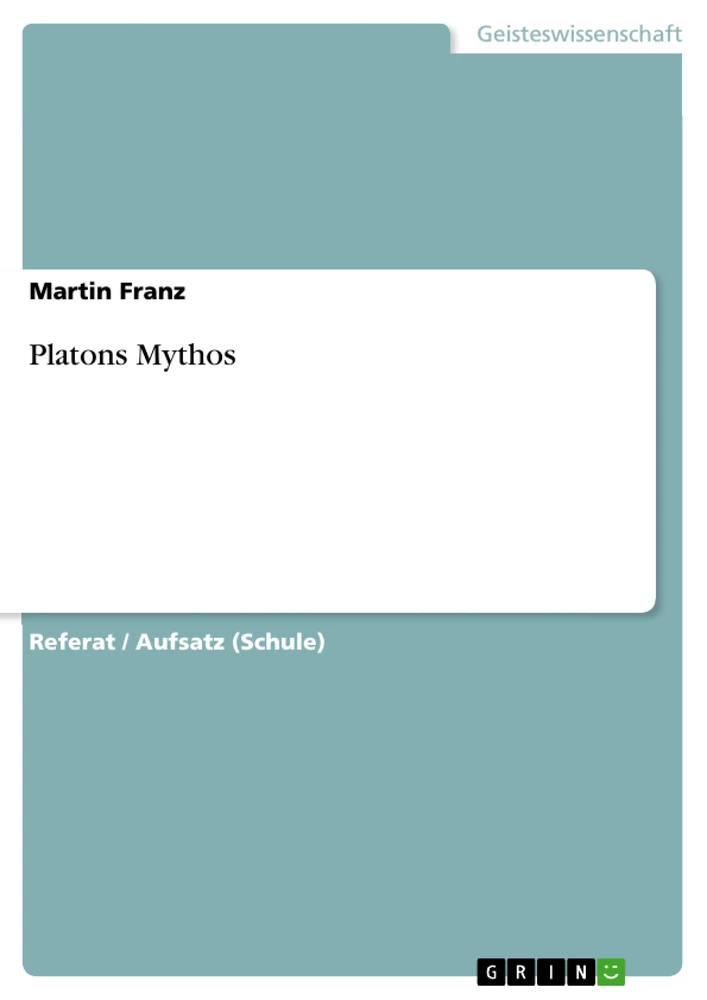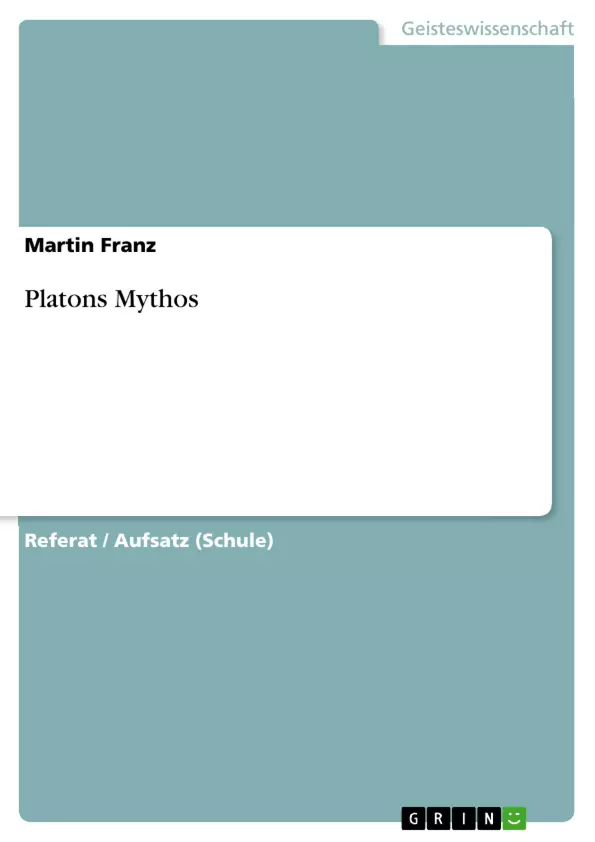Autor: Martin Franz
Vortrag zu Brisson, Luc: Einführung in die Philosophie des Mythos (siehe Literaturliste)
Platons Einstellung zum Mythos
1. Platon als Ethnologe
Der Mythos erscheint als eine Art Botschaft (aus der Sicht der Ethnologen), die eine selektierte Vergangenheit über Generationen transportiert (Gedächtnis). Der Ausgangspunkt dieser Vergangenheit fällt mit dem Ursprung der Götter zusammen. Mythische Wahrheit im Gegensatz zu historisch überprüfbarer Wahrheit. Letztere nimmt größere Ausmaße an seit der Erfindung der Schrift, wobei die mythische Wahrheit schwindet oder durch Interpretation eine allegorische wird.
Platons Wahrheitsbegriff differenziert sich schon durch zwei Formen der Darstellungsweise, die historische (auf überprüfbaren Tatsachen beruhende) gegenüber der mythischen. (S. 21)
1.1 Mythos als Mitteilung
Nichtsdestoweniger unterscheidet Platon die Herstellung eines Mythos häufig und recht eindeutig von seiner Erzählung. Erzählung ist Domäne der Dichter und anderer untergeordneter Vortragskünstler. (S: 22)
1.2 Mythos und Nachbildung
Überlieferung des Mythos ist für Platon an Mimesis gebunden (Kritias 107a4 - e3). Der Mythos ist der Malerei sehr nahe. Versuch mittels Lauten, die Wirklichkeit zur Erscheinung zu bringen: als Anwesenheit von etwas Abwesendem. Kompensation dieser realen Abwesenheit erfolgt durch mimetische Verfahrensweisen. (die da wären...?) (S. 23)
Das mitteilende Subjekt schwindet in der mimetischen Ausdrucksweise, im Gegensatz zur Exposition. (Politeia III 392c6 - 393c7) Deshalb lehnt Platon die mimetische Ausdrucksweise ab, da sie den Rezipienten der Konfusion von Diskurs und Wirklichkeit aussetzt und ihn somit täuscht. (Politeia III 395b - 397e)
Vortragsweise des Mythos (Politeia III 398c11 - d10)
Der Empfänger soll vom Mythos über einen Identifikationvorgang beeinflusst werden - es sollen sich ihm ethische Probleme stellen. Reale Abwesenheit der mythischen Wirklichkeit soll vergessen werden, damit Identifikation emotionale Verschmelzung) und daraus resultierender moralischer Appell beim Empfänger auf die Lebenspraxis bezogene Konsequenzen hat. (Politeia III 395b8 - d3) (S. 25)
1.3. Mythos und Überredung
,,Solche emotionale Verschmelzung wird von Platon auf einen Zauber zurückgeführt (Nomoi X 903a7 - b3; Phaidon 114d1 - 7, vgl. 77d5 - 78a2), der für die Seele die Rolle eines Heilmittels (Charmides 156d3 - 157c6), einer Beschwörungsformel (Euthydemos 289e1 - 290a4) oder einfacher einer Überredung (Politeia III 415c7, X 621c1; Phaidros 265b8; Nomoi VII 804e5, X 887d2, XI 913c1 - 2, 927c7 - 8) ausübt und ausgelöst wird von der Lust, welche die Mitteilung des Mythos der niedrigsten Seelenregion verschafft, jenem Teil, der nach Speise und Trank verlangt, und in dem auch das sexuelle Verlangen seinen Sitz hat (Timaios 70d7 - e5 )." (S. 25) (ES bei Freud - auch dieser greift auf den Mythos der Tiefe zurück)
Hauptadressaten für Mythen sind nach Platon Kinder und junge Menschen (Politeia II 377b6 - 7; Politikos 268e4 - 5).
Der Mythos ist für Platon ein Spiel! (Paidros 276e1 - 3)
2. Platon als Philosoph
Interesse für Mythos beruht auf Platons Bestreben, sein Monopol aufbrechen zu wollen, um einen anderen, in seinen Augen höherrangigen Diskurs durchzusetzen . (Siehe Sokrates, der immer anbietet, entweder in der Diskussion fortzufahren oder einen Mythos zu erzählen. Mythos wird dann aber letztlich immer zum argumentativen Mittel umfunktioniert. Das ist jedenfalls meine Meinung.)
2.1 Die Inferiorität des Mythos
2.1.1 Der Mythos ist ein Diskurs
Mythos = nicht überprüfbarer Diskurs, nicht argumentierende Erzählung Logos = überprüfbarer, argumentierender Diskurs (Sophistes 259d - 264b)
2.1.2 Der Mythos ist ein nicht überprüfbarer Diskurs
Drei Elemente die nach Platon konstitutiv für den Diskurs sind:
1. Der Diskurs ist eine Zusammensetzung von Haupt- und Zeitwort(en) (Sophistes 262a1)
2. Der Diskurs bezieht sich auf etwas, außersprachliche Wirklichkeit (Referenz)
3. Der Diskurs muss daher verifizierbar sein auf die Kategorien wahr oder falsch - hier wird
L.
Brisson schwammig, meint er eine logische Ü berprüfung oder eine erkenntnistheoretische, d.h. eine, die den philosophischen Wahrheitsbegriff untersucht und diskutiert?
1. Zeitwörter sind ,,Kundmachungen", welche auf Handlungen rekurrieren (Sophistes 262a3 - 4). Das handelnde grammatische Subjekt aber ist das Hauptwort. Eine Aneinanderreihung von Zeitwörter oder von Hauptwörtern getrennt ergibt keinen Diskurs. Zeitwörter und Hauptwörter müssen miteinander verknüpft werden. (Sophistes 269c9 - d7) Interessant wäre hier die Verbindung zu Foucaults Aufsatz ,,Das Denken des Draußen" - die Transitivität des diskursiven Sprechens und die Intransitivität des literarischen, d. h. des unendlichen Sprechens.
Der Diskurses, hergestellt durch die oben erwähnte Verknüpfung von Haupt und Zeitwörtern, verweist auf eine außersprachliche Wirklichkeit. (Korrenspondenztheorie), ,,die in der Gegenwart, der Vergangenheit und Zukunft angesiedelt ist, wobei im übrigen die Zeitstufe Gegenwart Überzeitlichkeit indizieren kann (vgl. Timaios 37c - 38c)" (S. 27)
2. ,,Daß eine Rede, wenn sie ist, notwendig eine Rede von etwas sein muss, von nichts aber unmöglich" Sophistes 262e5 - 6)
3. Die Beziehung zwischen dem zweiten und dem ersten Element macht das dritte Element aus: die Wahrheit oder Falschheit des Diskurses (Sophistes 263b2 - 8). ,,Wahr ist jede Verknüpfung von Haupt- und Zeitwort(en), deren Relation zu dem, worauf sie sich beziehen, ihm adäquat ist; falsch ist jede Verknüpfung von Haupt- und Zeitwort(en) deren Relation zu dem, worauf sie sich beziehen, ihm inadäquat ist . (Ich rede Wahrheit der Wirklichkeit? Diskursive Wahrheit einer diskursiv strukturierten Wirklichkeit...)
Diskurs und Denken sind für Platon homogen! (Sophistes 263e3 - 5) (Siehe wieder Foucaults Essay ,,Das Denken des Draußen")
Zusammenfassung:
Platons Definition des Diskurses beruht auf der Untersuchung der einfachsten Bestandteile, ohne Grammatik und Logik voneinander zu differenzieren. Er erkennt noch nicht die Probleme, die mit seinem an Referenz gebundenen zweiten Kriterium zu tun haben. Auch auf Wahrheit und Falschheit des Diskurses geht er nicht näher ein. Die Komplexität des Begriffes Diskurs wird von ihm nur angerissen, da er sich ja von seinem eigenen in der Antike vorherrschenden nicht lösen kann - er kann verständlicherweise den Erkenntnisstand und die Sprache der Problemfassung nichtüberschreiten. Gewissen philosophischen Problemen versperrt sich der Diskurs der Antike, da die Sprache als System gewisse Denkmodelle noch nicht zulässt.
Aber die Konsequenz für Platons Denksystem ist trotzdem klar erkennbar: Seine Definition des überprüfbaren Diskurses macht es möglich, die Sophisten von den Philosophen zu unterscheiden.
Die Sophisten haben einen falschen Diskurs inne, d.h. sie verfertigen Trugbilder im diskursiven Feld, und die Philosophen den wahren Diskurs, d.h. sie wahre Abbilder der Erscheinungen einer vorausgesetzten Wirklichkeit . (Mir scheint es so, als hätte Platon hier, durch seine Bewertung, auf eine Diskursverschiebung seiner Zeit aufmerksam gemacht.)
Den wahren Diskurs unterscheidet Platon nochmals in zwei Formen:
1. die der Einsicht in intelligible Formen (die Welt der Ideen) und 2. die der Meinung über mit den Sinnen Wahrgenommenes (dies setzt wieder eine außerhalb der Sprache vorhandenen und somit erfahrbare Welt voraus, die Welt der verdinglichten Ideen). An ersteren Erkenntnissen ist jeder Mensch teilhaftig, aber an letzteren ,,nur die Götter und eine nicht zahlreiche Gruppe von Menschen", die Philosophen (Timaios 51e5 - 6).
Ist der Mythos für Platon ein überprüfbarer Diskurs?
Auch der Mythos stellt eine Verknüpfung von Haupt- und Zeitwort(en) dar. Platon zählt fünf Nominalklassen auf, in welche sich die Subjekte des Diskurstyps Mythos einteilen lassen: Götter, Dämonen, Helden, Hadesbewohner und die Menschen der Vergangenheit (Politeia II 376e - III 403c). Die Besonderheit ist, das diese Nomen Eigennamen sind und somit auf Individuen verweisen.
Die Verben des Mythos klassifiziert Platon nicht. Sie beziehen sich im Mythos auf Taten, die an die sinnlich wahrnehmbare Welt gebunden sind.
Wiederholung der zwei Formen des wahren, überprüfbaren Diskurses:
- Der philosophische Diskurs bezieht sich auf die von der Vernunft erfassten intelligiblen Formen, die die wahre Wirklichkeit ausmachen und unabänderlich sind. Somit sind aber auch das Denken (innerhalb dieses Diskurses) und der Diskurs selbst von jener Unabänderlichkeit, denn beides passt sich den Referenzgrößen in ihrer Zeitlosigkeit und Allgemeingültigkeit an.
- Der aber auf sinnlich Wahrnehmbares referierende Diskurs ist immer an Zeit gebunden, wie seine Referenzobjekte. Die Wahrnehmung (innerhalb dieses Diskurses) der sinnlichen Welt, die nur durch die Teilhabe an der Ideenwelt wirklich ist, und dieser Diskurs selbst sind veränderlich. Somit gibt es keine aus diesem Diskurs entspringenden allgemeingültigen Wahrheiten. Die Überprüfbarkeit dieses Diskurses ist zu der des philosophischen Diskurses beschränkt und ebenso wie der Diskurs selbst an Zeit gebunden - entweder es gibt den direkten Wahrheitsbeweis, d.h. durch ein direktes Hinweisen auf das Wahrgenommene während des Sprechaktes, oder den indirekten Wahrheitsbeweis (indirekt, weil er sich auf eine Tatsache in der nahen Vergangenheit bezieht), der sich auf Augenzeugen oder eigene Erfahrungen berufen kann.
Der Mythos bezieht sich durch seine Verben auf die sinnlich wahrnehmbare Welt - auf Tatsachen einer überlieferten entfernten Vergangenheit die nicht überprüfbar ist. Die Subjekte des Mythos aber siedeln in dem Bereich der Welt der intelligiblen Formen und dem sinnlich Wahrnehmbaren, im Bereich der Seele und ihrer Unsterblichkeit.
,,Dies hat zwei Konsequenzen, von denen die erste die zweite nach sich zieht."
1. Die erste Konsequenz betrifft die Beziehung des als Mythos bezeichneten Diskurses zu seinem Denotat. Das Denotat befindet sich entweder auf einer den Sinnen und der Vernunft unerreichbaren Wirklichkeitsebene oder das Denotat ist in der sinnlich wahrnehmbaren Welt situierbar, aber liegt in einer nicht direkt oder indirekt überprüfbaren Vergangenheit.
2. Die zweite Konsequenz betrifft den selbstreferenziellen Charakter eines solchen Diskurses. Die Existenz des Denotates ist unbestreitbar (Prämissen der Antike? aber auch heute Mythen wie z.B. Schrift? Derrida genauer lesen.), aber lässt sich nicht präzise beschreiben, da es dem philosophischen (und dem Denken innerhalb dessen) und dem an den Sinnen gebundenen Diskurs (der Wahrnehmung innerhalb dessen) ausweicht, nicht zugänglich ist.
(Siehe hierzu Derrida ,,Chora", ,,Grammatologie" etc. Er macht an diesen zwei Punkten, d.h. an der Widersprüchlichkeit des mythischen Arguments und an dessen trotzdem möglichen Wahrheitsanspruches unter anderem die differance zwischen Signifikant und Signaifikat fest.)
Eigentlich müsste der Mythos jenseits von Wahrheit und Unwahrheit zu situieren sein, da Wahrheit und Unwahrheit eines Diskurses sich bei Platon an der Adäquatheit und Inadäquatheit zwischen ihm selbst und seinem Denotat festmachen. Aber trotzdem macht Platon am mythischen Diskurs diese Kategorien fest (Politeia II 376e6 - 377a8, 377d2 - e3; III 386b8 - c1; Kratylos 408b6 - d4; Gorgias 523a1 - 3, 527a5 - 8). Das liegt daran, dass Platon einen Perspektivenwechsel vollzieht: Er vergleicht nicht mehr diskursive Strukturen mit einer außerdiskursiven Wirklichkeit, sondern Diskurse untereinander (er wechselt von Epistemologie zur Zensur über!), d.h. zur Norm erhobene, institutionalisierte Diskurse mit dem mythischen. Dies gilt z.B.: für den religiösen, ethischen und politischen Bereich (Politeia II 378e7 - 379a4) und ebenso für den kosmologischen (Politikos 269b5 - c3; Timaios 22c3 - d3).
2.1.3. Der Mythos ist ein nicht argumentativer Diskurs
Ein weiterer Gegensatz zwischen Mythos und Logos neben dem oben genannten (nicht überprüfbarer Diskurs / überprüfbarer Diskurs) wäre: narrativer Diskurs / argumentativer Diskurs. Der erste Gegensatz stützt sich auf ein externes Kriterium, der zweite aber auf ein internes: auf dem Diskurs inhärente Strukturen.
- Die Verknüpfung der Geschehnisse einer Erzählung, eines Mythos ist kontingent (jedenfalls oberflächlich betrachtet - es gibt schon Versuche zur Erstellung einer Logik der Erzählung). Desweiteren soll ein Mimesiseffekt, der auf die Identifikation des Rezipienten mit dem Protagonisten beruht, hervorgerufen werden.
- Der argumentative Diskurs dagegen folgt einem rationalen Schema. Die Verknüpfung seiner Bestandteile erfolgt nach Regeln der Logik. Diese haben eine zwingende Schlußfolgerung zum Ziel und der Teilhaber dieses Diskurses spekuliert auf ein rationales Einvernehmen über diese Conclusion. (Beim Mythos scheint meiner Meinung nach die Conclusion außerhalb des Diskurses zu liegen, bei Platon wird der Mythos als ein Teil des argumentativen Diskurses benutzt, als Prämisse z.B. oder auch als Schlußfolgerung, die eine Grundwahrheit in sich schon birgt (siehe Phaidros?, letzter Mythos))
In den Dialogen Protagoras und Politikos wird der oben erläuterte Gegensatz Mythos / argumentativer Diskurs deutlich gemacht. (Politikos 274e1 - 4, 277a3 - c6; Protagoras 320c - 324d, 324d - 328d, 320c2 - 4, 324d6 - 7)
2.2 Die Nützlichkeit des Mythos
- Einerseits ermöglicht der Mythos Platon ein Sprechen über eine bestimmte außerdiskursive Wirklichkeit, die den Sinnen und dem Intellekt nicht zugänglich ist, also nicht den anderen Diskursen.
- Andererseits hat der Mythos Einfluß auf die Nichtphilosophen und kann als didaktisches
Mittel dienen, aber eher als rhetorisches Mittel, d.h. zur Überredung, statt zur Belehrung. Der Mythos vermittelt zwischen philosophischem Diskurs und nichtphilosophischem Diskurs (als didaktisches Mittel). Der Mythos ist die einzige Alternative zur Gewalt, da er ein durch Institutionen begründetes Machtpotenzial aufweist (als rhetorisches Mittel, Verkörperung der vorherrschenden Ideologie).
2.3 Andere von Platon als ,,Mythen" bezeichnete Diskurstypen
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus des Vortrags zu Brisson, Luc: Einführung in die Philosophie des Mythos?
Der Vortrag konzentriert sich auf Platons Einstellung zum Mythos, insbesondere seine Rolle als Ethnologe und Philosoph in Bezug auf Mythen.
Wie sieht Platon den Mythos im Kontext der Ethnologie?
Platon sieht den Mythos als eine Art Botschaft, die eine ausgewählte Vergangenheit über Generationen hinweg transportiert, beginnend mit dem Ursprung der Götter. Er unterscheidet mythische Wahrheit von historisch überprüfbarer Wahrheit.
Was sind Platons Ansichten zur Mimesis im Zusammenhang mit Mythen?
Platon verbindet die Überlieferung des Mythos mit Mimesis. Er vergleicht den Mythos mit der Malerei, als Versuch, die Wirklichkeit durch Laute zur Erscheinung zu bringen, um die Abwesenheit des Realen zu kompensieren.
Warum lehnt Platon die mimetische Ausdrucksweise ab?
Platon lehnt die mimetische Ausdrucksweise ab, weil sie den Rezipienten der Verwechslung von Diskurs und Wirklichkeit aussetzt und ihn somit täuscht.
Welche Rolle spielt die Überredung im Zusammenhang mit Mythen laut Platon?
Platon sieht die emotionale Verschmelzung, die durch Mythen ausgelöst wird, als eine Art Zauber, der die Seele beeinflusst und sie überredet. Er glaubt, dass Mythen besonders für Kinder und junge Menschen geeignet sind.
Wie betrachtet Platon den Mythos im Vergleich zum Logos (argumentativer Diskurs)?
Platon sieht den Mythos als einen nicht überprüfbaren, erzählenden Diskurs, im Gegensatz zum Logos, der ein überprüfbarer, argumentativer Diskurs ist.
Welche Elemente sind laut Platon konstitutiv für einen Diskurs?
Platon nennt drei konstitutive Elemente für einen Diskurs: eine Zusammensetzung von Haupt- und Zeitwort(en), einen Bezug auf eine außersprachliche Wirklichkeit (Referenz), und die Verifizierbarkeit in Bezug auf Wahrheit oder Falschheit.
Wie definiert Platon Wahrheit und Falschheit im Diskurs?
Wahrheit im Diskurs ist laut Platon jede Verknüpfung von Haupt- und Zeitwort(en), deren Relation zu dem, worauf sie sich beziehen, adäquat ist. Falschheit ist jede Verknüpfung, deren Relation inadäquat ist.
Wie unterscheidet Platon zwischen dem Diskurs der Sophisten und dem der Philosophen?
Platon unterscheidet die Sophisten durch ihren falschen Diskurs (Trugbilder) von den Philosophen, die den wahren Diskurs innehaben (wahre Abbilder der Wirklichkeit).
Welche zwei Formen des wahren Diskurses unterscheidet Platon?
Platon unterscheidet zwischen der Einsicht in intelligible Formen (Ideenwelt) und der Meinung über mit den Sinnen Wahrgenommenes.
Wie ordnet Platon den Mythos in Bezug auf Wahrheit und Falschheit ein?
Obwohl der Mythos eigentlich jenseits von Wahrheit und Unwahrheit angesiedelt sein müsste, da seine Denotate entweder unerreichbar sind oder in einer nicht überprüfbaren Vergangenheit liegen, macht Platon diese Kategorien dennoch am mythischen Diskurs fest, indem er Diskurse untereinander vergleicht (Epistemologie zur Zensur).
Was ist die Nützlichkeit des Mythos für Platon?
Der Mythos ermöglicht es Platon, über eine außerdiskursive Wirklichkeit zu sprechen, die den Sinnen und dem Intellekt nicht zugänglich ist. Er kann auch als didaktisches Mittel zur Überredung von Nichtphilosophen dienen.
Wie benutzt Platon den Begriff "Mythos" in einem bildhaften Sinn?
Platon benutzt den Begriff Mythos auch in einem uneigentlichen, bildhaften Sinn, arbeitet aber selbst mit Ursprungsmythen wie dem der intelligiblen und sinnlichen Welt im Timaios. Zum Teil entwirft Platon also selbst Mythen gegen andere Mythen.
- Citar trabajo
- Martin Franz (Autor), 2000, Platons Mythos, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100146