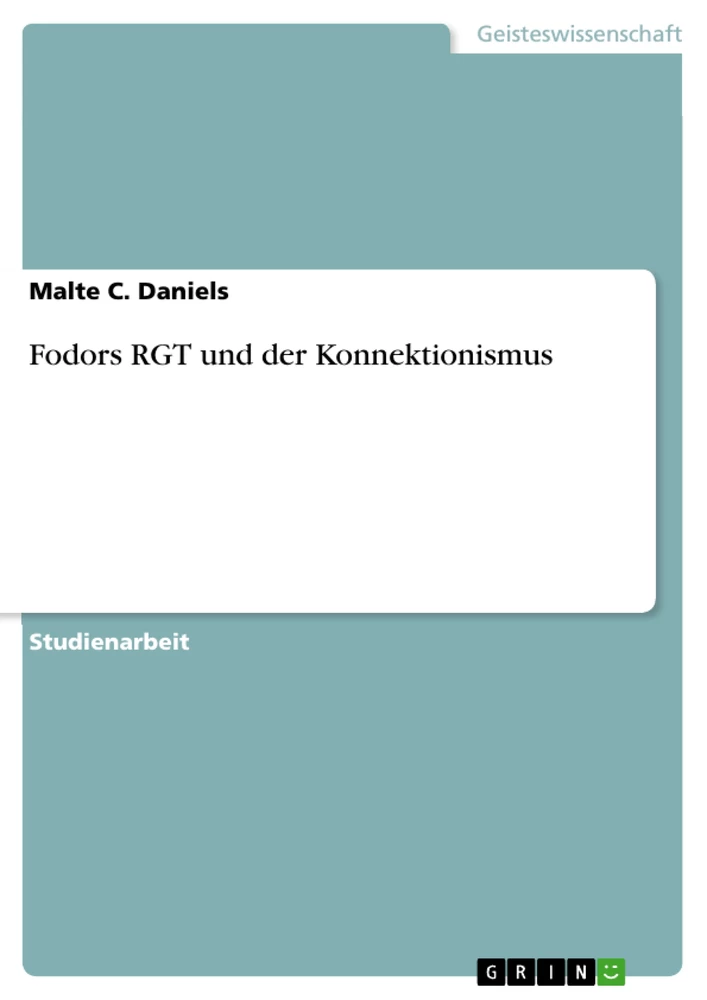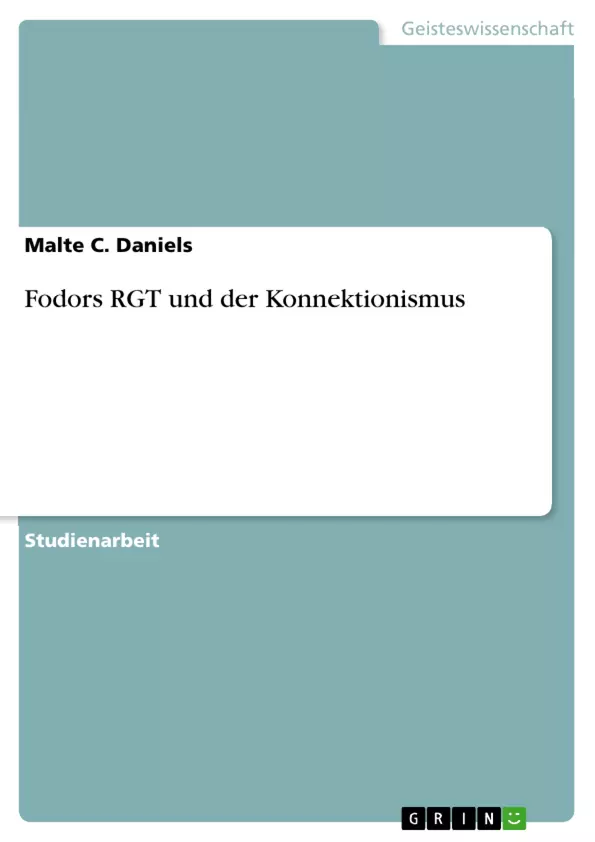In dieser Arbeit sollen verschiedene Ansätze zur Erklärung menschlichen Denkens und Bezug-Nehmens im Rahmen einer Philosophie des Geistes dargestellt und betrachtet werden.
Ausgehend von einer Beschreibung der prinzipiellen Eigenschaften geistiger/mentaler Zustände (Intentionalität, Systematizität, Produktivität) wird Fodors Repräsentationale Theorie des Geistes vorgestellt.
Ihr gegenüber wird ein neueres Konzept, das des Konnektionismus, gestellt.
Die Diskussion, welcher der beiden Ansätze zur Erklärung mentaler Zustände mitsamt ihrer Eigenschaften geeigneter ist, wird kritisch dargestellt.
Hierbei wird es vor allem um die Fragen gehen,
- ob neuronale/konnektionistische Netze in der Lage sind, eine Semantik zu produzieren;
und wie dies in der Repräsentationalen Theorie des Geistes geschehen sollte § und wie das Verhältnis dieser beiden Theorien zueinander zu sehen ist;
d.h. ob eventuell einer der beiden Ansätze zur Erklärung geistiger/mentaler Zustände der grundlegendere ist.
Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, werden im Folgenden einige Grundannahmen über den Menschen und seine mentalen Zustände gemacht:
- Es wird davon ausgegangen, dass Menschen mentale Zustände haben - zumindest in dem Maße, in dem sie subjektiv mentale, intentionale Zustände wahrnehmen.
- Mentale Prozesse und Zustände sind allein auf physikalische Gegebenheiten zurückzuführen.
Dies steht im Gegensatz zu einer dualistischen Theorie des Geistes.
Diese Grundannahmen sind in der aktuellen Philosophie des Geistes zwar nicht unumstritten, aber in großem Maße akzeptiert. Um Fodors Repräsentationale Theorie des Geistes und Konnektionismus zum Gegenstand eines Vergleiches machen zu können, sind diese Prämissen wohl unerlässlich.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Abbildungsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mentale Zustände und Fodors Repräsentationale Theorie des Geistes (RGT)
- Fodors Grundannahmen über mentale Zustände
- Language of Thought
- Fodors Repräsentationale Theorie des Geistes
- Das Konzept des Konnektionismus
- Prinzipieller Aufbau eines simplen konnektionistischen Netzes
- Gehirn und Konnektionismus - Parallelen und realistischere Nachbildung der Anatomie des Gehirns
- Die Fähigkeit zu lernen und weitere wesentliche Merkmale konnektionistischer Systeme
- Unzulänglichkeiten konnektionistischer Netze
- Fodors RGT oder Konnektionismus?
- Erklärt die Language of Thought - Hypothese oder die RGT wie Semantik in einem symbolverarbeitenden System entsteht?
- Ein bedeutungsproduzierender Mechanismus?
- Kontextabhängiges Verhalten bei kontextunabhängigen mentalen Repräsentationen und weitere Phänomene
- Fodors Kritik an konnektionistischen Netzen
- Verteidigung konnektionistischer Netze und Konzeption einer Semantik in konnektionistischen Netzen
- Fazit - RGT und Konnektionismus
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert verschiedene Ansätze, die das menschliche Denken und Bezugnehmen im Rahmen einer Philosophie des Geistes erklären sollen. Zuerst wird Fodors Repräsentationale Theorie des Geistes vorgestellt, die mentale Zustände auf eine Sprache des Geistes zurückführt. Im Kontrast dazu wird das Konzept des Konnektionismus beleuchtet, das neuronale Netze als Modell für mentale Prozesse verwendet. Die Arbeit diskutiert kritisch, welcher der beiden Ansätze am besten geeignet ist, um mentale Zustände und ihre Eigenschaften zu erklären.
- Die Eigenschaften von mentalen Zuständen (Intentionalität, Systematizität, Produktivität)
- Fodors Repräsentationale Theorie des Geistes und die Language of Thought
- Das Konzept des Konnektionismus und sein Potenzial, mentale Prozesse zu simulieren
- Die Fähigkeit konnektionistischer Netze, Semantik zu generieren
- Der Vergleich der beiden Ansätze und die Frage, welcher grundlegender ist
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Grundannahmen über mentale Zustände und ihre Eigenschaften. Sie führt dann Fodors Repräsentationale Theorie des Geistes (RGT) ein, die die Hypothese einer "Language of Thought" aufstellt, um die Entstehung und Funktion von mentalen Zuständen zu erklären. Das Konzept des Konnektionismus, das neuronale Netze als Modell für mentale Prozesse verwendet, wird anschließend vorgestellt und seine Parallelen und Unterschiede zur RGT analysiert. Die Arbeit untersucht kritisch, ob konnektionistische Netze in der Lage sind, Semantik zu erzeugen, und vergleicht die beiden Ansätze hinsichtlich ihrer Fähigkeit, mentale Zustände zu erklären.
Schlüsselwörter
Mentale Zustände, Intentionalität, Systematizität, Produktivität, Repräsentationale Theorie des Geistes, Language of Thought, Konnektionismus, neuronale Netze, Semantik, Symbolverarbeitung, Philosophie des Geistes.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Fodors Repräsentationale Theorie des Geistes (RGT)?
Fodors Theorie besagt, dass Denken in einer inneren Mentalsprache (Language of Thought) stattfindet, die ähnlich wie eine natürliche Sprache strukturiert ist.
Wie erklärt der Konnektionismus das menschliche Denken?
Der Konnektionismus nutzt Modelle neuronaler Netze, bei denen Informationen durch die Stärke der Verbindungen zwischen einfachen Einheiten verarbeitet werden, ähnlich wie im menschlichen Gehirn.
Was bedeutet Intentionalität in der Philosophie des Geistes?
Intentionalität bezeichnet die Fähigkeit mentaler Zustände (wie Wünsche oder Überzeugungen), sich auf etwas zu beziehen oder "von etwas zu handeln".
Können konnektionistische Netze eine Semantik produzieren?
Dies ist ein zentraler Streitpunkt. Fodor kritisiert, dass Netze ohne symbolische Struktur keine echte Bedeutung (Semantik) im Sinne der menschlichen Logik erzeugen können.
Was sind Systematizität und Produktivität des Denkens?
Systematizität bedeutet, dass wer einen Gedanken versteht, auch strukturell ähnliche Gedanken verstehen kann. Produktivität beschreibt die Fähigkeit, unendlich viele neue Gedanken aus bekannten Elementen zu bilden.
Sind mentale Prozesse rein physikalisch?
In dieser Arbeit wird die Prämisse verfolgt, dass mentale Zustände allein auf physikalische Gegebenheiten zurückzuführen sind, was im Gegensatz zum Dualismus steht.
- Quote paper
- Malte C. Daniels (Author), 2000, Fodors RGT und der Konnektionismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10024