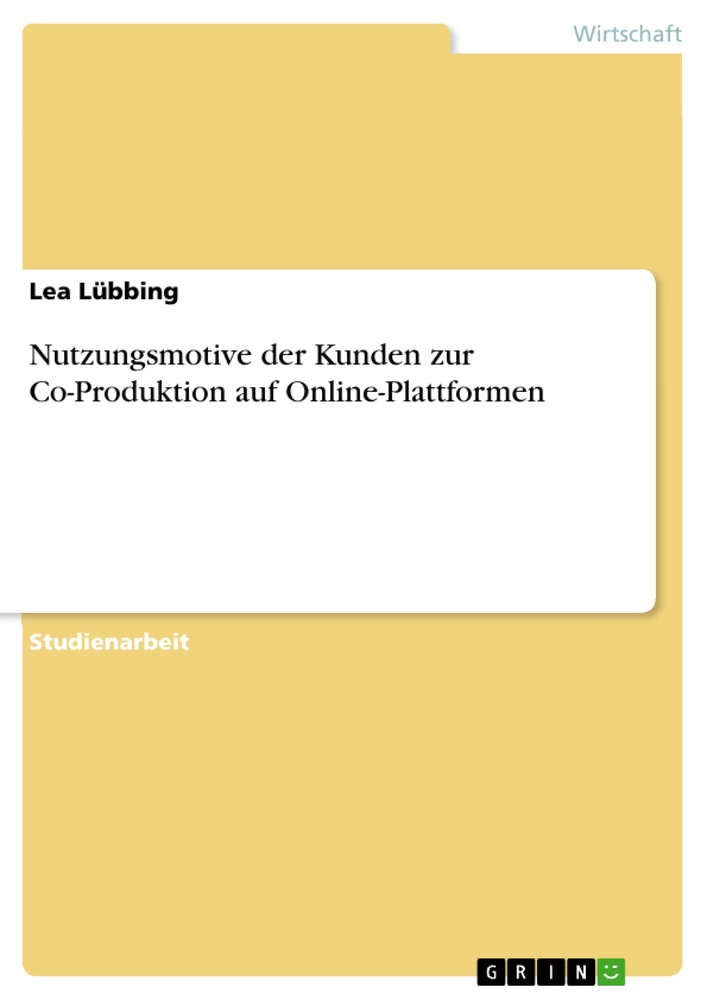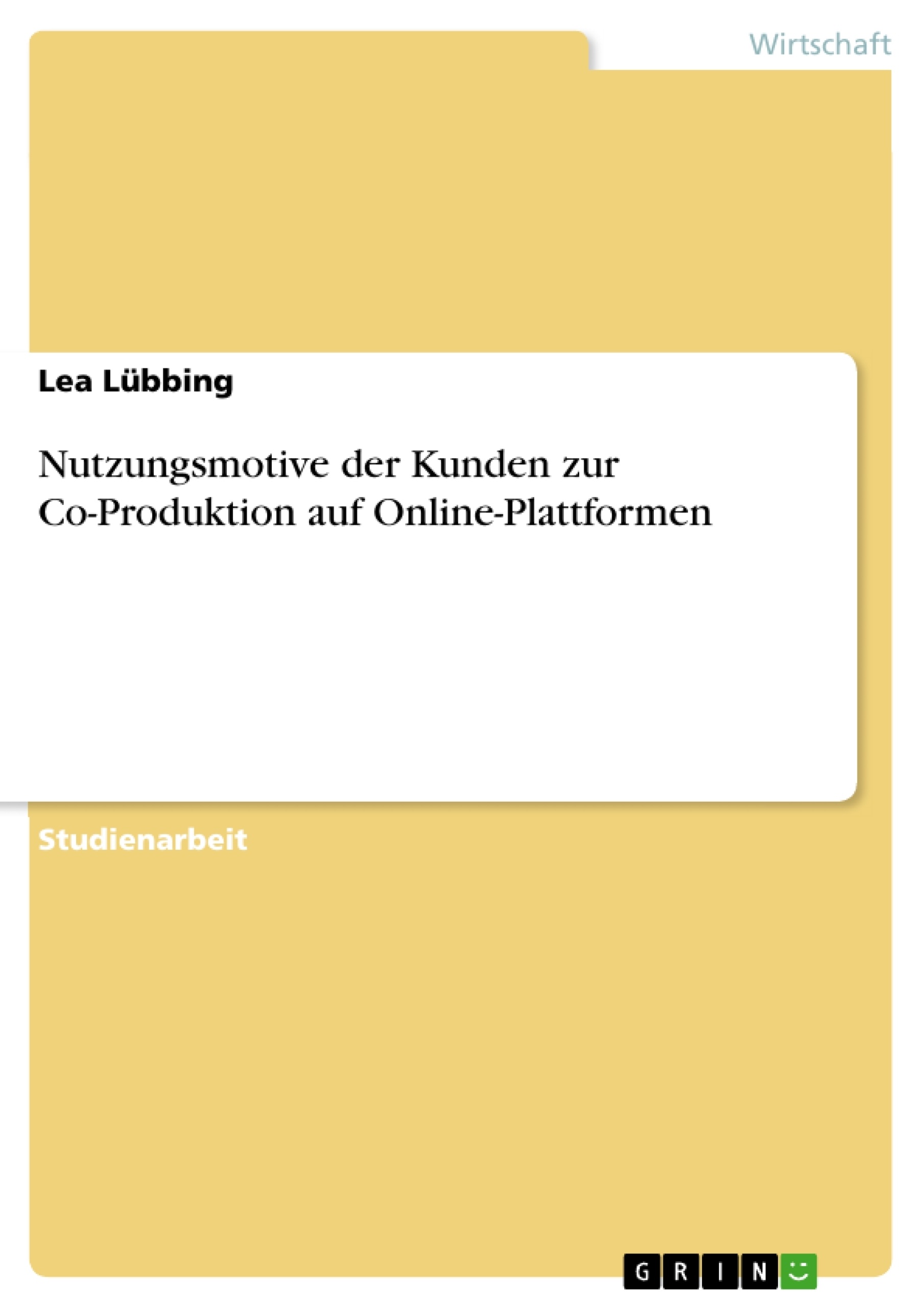Das Ziel der Arbeit ist, eine Befragungsmethode für potenzielle Nutzer der Online-Plattform zu entwickeln, um mögliche Motive der Kunden zur Bereitstellung von eigenentwickelte Rezepten auf der Online-Plattformen herauszufinden. Hierbei steht die Konzeption eines halbstrukturierten Leitfadens im Vordergrund. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung und des vorgegebenen Umfangs der vorliegenden Arbeit beinhaltet diese ausschließlich die theoretisch-fundierte Erstellung eines Fragebogens und nicht die Erhebung von Daten. Folglich ist es nicht möglich Ergebnisse der geplanten Untersuchung vorzustellen.
In den letzten Jahren hat kaum etwas anderes so stark die Welt verändert wie die globale Vernetzung und der damit verbundene weltweite Durchbruch von Online-Plattformen. Im Augenblick scheint die Flut an neuen Möglichkeiten der Kommunikation und Vernetzung unerschöpflich. Jeden Tag entstehen Hunderte neue, spannende Geschäftsideen und Plattformen, die sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen mit einer Selbstverständlichkeit nutzen, als hätte es noch nie etwas anderes gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Abgrenzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretischer Teil: Nutzungsmotive zur Co-Produktion auf Online-Plattformen
- 2.1 Definition relevanter Begriffe
- 2.1.1 Online-Plattform
- 2.1.2 Co-Produktion
- 2.2 Motive zur Nutzung digitaler Plattformen
- 2.2.1 Kognitive Motive
- 2.2.2 Affektive Motive
- 2.2.3 Soziale Motive
- 2.2.4 Motive zur Identitätsbildung
- 2.3 Ableitung der Forschungsfragen
- 3 Methodischer Teil: Operationalisierung der Forschungsfragen
- 3.1 Strukturbaum - Dimensionale Analyse
- 3.1.1 Dimension 1: Kognitive Motive
- 3.1.2 Dimension 2: Affektive Motive
- 3.1.3 Dimension 3: Soziale Motive
- 3.1.4 Dimension 4: Motive zur Identitätsbildung
- 3.2 Untersuchungsmethodik
- 3.2.1 Wahl der Methode
- 3.2.2 Auswahl der Probanden
- 3.2.3 Konzeption des Leitfadens
- 3.2.4 Kontaktaufnahme und Durchführung in der Praxis
- 3.3 Datenverarbeitung und Datenanalyse
- 4 Diskussion
- 4.1 Kritische Reflexion der geplanten Untersuchung
- 4.2 Prüfung der Gütekriterien
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Motivation von Kunden zur Co-Produktion auf Online-Plattformen, speziell im Kontext der Küchenhelfer GmbH und deren neuer Küchenmaschine. Ziel ist es, eine Befragungsmethode zu entwickeln, um diese Motive zu identifizieren und so die Erfolgschancen des neuen Geschäftsmodells der Küchenhelfer GmbH zu bewerten.
- Definition und Abgrenzung relevanter Begriffe wie Online-Plattform und Co-Produktion
- Analyse verschiedener Motive zur Nutzung digitaler Plattformen, darunter kognitive, affektive, soziale und identitätsbezogene Motive
- Operationalisierung der Forschungsfragen durch einen Strukturbaum und dimensionale Analyse des Konstrukts „Motivation der Kunden zur Co-Produktion“
- Konzeption eines halbstrukturierten Interviewleitfadens zur Erhebung der Motivationsfaktoren
- Diskussion der methodischen Vorgehensweise und der Qualität der geplanten Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, die sich aus dem geplanten Geschäftsmodell der Küchenhelfer GmbH ergibt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Motivation von Kunden zur Co-Produktion auf der Online-Plattform der Küchenhelfer GmbH und zielt darauf ab, eine Befragungsmethode zu entwickeln. Zudem wird der Aufbau der Arbeit erläutert.
- Kapitel 2: Theoretischer Teil
In diesem Kapitel werden wichtige Begriffe wie Online-Plattform und Co-Produktion definiert. Es werden verschiedene Motivtypen für die Nutzung digitaler Plattformen vorgestellt, wie kognitive, affektive, soziale und identitätsbezogene Motive. Die Kapitel schließt mit der Ableitung der Forschungsfragen.
- Kapitel 3: Methodischer Teil
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Operationalisierung der Forschungsfragen. Es wird ein Strukturbaum zur dimensionalen Analyse des Konstrukts „Motivation der Kunden zur Co-Produktion“ erstellt. Die Untersuchungsmethodik wird erläutert und ein halbstrukturierter Interviewleitfaden konzipiert. Zudem wird die mögliche Durchführung der Studie in der Praxis und die theoretische Vorgehensweise bei der Datenanalyse und -auswertung dargestellt.
- Kapitel 4: Diskussion
In diesem Kapitel erfolgt eine kritische Reflexion der geplanten Untersuchung und die Prüfung der Gütekriterien der entwickelten Befragungsmethode.
Schlüsselwörter
Online-Plattformen, Co-Produktion, Nutzungsmotive, digitale Plattformen, kognitive Motive, affektive Motive, soziale Motive, Identitätsbildung, Befragungsmethode, halbstrukturierter Interviewleitfaden, Strukturbaum, dimensionale Analyse, Gütekriterien
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Co-Produktion auf Online-Plattformen?
Co-Produktion bezeichnet die aktive Beteiligung von Kunden an der Wertschöpfung, beispielsweise durch das Bereitstellen eigener Rezepte auf einer Plattform.
Welche Motive bewegen Kunden zur Co-Produktion?
Die Arbeit unterscheidet kognitive Motive (Wissen), affektive Motive (Spaß), soziale Motive (Austausch) und Motive zur Identitätsbildung.
Wie wurde die Untersuchungsmethodik für dieses Projekt konzipiert?
Es wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden entwickelt, der auf einer dimensionalen Analyse des Konstrukts „Motivation“ basiert.
Was ist das Ziel der dimensionalen Analyse in dieser Arbeit?
Sie dient dazu, das komplexe Thema Motivation in messbare Dimensionen (kognitiv, affektiv, sozial, identitätsbezogen) zu zerlegen.
Welche Rolle spielen Online-Plattformen für moderne Geschäftsideen?
Sie ermöglichen eine globale Vernetzung und bieten Unternehmen neue Wege, Kunden direkt in die Produktentwicklung und Kommunikation einzubinden.
Enthält die Arbeit bereits erhobene Daten?
Nein, aufgrund der Begrenzung fokussiert sich die Arbeit ausschließlich auf die theoretisch-fundierte Erstellung des Fragebogens und nicht auf die Datenerhebung.
- Arbeit zitieren
- Lea Lübbing (Autor:in), 2020, Nutzungsmotive der Kunden zur Co-Produktion auf Online-Plattformen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1002992