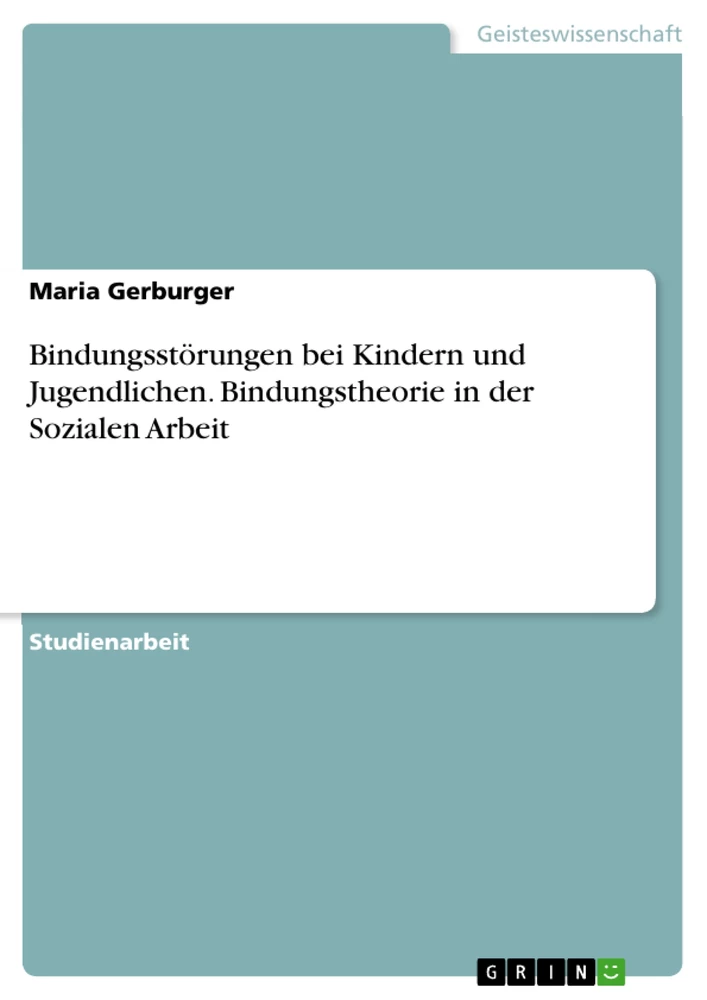Diese Arbeit setzt sich mit dem Thema Bindung und Bindungsstörungen auseinander. Dabei wird auch ein Bezug zur bindungsorientierten Sozialen Arbeit genommen, um ihre Bedeutung und ihren positiven Einfluss darzustellen. Diese Ausarbeitung lässt sich thematisch grob in drei Teile gliedern: Die Darstellung der Bindungstheorie und ihre Grundannahmen, die Bindungstypen und ihre Auswirkungen und die Rolle der Sozialen Arbeit in der Förderung einer Bindungssicherheit.
Zunächst geht es um die Darstellung der Bindungstheorie nach dem Begründer John Bowlby und später auch nach Mary Ainsworth. Die Relevanz dieser Theorie für die Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird ebenfalls geklärt und interpretiert. Hier kommt Karl Heinz Brisch als Experte zum Einsatz. Seine verhaltensethischen Gesichtspunkte für SozialarbeiterInnen finden hier Berücksichtigung, da diese eine professionelle Orientierung für den Umgang mit bindungsgestörten Kindern und Jugendlichen bieten.
Die Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth beschreibt die Bindung als ein genetisch verankertes Bedürfnis, enge und emotionale zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen. Die Bindungstheorie thematisiert vor allem auch die Auswirkungen einer Bindungsqualität auf die psychische und emotionale Gesundheit eines Individuums. Die Erkenntnisse der Bindungsforschung finden heute unter anderem Berücksichtigung in der Betreuung von Kindern in Heimen und Kliniken, aber auch im Kontext der pädagogischen und Sozialen Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung, Thema dieser Arbeit
- 2 Bindungstheorie
- 2.1 Der Bindungsbegriff
- 2.2 Grundlagen der Bindungstheorie
- 2.3 Abgrenzung zur Triebtheorie
- 2.4 Das innere Arbeitsmodell
- 2.5 Feinfühlige Interaktion
- 2.6 Bindungstypen
- 2.6.1 Die „Fremde Situation“
- 2.6.2 Die sichere Bindung
- 2.6.3 Die unsicher-vermeidende Bindung
- 2.6.4 Die unsicher-ambivalente Bindung
- 2.6.5 Die desorientierte/desorganisierte Bindung
- 2.7 Bindungsstörungen
- 2.7.1 Ursachen von Bindungsstörungen
- 2.7.2 Auswirkungen von Bindungsstörungen
- 2.7.3 Formen von Bindungsstörungen
- 3 Die Bedeutung einer bindungsorientierten Sozialen Arbeit
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bindungstheorie und deren Relevanz für die Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie untersucht die Entwicklung einer sicheren Bindung und die Auswirkungen von Bindungsstörungen auf die psychische Entwicklung. Darüber hinaus werden die Bedeutung und der Einfluss der Sozialen Arbeit auf die Förderung einer sicheren Bindung beleuchtet.
- Die Darstellung der Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth
- Die verschiedenen Bindungstypen und ihre Auswirkungen auf die kindliche psychische Entwicklung
- Die Ursachen und Auswirkungen von Bindungsstörungen
- Die Bedeutung der Sozialen Arbeit in der Förderung einer sicheren Bindung
- Die Rolle der Feinfühligkeit in der Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung, Thema dieser Arbeit
Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit, Bindung und Bindungsstörung, vor und skizziert den thematischen Aufbau. Die Bedeutung der bindungsorientierten Sozialen Arbeit wird hervorgehoben.
2 Bindungstheorie
Dieses Kapitel beschreibt die Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth. Der Bindungsbegriff, die Grundlagen der Theorie, die Abgrenzung zur Triebtheorie, das innere Arbeitsmodell und die Bedeutung der feinfühligen Interaktion werden erläutert. Die verschiedenen Bindungstypen und ihre Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung werden detailliert dargestellt. Abschließend werden Ursachen und Auswirkungen von Bindungsstörungen behandelt.
3 Die Bedeutung einer bindungsorientierten Sozialen Arbeit
Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Sozialen Arbeit in der Förderung einer sicheren Bindung. Es beleuchtet die Bedeutung von bindungsorientierten Interventionen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, Bindungsbegriff, sichere Bindung, unsichere Bindung, Bindungsstörung, Feinfühligkeit, innere Arbeitsmodelle, Soziale Arbeit, Kinder und Jugendliche, Entwicklungspsychologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Grundannahme der Bindungstheorie?
Bindung ist ein genetisch verankertes Bedürfnis des Menschen, enge emotionale Beziehungen einzugehen, was für die psychische Gesundheit entscheidend ist.
Welche Bindungstypen werden unterschieden?
Man unterscheidet zwischen sicherer Bindung, unsicher-vermeidender, unsicher-ambivalenter und desorganisierter Bindung.
Was sind die Ursachen für Bindungsstörungen?
Ursachen liegen oft in mangelnder Feinfühligkeit der Bezugspersonen, traumatischen Erlebnissen oder häufigen Beziehungsabbrüchen in der frühen Kindheit.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei Bindungsproblemen?
Soziale Arbeit kann durch bindungsorientierte Interventionen helfen, die Bindungssicherheit zu fördern und professionelle Orientierung im Umgang mit betroffenen Kindern zu bieten.
Wer sind die wichtigsten Theoretiker in diesem Bereich?
Die Arbeit stützt sich auf die Begründer John Bowlby und Mary Ainsworth sowie auf den Experten Karl Heinz Brisch.
- Quote paper
- Maria Gerburger (Author), 2021, Bindungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Bindungstheorie in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1008438