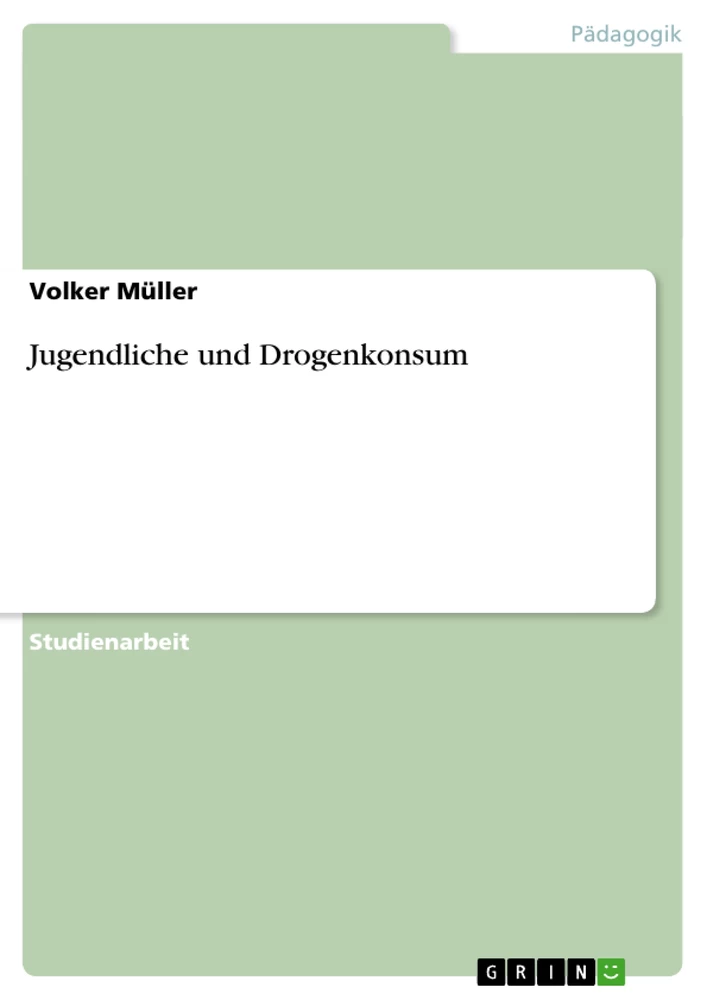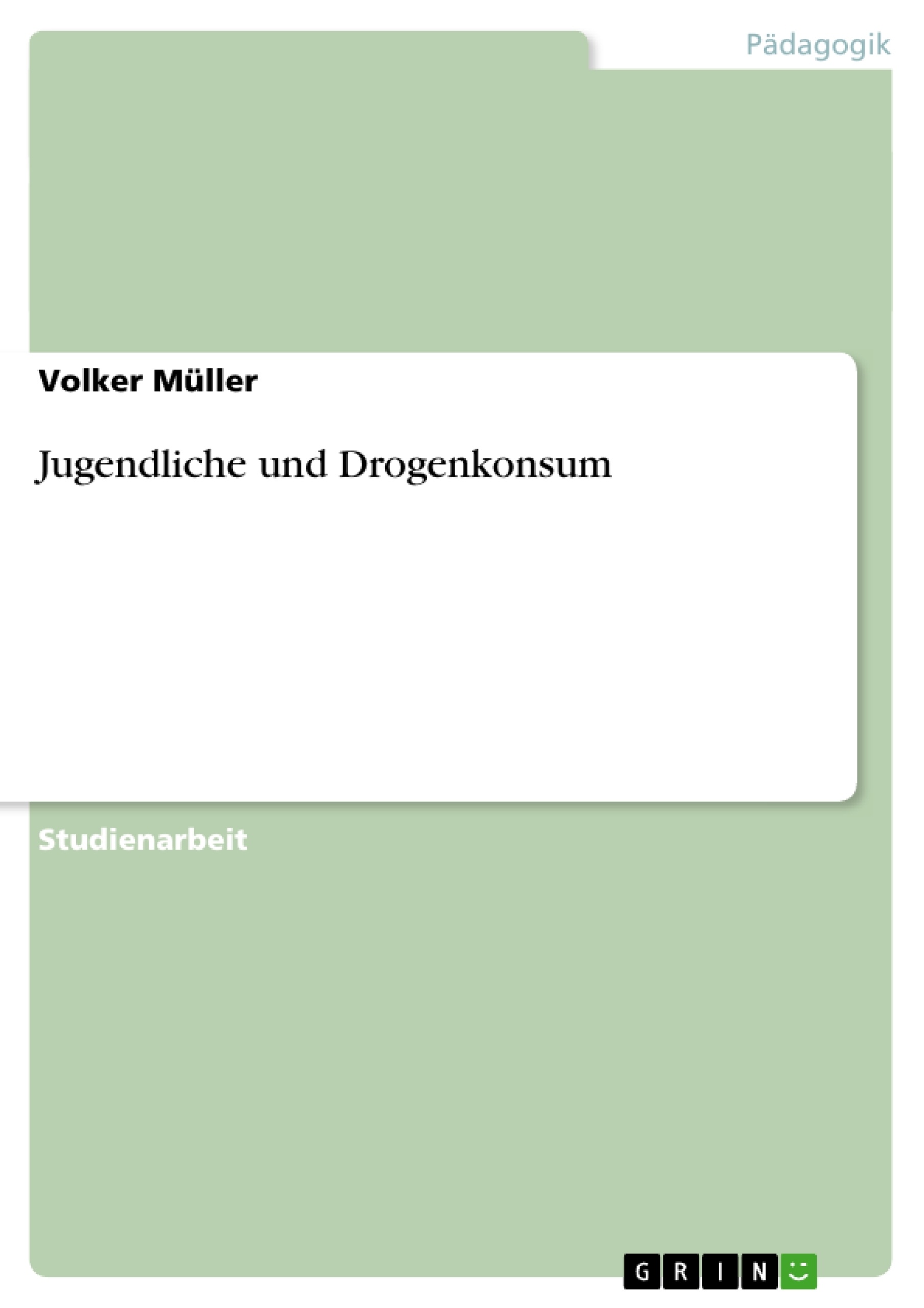Jugendliche und Drogenkonsum
Studiengang : Diplom Pädagogik
Der Drogenkonsum bei Jugendlichen ist seit Jahren im Focus der Medien. So erscheinen immer wieder Berichte über Einzelschicksale von opiatabhängigen Jugendlichen oder Horrormeldungen über den Ecstasykonsum in Diskotheken. Es entsteht ein Bild von Jugendlichen, die immer mehr und häufiger zu Drogen greifen.
Folgender Artikel erschien in der Berliner Morgenpost1:
„Jugend schluckt mehr Drogen - Zahl der Erstkonsumenten drastisch gestiegen
BM/AP Frankfurt/Main - Die Zahl der Erstkonsumenten von Drogen steigt in Deutschland dramatisch an: Mit 8625 jungen Menschen registrierte die Polizei im ersten Halbjahr 1997 die bisher höchste Zahl an Drogeneinsteigern, seit die Statistik geführt wird. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, in dem 5742 erstauffällige Rauschgiftkonsumenten festgestellt wurden, ist das eine Steigerung um knapp 44 Prozent. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums stieg auch die Zahl der Rauschgiftfunde deutlich an. Zoll und Polizei konnten im ersten Halbjahr 1997 815,5 Kilogramm Kokain sicherstellen, gegenüber 583 Kilogramm in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Zugleich wurden insgesamt 251 850 Tabletten der Modedroge Ecstasy beschlagnahmt, eine Steigerung um 6,9 Prozent“
Aus meinem eigenen Leben weiß ich, das Drogen von vielen Jugendlichen konsumiert werden. Die meisten Jugendlichen trinken häufiger bis regelmäßig Alkohol. Auf Veranstaltungen für Jugendliche oder privaten Partys ist meistens die Mehrzahl der Anwesenden betrunken. Auf anderen Veranstaltungen werden andere Drogen konsumiert. In der Technosubkultur ist der Konsum von Cannabis, Ecstasy, LSD und zunehmend auch Kokain und Speed verbreitet.
Aber wie sieht die Realität des Drogenkonsums aus und hat dieser in den letzten Jahren wirklich zugenommen? Wo liegt der Übergang von Drogenkonsum zu Drogenmißbrauch ? Bei der gesamten Drogendiskussion der Öffentlichkeit fehlt in den meisten Fällen eine Differenzierung. Manche Artikel oder Berichte benutzen in ihrer Darstellung lediglich das Wort Droge. Was ist darunter zu verstehen? Hier scheint keine Einigkeit zu bestehen. Verstehen die Autoren unter Drogen auch die legalen Drogen wie Alkohol, Nikotin und Koffein? In vielen Darstellungen werden Cannabiskonsum und Opiatkonsum im gleichen Zusammenhang verwendet. Das entspricht sicherlich nicht der Realität. Wie sind die verschiedenen Substanzen zu bewerten und zu vergleichen? Es ist empirisch belegt, dass ein Cannabisrausch dem menschlichen Körper weniger Schaden zufügt als ein Alkoholrausch. Kann man deshalb sagen, Alkohol sei eine härtere Droge? Wer ist Drogenkonsument? Der Familienvater, der sich jeden Abend seine ein oder zwei „Fläschchen Bier“ trinkt und dazu zwanzig Zigaretten raucht? Die Dorfjugend, die sich auf den diversen Festlichkeiten (Schützenfest usw.) mit Zustimmung der Erwachsenen betrinkt? Wie kann man dazu den Jugendlichen setzen, der am Wochenende in der Diskothek Ecstasy konsumiert? Wo gehört der Opiatabhängige hin, der jeden Tag seine Heroindosis benötigt?
Auf der Suche nach empirischem Material im Internet bin ich auf mehrere Darstellungen gestoßen. So veröffentlicht der Deutsche Bundestag folgenden Beitrag im Internet2:
„Jugendliche lehnen den Konsum illegaler Drogen überwiegend ab. Das stellt die Bundesregierung in Antwort auf eine kleine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen zur Betreuung drogengefährdeter Jugendlicher fest. Umfragen hätten ergeben, dass 76 Prozent der Jugendlichen nie illegale Drogen genommen hätten. Auch sei ein Rückzug beim regelmäßigen Alkoholkonsum Jugendlicher festzustellen.“
Leider fehlen in diesem Artikel sämtliche Angaben zur Datenerhebung und Auswertung. Wer ist hier mit Jugendliche gemeint? Wieviel Jugendliche wurden befragt? Wo fand die Erhebung statt?
Das AWO-Magazin3 veröffentlicht einen Beitrag mit folgender Überschrift : „Studie belegt : Jugendliche greifen häufiger zu Drogen“. Der Artikel hat folgenden Inhalt :
„Jugendliche in Deutschland konsumieren vermehrt illegale Drogen. Das ergab eine jetzt veröffentlichte Studie. Ein Fünftel der zwölf- bis 25-Jährigen in der Bundesrepublik hat ein- oder mehrmals eine oder mehrere illegale Drogen genommen - in Westdeutschland 22, in Ostdeutschland 17 Prozent. Während in den 80er Jahren der Anteil der Jugendlichen mit Drogenerfahrung konstant war, ist er von 1993 auf 1997 um drei Prozent angestiegen. Auf der anderen Seite haben Dreiviertel der zwölf- bis 25-Jährigen weder Drogen genommen noch sind sie bereit, in Zukunft Drogen zu nehmen - in Westdeutschland 73, in Ostdeutschland 80 Prozent. Dagegen liegt im Bereich der legalen Suchtmittel das Einstiegsalter auf einem dramatisch niedrigen Niveau : Für die erste Zigarette bei 13,9 Jahren, die erste Alkoholrauscherfahrung wird mit 15,4 Jahren gemacht und Cannabis erstmals mit 16,8 Jahren konsumiert.“
Leider gibt es auch hier keine Angabe, um was für eine Studie es sich handeln soll.
Ansonsten habe ich im Internet leider nur eine empirische Studie gefunden. Sie wurde im Ärzteblatt Sachsen veröffentlicht. Die Studie trägt den Titel „Immer mehr Jugendliche nehmen Drogen? - Empirische Befunde zu einer Alltagsmeinung“ und ist von H. Petermann4,
M. Schmidt4 und M. Scholz5. Es wurden Daten von Schülern und Schülerinnen der 7. Klassenstufe verwendet. Von ihnen liegen die Gebrauchsmengen von Zigaretten, Alkohol und illegalen Drogen zu vier Meßpunkten vor. Sie gehören zu den Kontrollklassen der Studien und erhielten kein spezifisches suchtpräventives Treatment. Tabelle 1 gibt einen Überblick :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Erfassung des Gebrauchsverhaltens erfolgte anonym durch einen Fragebogen, der von den beteiligten Schüler zu jedem Meßpunkt anonym bearbeitet wurde. Dies geschah in der Situation des Klassenzimmers und dem Beisein von Mitarbeitern des Forschungsprojektes. Es galt die strikte Beachtung des Datenschutzes und die Lehrer waren bei allen Formen der Datengewinnung und Auswertung nicht beteiligt. Das Gebrauchsverhalten wurde bei allen Meßpunkten Meßpunkten mit dem gleichen Fragenschema erfasst.
Die Daten zum Alkoholkonsum wurden durch Kombination von Häufigkeit des Trinkens (zum Beispiel Bier, Wein, Spirituosen) und der Glaszahl je Konsumereignis bestimmt. Dadurch ist die Berechnung der Alkoholmenge in Gramm im Drei-Monats-Prävalenzzeitraum für jeden Probanden möglich. Auf dieser Basis läßt sich jeder Schüler einer Gebrauchskategorie zuordnen, die von Abstinenz bis Vielgebrauch reichen. Die Tabelle 2 zeigt absolute und prozentuale Häufigkeiten der Kategorie „Vieltrinker“. Diese Vieltrinker können mit über 900 g Reinalkohol im Dreimonats-Prävalenzzeitraum als mißbrauchsgefährdet angesehen werden.
Tabelle 2 :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
n.s nicht signifikant
Der Tabakkonsum der befragten Jugendlichen besteht ausschließlich im Zigarettenrauchen. Als Kriterium der Zuordnung zur Gebrauchskategorie "Raucher" wurde die Bejahung der Häufigkeit "drei- oder viermal in der Woche" beziehungsweise "fast täglich" für das Zigarettenrauchen gewählt. Die Ergebnisse des Vergleichs der Gebrauchshäufigkeiten im Untersuchungszeitraum finden sich in Tabelle 3 :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ein Gebrauchsanstieg ist nur auf dem 10%-Signifikanzniveau mit einer Verdopplung der Raucher von 1993 bis 1998 zu sehen, der sich aber nicht fortsetzt. Im Jahre 1998 findet sich im Gegensatz dazu eine signifikante Verringerung der Anzahl von "Rauchern" um rund 7 Prozent. Zusammenfassend ergibt sich somit (analog dem Vieltrinken) im Zeitraum 1993 bis 1998 kein signifikanter Anstieg der "fast täglich" beziehungsweise "drei- bis viermal pro Woche" rauchenden Jugendlichen.
Beim Gebrauch illegaler Drogen ist es nicht möglich, vergleichbare Häufigkeiten wie beim Tabak- oder Alkoholkonsum anzugeben. So fehlen zum Beispiel Angaben zur Nutzung von Opioiden, Kokain oder Halluzinogenen. Nennenswerte Gebrauchsdaten liegen lediglich zu Cannabisprodukten (Marihuana und Haschisch) sowie MDMA (Ecstasy) vor. In Tabelle 4 sind die Häufigkeiten des Konsums dieser beiden Substanzen zusammengestellt. Dabei handelt es sich sowohl um "Probierer" (Häufigkeitskategorie "weniger als einmal im Monat") als auch um Schülerinnen und Schüler, die im 3-Monats-Prävalenzzeitraum mehrfach konsumierten (Häufigkeitskategorien "ein- bis dreimal im Monat" oder "wöchentlich").Bei einem Vergleich der Prozentzahlen der Nutzung illegaler Drogen mit den Angaben zum Konsum der legalen Drogen Tabak und Alkohol ist deshalb ausdrücklich darauf zu verweisen, dass es sich beim Gebrauch illegaler Drogen auch um Schüler mit Probierverhalten, bei den legalen psychotropen Substanzen aber ausschließlich um die Angaben zum Vielgebrauch handelt ("Vieltrinker" und "Gewohnheitsraucher").
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Anzahl der Probierer von Cannabis vervierfacht sich von 1995 zu 1997. Diese Entwicklung setzt sich im Folgejahr in geringerem Ausmaß fort. Der Anstieg von 1993 bis 1998 ist auf dem 5 % - Niveau signifikant. Bei der Partydroge Ecstasy zeigt sich ein geringfügiger (nicht signifikanter) Abwärtstrend des Probierverhaltens von 1997 zu 1998. Eine Stichprobe von N = 879 Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Geburtsjahrgänge wurde in den Jahren 1993 -1998 jeweils in der 7. Klassenstufe hinsichtlich des Gebrauchs psychotroper Substanzen befragt. Bei identischen Erhebungsinstrumenten, gleichem Prävalenzzeitraum und Befragungsablauf ließ sich für die 13jährigen Schülerinnen und Schüler aus Leipzig und Dresden kein signifikanter Anstieg des Konsums legaler Drogen und Ecstasy registrieren. Der Konsum von Haschisch zeigte eine signifikante Zunahme im Zeitraum von 1993 bis 1998, während der Gebrauch von Ecstasy für die untersuchte Altersgruppe leicht abnahm. Die Zahl der Nutzer und die Gebrauchsmengen liegen aber auf einem relativ niedrigem Niveau. Die Alltagsmeinung, "immer mehr Jugendliche nehmen Drogen", konnte somit für die untersuchte Altersgruppe sächsischer Jugendlicher in ihrer Allgemeinheit empirisch nicht bestätigt werden.
Von Interesse ist bei epidemiologischen Daten zum Substanzgebrauch natürlich auch der Vergleich des Konsumverhaltens von Jugendlichen in den neuen und alten Bundesländern. Der Vergleichbarkeit sind dabei aber enge Grenzen gesetzt. Es gibt in der deutschsprachigen Literatur keine Studie, die der vorgestellten Untersuchung bezüglich Befragungsinstrument (Angabe von Gebrauchsmenge und -frequenz), Prävalenzzeitraum (Drei-Monats-Prävalenz), gleiches Erhebungsalter (13 Jahre) zu vier Meßpunkten (von 1993 bis 1998) entspricht. Alle repräsentativen Untersuchungen fassen die Alterszeiträume sehr weit. So weisen die Bundesstudie zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen (Herbst, Kraus & Scherer 1996) sowie die Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (1998) Gebrauchsangaben für die Lebensjahre 14 -25 aus. Diese Daten scheiden somit für einen Vergleich mit den vorliegenden Ergebnissen völlig aus. Zumindest einen punktuellen Bezugswert können aber Einzelstudien liefern. Von Lösel und Bliesener (1998) wurden 1.162 Jugendliche der siebten und achten Klassen (Altersdurchschnitt 14,01 Jahre, Monatsprävalenz) in Nürnberg und Erlangen zu ihrem Substanzkonsum befragt. Die Autoren ermittelten einen Prozentsatz von 29,2 % der Mädchen (Jungen 19,7 %), die "mehrmals in der Woche" bis "praktisch täglich" rauchten. Bier, Wein oder Sekt tranken rund 10 % der Jugendlichen "mehrmals in der Woche" bis "praktisch täglich" (Likör/Spirituosen: 4,7 % der Jungen und 2,8 % der Mädchen). Keine Geschlechtsunterschiede fanden sich beim Gebrauch illegaler Drogen. Der Prozentsatz der Probierer und häufigeren Nutzer lag bei 11,5 %. Die Nürnberger Jugendlichen geben also im Vergleich mit den Leipziger Stichproben bei allen Substanzarten einen zum Teil beträchtlich höheren Gebrauch an. Allerdings gestatten Unterschiede in Alter, Prävalenzzeitraum und den Gebrauchskategorien keine weiterreichende Interpretation.
Der Wert der vorliegenden Studie liegt nicht im Bezug zu anderen Untersuchungen, sondern im Quersequenzdesign: Der Befragung unterschiedlicher Geburtsjahrgänge in den Jahren 1993 -1998 jeweils in der 7. Klassenstufe hinsichtlich des Gebrauchs psychotroper Substanzen mit identischen Erhebungsinstrumenten, gleichem Prävalenzzeitraum und Befragungsablauf. Festzuhalten bleibt, dass sicherlich für jeden Jugendlichen die Entwicklungsaufgabe besteht, den eigenen Weg hinsichtlich des Konsums von Alkohol, Tabak und illegale Drogen zu bestimmen. Wir helfen dem Einzelnen dabei aber vielleicht weniger durch ständige Verweise auf eine apokalyptische Bedrohung durch Drogen als durch sachliche Informationen, Vorbildwirkung und Bemühungen um Alternativen zum Substanzmißbrauch.“
Die Frage, ob Drogenkonsum eine jugendspezifische Sache ist, läßt sich für mich eindeutig verneinen. Sicherlich liegt der Beginn des Drogenkonsums in der Jugend. Während der Drogenkonsum bei Jugendlichen eher auffällig ist, hat es der Erwachsene Mensch geschafft, den Drogenkonsum in sein Leben zu integrieren. Der Jugendliche lernt die Substanz erst kennen. Deshalb weiß er noch nicht, wann er zu viel konsumiert oder wann die Droge eine zu große Rolle in seinem Leben spielt. Er ist zunächst begeistert und es besteht die Gefahr, dass er anfängt sich über die Droge zu identifizieren. So führt es zu einem auffälligen Anstieg des Konsums. Der Erwachsene hat bereits einen Kompromiss zwischen Drogenkonsum und gesellschaftlichem Leben entwickelt. Solange er eine gewisse Stoffmenge nicht überschreitet, fällt er auch nicht auf. Der Familienvater trinkt sich sein Bier nach Feierabend. Der Cannabiskonsum ist auch in der Erwachsenenwelt verbreitet. Kokain und Amphetamin sind ebenfalls in manchen gesellschaftlichen Kreisen akzeptiert und integriert. Lediglich Opiate bilden hier eine Ausnahme, weil die Abhängigkeit und die daraus resultierenden Beschaffungsmaßnahmen ein gesellschaftliches Leben in den allermeisten Fällen unmöglich machen. Natürlich schafft nicht jeder Erwachsene die Integration der Droge in sein Leben. So enden viele Alkoholiker letztenendes auf der Straße. Das gleiche gilt auch für andere Drogen, wobei diese Menschen dann ein Leben führen, dass „mehr schlecht als recht“ ist oder irgendwann im Apparat der Psychiatrie endet.
Die folgenden Zahlen sprechen für sich (aus dem Internet6 ) :
„Rufen wir uns die Zahlen über Drogengebrauch bzw. Drogenmißbrauch kurz ins Gedächtnis. Im Jahrbuch Sucht 94 - herausgegebenen von der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren - werden folgende Zahlen genannt:
-5% aller Deutschen gelten als suchtkrank.
-2,5 Millionen Deutsche sind alkoholabhängig,
-1,4 Millionen Bundesbürger sind tablettenabhängig,
-150.000 Deutsche gelten als heroin- bzw. kokainabhängig,
-17 Millionen rauchen,
-3 Millionen gelten als Cannabis-User.“
Ein sehr wichtiger Aspekt ist weiterhin der gesellschaftliche Umgang mit Medikamenten.
Medikamentenabhängigkeit ist ebenfalls ein verbreitetes und zugleich unauffälliges Phänomen.
Im Internet fand ich dazu den folgenden Text7:
„Der Drogenkonsum von Jugendlichen ist und bleibt ein Problem. In einer neueren Studie wird deutlich, dass die Benutzung des elterlichen Apothekenschranks oft den Einstieg in eine spätere Drogensucht bedeutet. 30 Prozent der Jugendlichen zwischen 13 und 17 greifen Studien zufolge regelmäßig zu Medikamenten. Vorbilder seien Erwachsene, sagte der Bielefelder Professor Klaus Hurrelmann (...). "Junge Menschen lernen bereits in frühen Jahren den Umgang mit Arzneimitteln kennen." Die entscheidende Rolle spielen die Eltern. Sie prägen durch ihr Verhalten die Einstellung der Heranwachsenden zu Pillen, Kapseln und Tropfen, kritisierte der Jugendforscher. (...) Zehn Prozent der Jugendlichen seien nach dem Ergebnis von Untersuchungen Konsumenten von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, sechs Prozent hätten Erfahrungen mit Aufputschmitteln. Rund 40 Prozent der Mädchen im neunten Schuljahr geben nach den Worten von Hurrelmann häufige Kopfschmerzen an. Dies stelle eine besondere Gefahr dar, meinte der Professor. Bei Kopfschmerzen werde meist in den Medizinschrank der Eltern gegriffen, so dass hier die häufigste Ursache für den unkontrollierten Arzneimittelkonsum bei Kindern und Jugendlichen gesehen werden müsse. Jugendliche glaubten "permanent funktionieren zu müssen" und dem Leistungsanspruch nicht gerecht werden zu können. Je früher die Kinder daran gewöhnt werden, Tabletten zu schlucken, umso größer werde die Gefahr der Sucht. "Wenn die Tablette zum Alltag wird, ist der Schritt zu Designerdrogen, wie zum Beispiel Ecstasy, nicht mehr weit", erklärte Hurrelmann. Über 50 Prozent der jugendlichen Ecstasy-Konsumenten gaben an, vorher schon regelmäßig Medikamente genommen zu haben.“
Die Frage nach den generationstypischen Differenzen halte ich für sehr schwierig zu beantworten. Besonders Vergleiche der Generationen vor 1900 sind sehr schwer, da es kaum verwertbares empirisches Material geben wird. Man müßte sich auf Literaturrecherchen beschränken.
Der Drogenkonsum, als Droge jetzt ausschließlich Alkohol, hat eine Tradition. Es gab in jeder Epoche der Geschichte Alkoholabhängige. Der Alkohol war außerdem durchgehend in allen Bevölkerungsschichten beliebt. Dieses kann ich nur über die mitteleuropäische Geschichte sagen, da ich mich in der Geschichte anderer Kulturen nicht auskenne. Weiterhin ist bekannt, dass das Opium rauchen aus der chinesischen Tradition kommt. Wie der Konsum allerdings dort verbreitet war, weiß ich nicht. In den Haaren einiger ägyptischen Mumien wurden Bestandteile der Kokapflanze und Nikotin nachgewiesen. Alle diese Tatsachen zeigen aber, dass Drogenkonsum nicht ein Phänomen ist, welches sich auf unsere Kultur und Zeit beschränkt.
Drogen wie Heroin, Kokain, LSD und Ecstasy haben ihre Geschichte im 20. Jahrhundert. 1906 erschien die erste deutsche Ausgabe des „Traktat für Opiumraucher“, welcher in Europa ziemlich populär wurde.
Die Geschichte des Heroin beginnt in den USA. Es gab dort Opiumsalons, in denen regelmäßig Künstlerkreise verkehrten. Die daraus hervorgekommenen Opiumabhängigen wurden versucht mit dem Opiumderivat Morphium zu kurieren, was zur Folge hatte, dass sie daraufhin vom Morphium abhängig wurden. Gegen die Morphiumsucht wurde dann von der Pharmaindustrie ein neues Wundermittel, Heroin, entwickelt.
Anfang der deißiger Jahre lebten dann viele Mafiosis vom Heroinhandel. Heroinabhängige sind aus der damaligen blühenden Jazzszene nicht wegzudenken.
Nach Europa kam das Heroin dann am Ende des zweiten Weltkrieges mit den GIs. Auch Cannabis gelangte über die GIs nach Europa zurück und wurde zur Mode.
Während der Hanf und seine Produkte anfänglich nur in intellektuellen Kreisen populär gewesen war, gehörten ihm die darauffolgenden sechziger Jahre und die dazugehörige Beat- Szene. Diese Subkultur erweiterte am Ende des Jahrzehnts das Drogenspektrum um Halluzinogene. Hier spielten vor allem LSD und Meskalin eine Rolle. Aus diesem Kontext stammt der berühmte Ausspruch des Musikers Donovan : „Wer sich an die Sechziger erinnern kann, war nicht dabei.“ In Californien tauchte in dieser Zeit das erste Mal MDMA, das von der Firma Merck als Schlankheitsmittel entwickelt wurde, als Droge auf. Es war bei den Hippies als „Kuscheldroge“ bekannt. Jedoch soll dieser Stoff dann erst zwanzig Jahre später wieder in der Technokultur der 90er Jahre als Ecstasy auftauchen. Die Drogen dieser Zeit haben viele Ideale der Hippikultur wie Ausdruckstanz, Zufriedenheit der Hippigemeindschaften, freie Liebe und intensives Gemeinschaftsgefühl erst möglich gemacht.
Bis zur Mitte der Siebziger Jahre hat dann eine Aufspaltung der Subkulturen stattgefunden. In dieser Zeit ließen sich nun bestimmte Drogen ziemlich klar bestimmten Szenen zuordnen. Die Discojugend bevorzugte Speed und Amphetamine, die tänzerische und sexuelle Ausdauer versprechen. Die Reggaeszene konnte und kann nicht ohne den dazugehörigen Cannabiskonsum betrachtet und verstanden werden. Während diese Subkultur Alkohol wegen seines Agressivitätspotentials ablehnte war er bei Psycho- und Rockabillies, Heavies und Punks höchst beliebt und Kultobjekt. „Live fast, die young“ und „no future“ sind ihre Schlagwörter.
Aus dieser Grundeinstellung erweitern Anfang der achtziger Jahre viele Punks konsequenterweise ihr Drogen-Reportoire um Heroin. In dieser Zeit wird Kokain zur bevorzugten Drogen der Yuppys. Bei den Subkulturen schwarzer Jugendlicher in den USA wurde Crack, neben Cannabis, zur angesagten Droge erklärt. Diese Droge konnte sich jedoch in Europa nicht etablieren. Hier bevorzugen die Anhängern dieser Subkulturen, zum Beispiel Hip-Hop oder Rap, Cannabis, jedoch dafür in größeren Mengen, als es je zuvor üblich war. Somit ließ sich das Ideal „cool zu sein“ am einfachsten verwirklichen.
Die Generation der neunziger Jahre entwickelte wieder eine völlig neue Perspektive im Rahmen der Technokultur. Hier ist Ecstasy die gefragteste Droge. Weiterhin spielt Amphetamin eine bedeutende Rolle. Kokain ist ebenfalls auf dem Vormarsch in die Clubs. Innerhalb dieser Subkultur ist der Cannabiskonsum selbstverständlich und wird von den Anhängern nicht mehr als „richtige Droge“ betrachtet. Es ist beispielsweise üblich, nach dem Ecstasykonsum Cannabis zu sich zu nehmen, um die negativen Nachwirkungen zu verringern. Man benutzt Cannabis auch um sich von anderen Drogen „runter zu kiffen“ oder deren Wirkung mit Cannabis zu beeinflussen. Die Mentalität dieser Subkultur unterscheidet sich auch maßgeblich von denen der Vergangenheit. Liebe und Gewaltlosigkeit sind erneut Ideale. Im Gegensatz zu dem Star- und Personenkult der Musikszenen der Vergangenheit gibt es im Rahmen der elektronischen Musik keine Star- und Personenkulte. Die Künstler stehen eher im Hintergrund und sind nie auf den CD- oder Schallplattencovers abgebildet. Drogen werden nicht als Alternative zum gesellschaftlichen Leben gesehen sondern in das Leben integriert. Der Widerspruch zwischen Drogenkonsum und gesellschaftlicher Integration wurde scheinbar aufgelöst. In den siebziger Jahren wurde ein Heroinabhängiger innerhalb seines subkultutellen Rahmens noch als „echter Outlaw“ bewundert während er heute von den meisten Gleichaltrigen als Verlierer angesehen würde. Viele Anhänger der Technokultur gehen in der Woche ihrer beruflichen oder schulischen Ausbildung nach und „feiern“ am Wochenende.
Abschließend möchte ich bemerken, dass die Konsumenten dieser neuen Drogen in einer Gesellschaft aufwuchsen, in der es normal und akzeptiert ist, Drogen, in Form von Alkohol, zu konsumieren. Die Jugendlichen der Neunziger Jahre und die folgende Jugend wächst in einer Gesellschaft auf, in der auch die illegalen Drogen von ihrer Elterngeneration konsumiert wurden.
[...]
1 Berliner Morgenpost vom 11.8.1997
2 http://www.bundestag.de/aktuell/wib95/2195192.htm
3 http://www.awo.org/awomag/ausgaben/1999_05/0599_55.html
4 Institut für Entwicklungspsychologie, Persönlichkeitspsychologie und Psychodiagnostik der Universität Leipzig
5 Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden
6 http://www.techno.de/frontpage/95-05/hahrens.html (ein Text des Soziologen Helmut Ahrens)
Häufig gestellte Fragen zu "Jugendliche und Drogenkonsum"
Worum geht es in diesem Text?
Der Text befasst sich mit dem Thema Drogenkonsum bei Jugendlichen in Deutschland. Er analysiert verschiedene Aspekte, darunter die Medienberichterstattung, die Prävalenz des Drogenkonsums, die Unterschiede zwischen legalen und illegalen Drogen, die Rolle des Elternhauses und die generationstypischen Unterschiede im Drogenkonsum.
Welche Arten von Drogen werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt sowohl legale Drogen wie Alkohol, Nikotin und Koffein als auch illegale Drogen wie Cannabis (Marihuana, Haschisch), Ecstasy (MDMA), LSD, Kokain, Speed, Heroin und Opium.
Wie wird die Medienberichterstattung über Drogenkonsum bei Jugendlichen im Text bewertet?
Der Text kritisiert die Medienberichterstattung als oft undifferenziert und sensationalistisch. Es wird bemängelt, dass häufig Einzelschicksale und Horrormeldungen im Vordergrund stehen, ohne ein umfassendes Bild der Realität des Drogenkonsums zu vermitteln.
Welche Studien zum Drogenkonsum bei Jugendlichen werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt mehrere Studien, darunter eine Studie des Deutschen Bundestages, eine Studie des AWO-Magazins und eine Studie aus dem Ärzteblatt Sachsen von H. Petermann, M. Schmidt und M. Scholz. Die Studie aus dem Ärzteblatt Sachsen wird detaillierter analysiert.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie aus dem Ärzteblatt Sachsen?
Die Studie aus dem Ärzteblatt Sachsen, die Schüler der 7. Klassenstufe in Sachsen untersuchte, fand keinen signifikanten Anstieg des Konsums legaler Drogen und Ecstasy im Zeitraum von 1993 bis 1998. Der Konsum von Haschisch zeigte jedoch eine signifikante Zunahme. Die Autoren der Studie kamen zu dem Schluss, dass die Alltagsmeinung, "immer mehr Jugendliche nehmen Drogen", für die untersuchte Altersgruppe sächsischer Jugendlicher in ihrer Allgemeinheit empirisch nicht bestätigt werden konnte.
Wie bewertet der Text die Rolle des Elternhauses beim Drogenkonsum von Jugendlichen?
Der Text betont die wichtige Rolle des Elternhauses bei der Prägung der Einstellung von Jugendlichen zu Drogen. Er weist darauf hin, dass der Umgang der Eltern mit Medikamenten einen Einfluss auf das Konsumverhalten der Jugendlichen haben kann. Der Text erwähnt eine Studie, die zeigt, dass der Gebrauch des elterlichen Apothekenschranks oft den Einstieg in eine spätere Drogensucht bedeutet.
Welche generationstypischen Differenzen im Drogenkonsum werden im Text diskutiert?
Der Text geht auf die Geschichte des Drogenkonsums im 20. Jahrhundert ein und beschreibt, wie sich der Konsum verschiedener Drogen im Laufe der Zeit verändert hat und mit unterschiedlichen Subkulturen verbunden war. Er hebt hervor, dass der Drogenkonsum in der Technokultur der 1990er Jahre in das gesellschaftliche Leben integriert wurde und dass illegale Drogen von der Elterngeneration konsumiert werden.
Was ist die Schlussfolgerung des Textes?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass es wichtig ist, Jugendliche sachlich über Drogen zu informieren, ihnen Vorbilder zu bieten und Alternativen zum Substanzmissbrauch aufzuzeigen. Er betont, dass der Drogenkonsum nicht nur ein Problem der Jugendlichen ist, sondern auch ein gesellschaftliches Problem, das alle Altersgruppen betrifft.
- Arbeit zitieren
- Volker Müller (Autor:in), 2001, Jugendliche und Drogenkonsum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100918