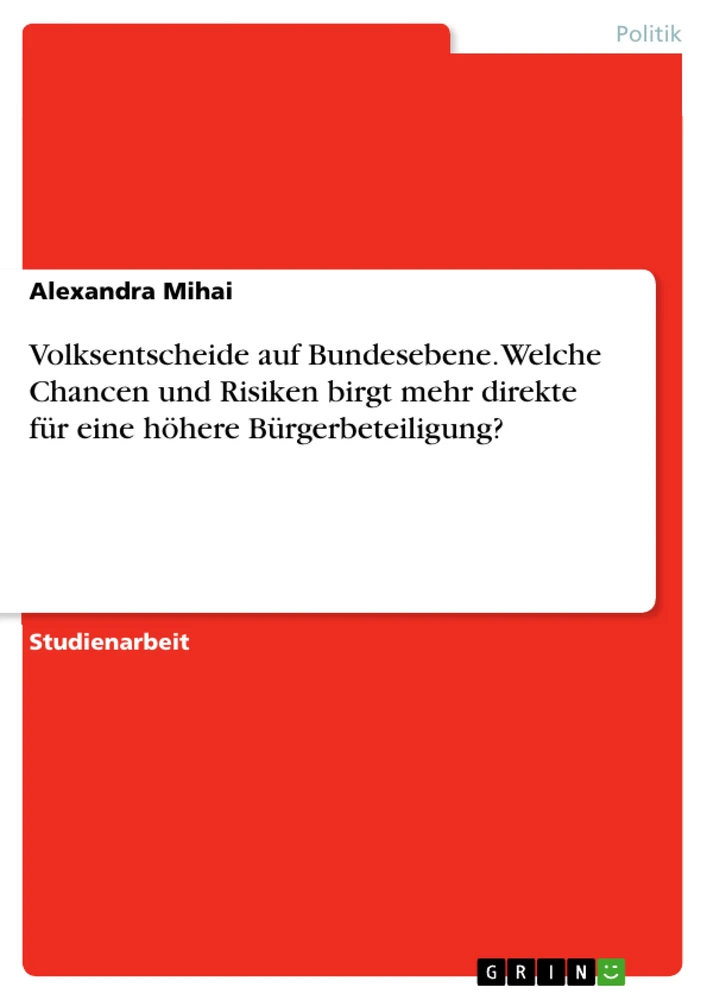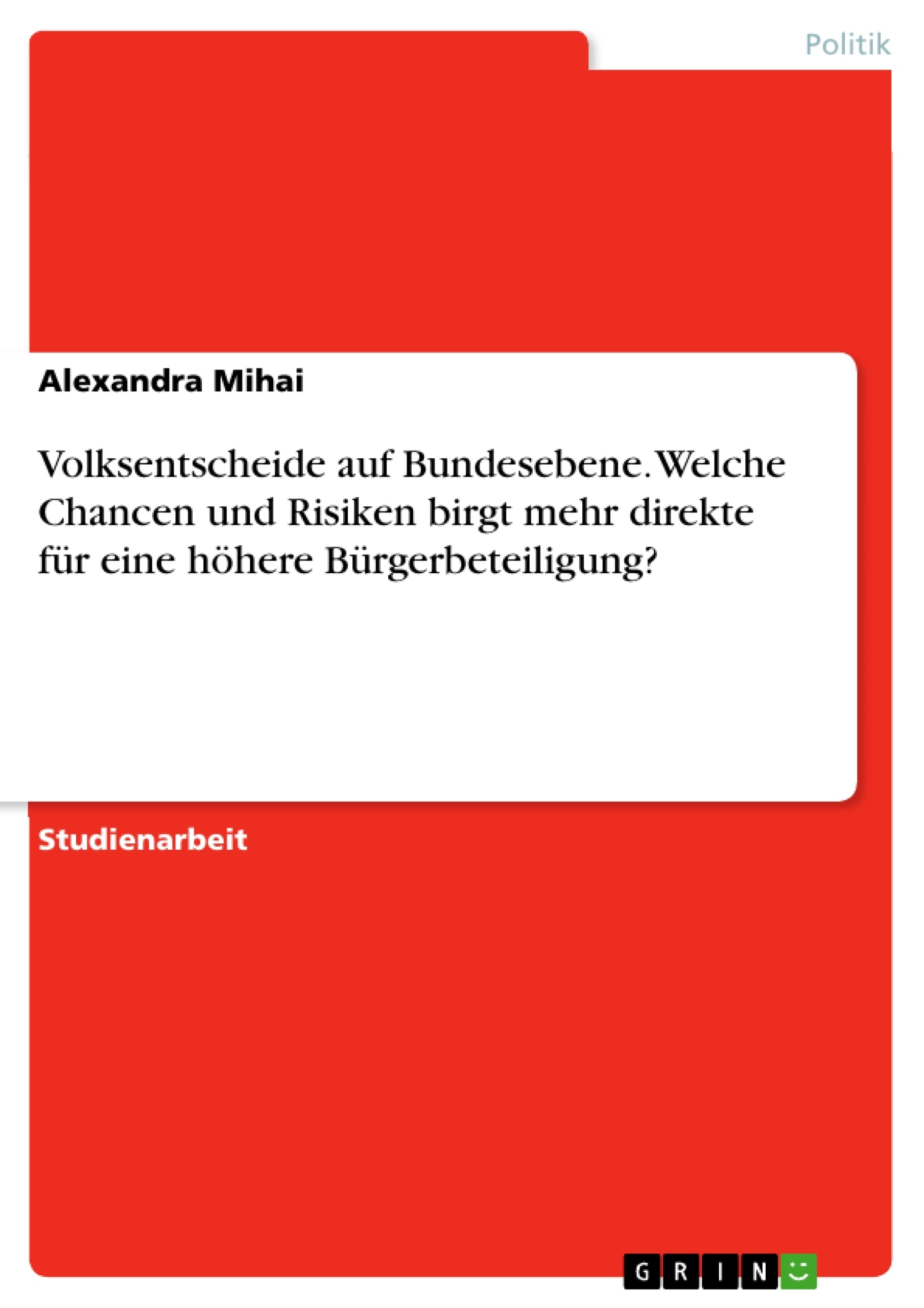In der Arbeit geht es um die Wirkung von Volksentscheiden auf die Bürgerbeteiligung. Dazu werden im ersten Schritt das Demokratieprinzip, die direkte und die repräsentative Demokratie definiert. Moeckli (2018) und Kost (2019) bieten dazu eine dezidierte Übersicht. Dann werden konkrete Instrumente direkter Demokratie aufgezeigt. Der Fokus hier liegt auf den Referenden, der Volksinitiative, dem Volksbegehren und dem Volksentscheid. Im Anschluss daran wird aufgezeigt, in welchem Maße direktdemokratische Elemente auf Kommunal- und Landesebene bereits institutionalisiert sind. Die dann folgende Gegenüberstellung von Pro- und Contra Argumenten eröffnet eine differenzierte Sichtweise auf die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene. Schlussendlich fasst das Fazit die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, dass Volksentscheide in der ganzen Gesellschaft für einen breiten Diskussionsprozess sorgen. Dennoch geht die Meinung über den Nutzen von Volksentscheiden im politischen Diskurs weit auseinander. Obwohl eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung die Einführung direktdemokratischer Elemente befürwortet, scheiterte es bisher an der Umsetzung. Befürworter argumentieren mit gesteigertem Beteiligungsbedürfnis auf Seiten der Bevölkerung, wohingegen Gegner eine Entwertung des Parlaments und eine erhöhte Polarisierung befürchten. Diese Debatte führt zu der Leitfrage dieser Ausarbeitung, welche Chancen und Gefahren die Einführung direktdemokratischer Beteiligungsformen auf Bundesebene birgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1 Demokratieprinzip.
- 2.2 Direkte Demokratie.
- 2. 3 Repräsentative Demokratie.
- 3. Erscheinungsformen direkter Demokratie..
- 3.1 Referenden...........
- 3.2 Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid.
- 4. Direkte Demokratie auf Kommunal- und Länderebene
- 4.1 Referenden in der Praxis............
- 4.2 Volksinitiative in der Praxis
- 4.3 Volksbegehren und Volksentscheide in der Praxis
- 5. Direkte Demokratie auf Bundesebene
- 5.1 Argumente für Volksentscheide..
- 5.1.1 Legitimität durch Art. 20 Abs. 2.
- 5.1.2 Themenspezifische Partizipation .......
- 5.1.3 Weniger Politikverdrossenheit..
- 5.2 Argumente gegen Volksentscheide.
- 5.2.1 Schwächung der parlamentarischen Demokratie....
- 5.2.2 Fehlende Verantwortlichkeit und Gemeinwohlorientierung
- 5.2.3 Exklusionsbegünstigung bestimmter sozialer Gruppen....
- 5.2.4 Polarisierung...
- 5.2.5 Schlechte Vereinbarkeit mit dem Föderalismuskonzept..\li>
- 5.2.6 Negative Erfahrungen in der Weimarer Republik.
- 5.1 Argumente für Volksentscheide..
- 6. Fazit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Chancen und Risiken die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene für eine höhere Bürgerbeteiligung birgt. Sie analysiert die verschiedenen Formen der direkten und repräsentativen Demokratie, untersucht die aktuelle Situation in Deutschland, insbesondere auf kommunaler und Landesebene, und betrachtet die Argumente für und gegen die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene.
- Die Rolle der direkten Demokratie im politischen System der Bundesrepublik Deutschland.
- Die Funktionsweise von Volksentscheiden und ihre Auswirkungen auf die Bürgerbeteiligung.
- Die potenziellen Chancen und Risiken der Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene.
- Die Argumentation für und gegen direktdemokratische Elemente im deutschen politischen System.
- Die Bedeutung der Volkssouveränität im Kontext von direkter Demokratie.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Notwendigkeit der Diskussion über die Einführung von Volksentscheiden in Deutschland. Kapitel 2 definiert grundlegende Begriffe wie Demokratieprinzip, direkte und repräsentative Demokratie, um einen gemeinsamen Bezugsrahmen für die weitere Analyse zu schaffen. Kapitel 3 stellt die verschiedenen Erscheinungsformen der direkten Demokratie vor, wobei der Fokus auf Referenden, Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid liegt. Kapitel 4 untersucht die aktuelle Praxis der direkten Demokratie auf kommunaler und Länderebene in Deutschland. Kapitel 5 analysiert die Argumente für und gegen die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet eine abschließende Bewertung der Chancen und Risiken von Volksentscheiden für die Bürgerbeteiligung in Deutschland.
Schlüsselwörter
Direkte Demokratie, repräsentative Demokratie, Volksentscheid, Bürgerbeteiligung, Volkssouveränität, Föderalismus, Politikverdrossenheit, Legitimität, Partizipation, Weimarer Republik.
- Quote paper
- Alexandra Mihai (Author), 2021, Volksentscheide auf Bundesebene. Welche Chancen und Risiken birgt mehr direkte für eine höhere Bürgerbeteiligung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1011061