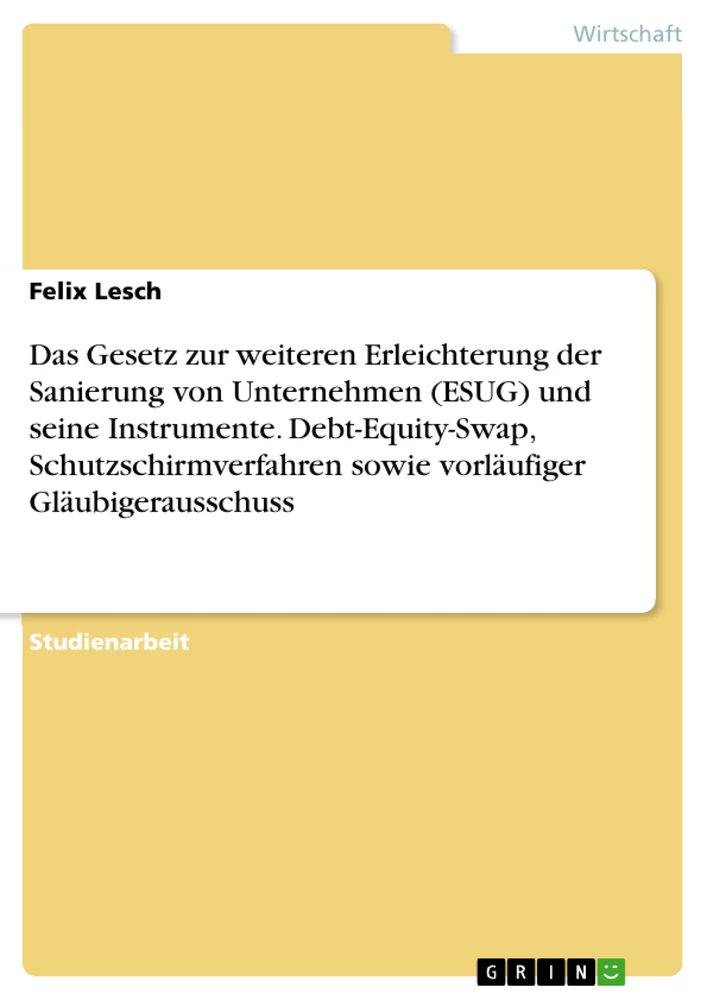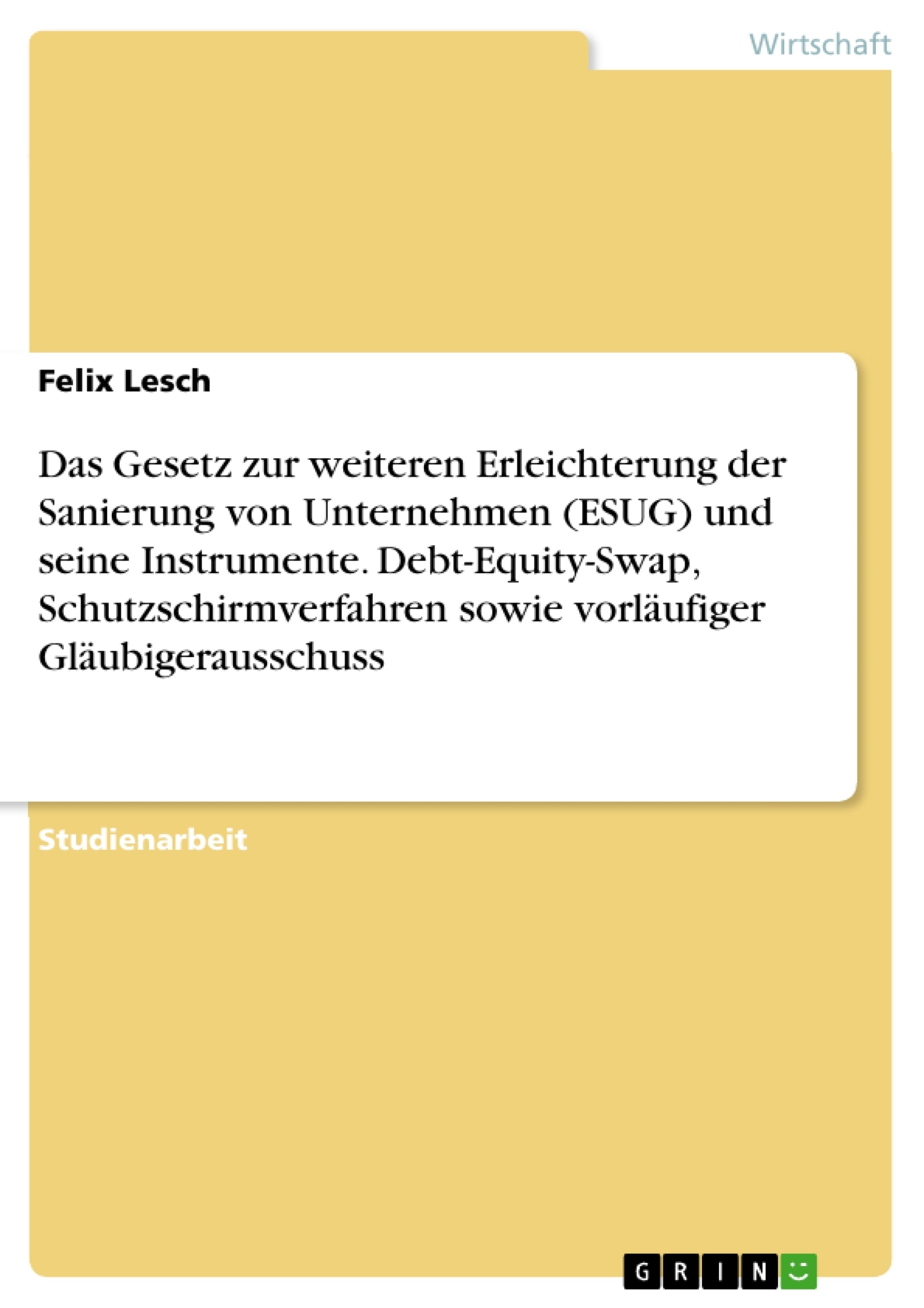Dieses Essay untersucht die Instrumente des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG).
Zu Beginn dieses Essays werden der Anlass für die Inkraftsetzung des ESUG und die Charakteristika des Gesetzes beleuchtet, bevor anschließend Zahlen und Beispiele die praktische Relevanz des ESUG illustrieren. Nachfolgend werden drei Instrumente des ESUG näher thematisiert. Hierbei wird mit dem Debt-Equity-Swap begonnen, sowie das Schutzschirmverfahren und der vorläufige Gläubigerausschuss erläutert. Zu jedem der drei Instrumente werden zunächst allgemeine Eigenschaften vorgestellt, bevor die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert werden.
Zielsetzung dieses Essays ist es zu überprüfen, inwieweit die Intention des Gesetzgebers, eine Sanierungskultur in Deutschland zu etablieren, durch die Einführung des ESUG erreicht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Gang der Arbeit
- ESUG
- Anlass und Zielsetzung des ESUG
- Zahlen und Beispiele zum ESUG
- Instrumente des ESUG
- Debt-Equity-Swap
- Allgemeine Informationen zum Debt-Equity-Swap
- Vor- und Nachteile des Debt-Equity-Swaps
- Schutzschirmverfahren
- Allgemeine Informationen zum Schutzschirmverfahren
- Vor- und Nachteile des Schutzschirmverfahrens
- Vorläufiger Gläubigerausschuss
- Allgemeine Informationen zum vorläufigen Gläubigerausschuss
- Vor- und Nachteile des vorläufigen Gläubigerausschusses
- Fazit
- Zielerreichung
- Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Essay analysiert das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) und untersucht seine Instrumente im Kontext des Turnaround Managements. Das Hauptziel ist es, die Problemstellung der Unternehmenskrise und die Rolle des ESUG bei der Bewältigung dieser Krise zu beleuchten. Es werden verschiedene Instrumente des ESUG, wie z.B. Debt-Equity-Swap und Schutzschirmverfahren, vorgestellt und deren Vor- und Nachteile diskutiert.
- Die Rolle des ESUG bei der Überwindung von Unternehmenskrisen
- Die Analyse von Instrumenten des ESUG zur Sanierung von Unternehmen
- Die Evaluierung der Vor- und Nachteile verschiedener ESUG-Instrumente
- Die Erörterung der praktischen Anwendung des ESUG durch Zahlen und Beispiele
- Die Betrachtung der Perspektiven für die zukünftige Anwendung des ESUG
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Unternehmenskrise und die Zielsetzung des ESUG vor. Sie beleuchtet auch den Hintergrund der Entstehung des ESUG im Kontext der Insolvenzordnung. Das zweite Kapitel widmet sich dem ESUG an sich, erläutert dessen Anlass und Zielsetzung und veranschaulicht die praktische Relevanz des Gesetzes durch Zahlen und Beispiele. Das dritte Kapitel widmet sich den Instrumenten des ESUG und analysiert detailliert den Debt-Equity-Swap, das Schutzschirmverfahren und den vorläufigen Gläubigerausschuss. Für jedes Instrument werden allgemeine Eigenschaften vorgestellt, sowie Vor- und Nachteile diskutiert. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse des Essays zusammen und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Anwendung des ESUG.
Schlüsselwörter
Das Essay konzentriert sich auf die Erleichterung der Unternehmenssanierung, das ESUG, Turnaround Management, Unternehmenskrise, Insolvenzordnung, Debt-Equity-Swap, Schutzschirmverfahren, vorläufiger Gläubigerausschuss, Vor- und Nachteile, praktische Relevanz, Perspektiven.
- Quote paper
- Felix Lesch (Author), 2020, Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) und seine Instrumente. Debt-Equity-Swap, Schutzschirmverfahren sowie vorläufiger Gläubigerausschuss, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1011814