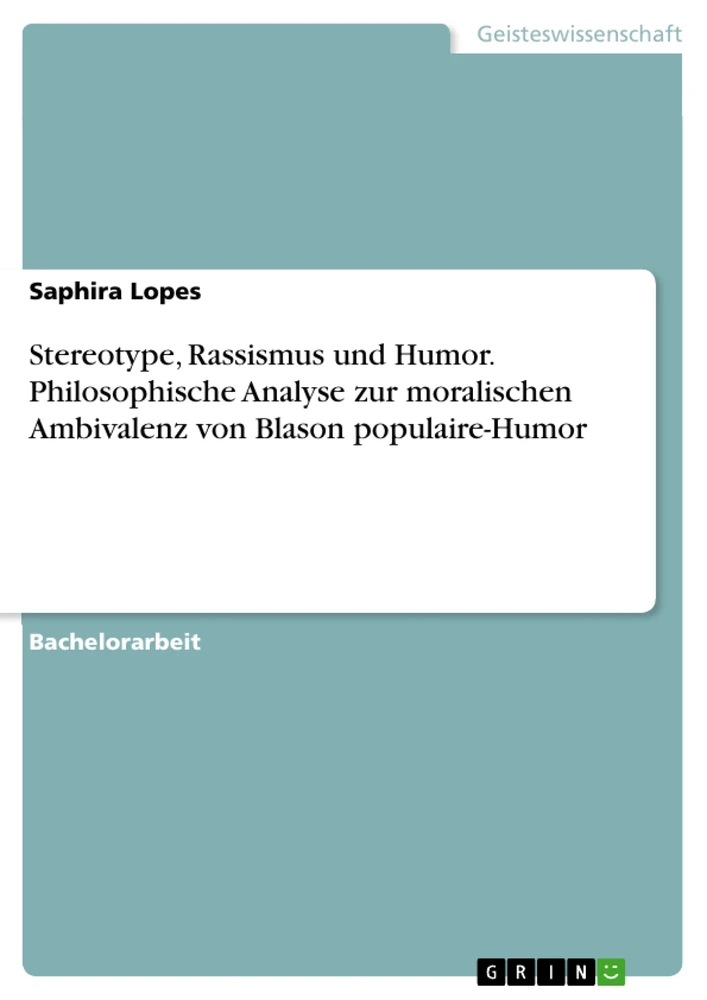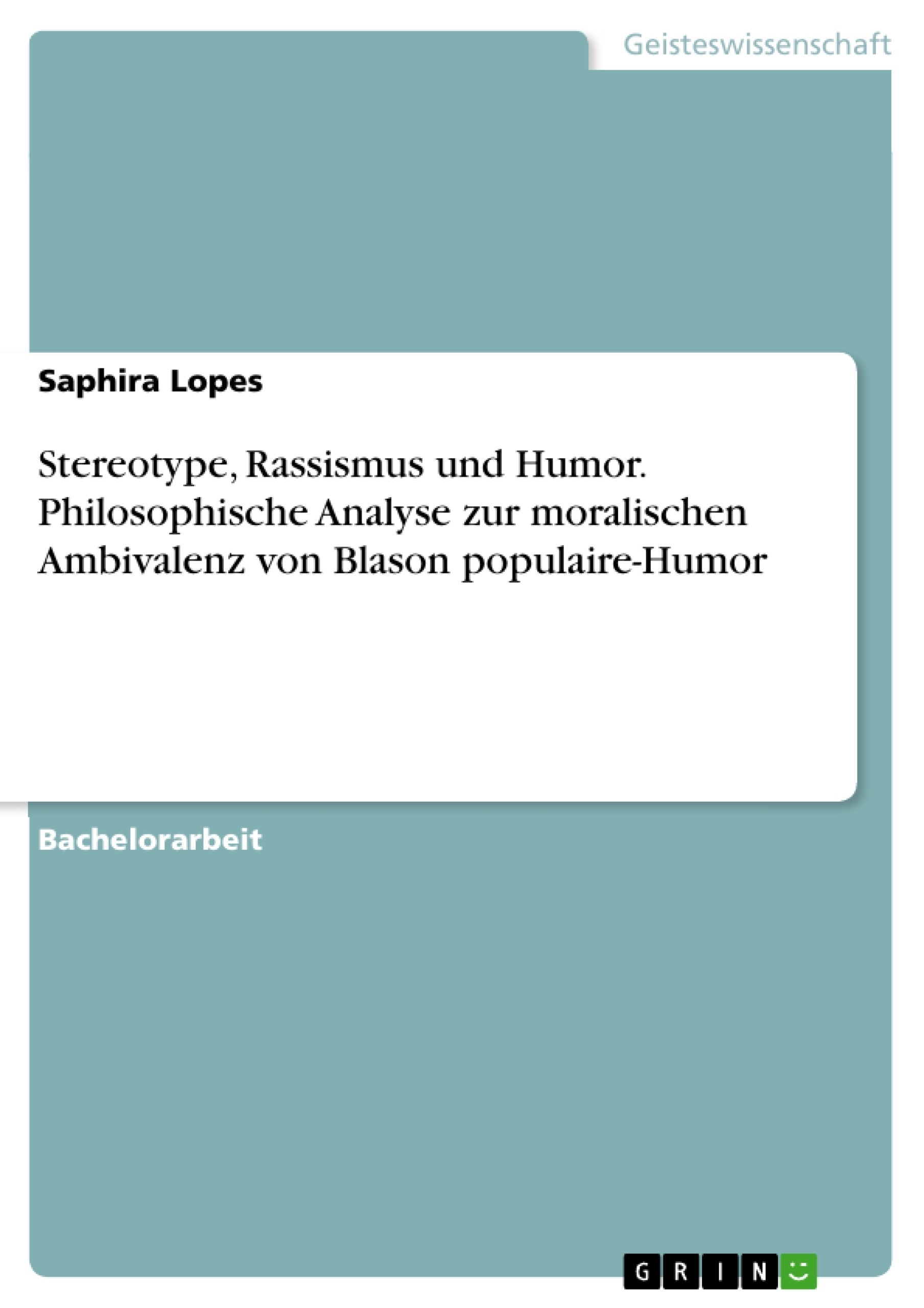Humor kann schockieren, beleidigen, verletzen und sogar als Entschuldigung dienen. Und dennoch wird Humor stets als etwas Positives gehandelt. Diese Arbeit soll jedoch die Kehrseite unseres Vergnügens aufzeigen. Während das Phänomen Humor von der Philosophie bislang eher vernachlässigt wurde, gilt hier das Hauptinteresse einer spezifischen Form des Humors: dem Blason populaire-Witz. Ziel ist es, den Witz aus seinem gewöhnlichen Spaßmodus herauszunehmen und in einen philosophischen Diskurs einzubetten. Die Schwierigkeit dabei besteht in der Polysemie von Witzen. Sie können verschiedene Funktionen und Bedeutungen zur gleichen Zeit haben, was wiederum zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten offen lässt. Humor stellt somit eine äußerst ambivalente Kommunikationsform dar.
Vor diesem Hintergrund soll untersucht werden, inwiefern Blason populaire-Witze moralische Relevanz haben können. Zur Realisierung dieses Vorhabens wird wie folgt vorgegangen:
Kapitel 2 bildet den theoretischen Rahmen, der für die Untersuchungen im späteren Verlauf grundlegend ist. Es werden daher zunächst die Begriffe Lachen, Humor und Witz eingeführt und erläutert (2.1), um anschließend drei Theorien des Humors herauszuarbeiten (2.2). In einem nächsten Schritt richtet sich der Fokus auf die verbalisierte Humorform des Witzes (2.3). Daraufhin wird in Anknüpfung an die Charakterisierung des ethnischen Witzes der in dieser Arbeit präferierte Terminus der Blason populaire vorgestellt. Nationale oder ,ethnische' Stereotype stellen ein wesentliches Element von Blason populaire-Witzen dar. Demnach illustriert Kapitel 3, wie die besagten Stereotype von rassistischen Stereotypen zu unterscheiden sind (3.1). Hierfür ist es notwendig, einen adäquaten Erklärungsansatz des Rassismusbegriffs darzulegen (3.2). Dieser kurze Einblick hilft uns auch dabei, in Kapitel 4 die Problematik von Blason populaire-Witzen zu erschließen. Im ersten Abschnitt werden ausgewählte Blason populaire-Witze anhand ihrer verwendeten Stereotype analysiert und evaluiert (4.1.1). Indem die moralische Verwerflichkeit von Stereotypen herausgearbeitet wird (4.1.2), kann darauf aufbauend zur kritischen Diskussion von Blason populaire-Witzen übergeleitet werden (4.1.3). Dabei gilt es zudem zu klären, wie sich die im Vorangegangenen erörterte Problematik zum Erzähler und Publikum (4.1.4) sowie zur Aufrechterhaltung des Blason populaire-Witzes verhält (4.2). Die Arbeit schließt in Kapitel 5 mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Humor und Witz
- 2.1 Begrifflichkeiten: Lachen, Humor und Witz
- 2.2 Traditionelle Humortheorien
- 2.2.1 Überlegenheitstheorie
- 2.2.2 Entspannungstheorie
- 2.2.3 Inkongruenztheorie
- 2.3 Analyse: Witz und Witzkommunikation
- 2.3.1 Erfolg und Misserfolg eines Witzes
- 2.3.2 Ethnische Witze oder die Blason populaire
- 3. Stereotype und Rassismus
- 3.1 Raciale und Racist Stereotype
- 3.2 Rassismus – Versuch einer Definition
- 4. Stereotype, Rassismus und Humor
- 4.1 Witz und Moral
- 4.1.1 Blason populaire-Witze: Eine Analyse
- 4.1.2 Stereotype und Moral
- 4.1.3 Zwischen Witz und Wirklichkeit
- 4.1.4 Ich lache, also bin ich?
- 4.2 Schluss mit lustig?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die moralische Ambivalenz von Blason populaire-Humor, also Witzen, die auf nationalen oder ethnischen Stereotypen basieren. Ziel ist es, diesen Humor aus seinem üblichen Kontext des reinen Spaßes herauszulösen und in einen philosophischen Diskurs einzubetten, um seine potenziell problematischen Aspekte zu beleuchten. Die Arbeit analysiert, wie Blason populaire-Witze funktionieren, welche Rolle Stereotype dabei spielen und wie diese Witze moralisch bewertet werden können.
- Definition und Abgrenzung von Lachen, Humor und Witz
- Analyse traditioneller Humortheorien
- Unterscheidung zwischen racialen und rassistischen Stereotypen
- Moralische Bewertung von Blason populaire-Witzen
- Der Einfluss von Erzähler und Publikum auf die Wirkung des Witzes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der moralischen Ambivalenz von Humor ein, insbesondere im Kontext von Blason populaire-Witzen (ethnischen Witzen). Sie betont die bisherige Vernachlässigung des Humors in der philosophischen Forschung und benennt das Ziel der Arbeit: eine philosophische Analyse der moralischen Relevanz von Blason populaire-Witzen. Die Arbeit skizziert den methodischen Aufbau, der sich auf die Analyse von Witzen, Stereotypen und ihrer moralischen Dimension konzentriert.
2. Humor und Witz: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Arbeit. Es beginnt mit einer Klärung der Begriffe Lachen, Humor und Witz, wobei die Unterschiede und Überschneidungen herausgearbeitet werden. Anschließend werden drei klassische Humortheorien (Überlegenheits-, Entspannungs- und Inkongruenztheorie) vorgestellt. Der Fokus liegt schließlich auf der verbalen Form des Witzes und den Faktoren, die seinen Erfolg oder Misserfolg beeinflussen. Der Begriff "Blason populaire" wird als präferierter Terminus für ethnische Witze eingeführt.
3. Stereotype und Rassismus: Kapitel 3 befasst sich mit der Unterscheidung zwischen racialen und rassistischen Stereotypen. Es wird ein Erklärungsansatz für den Rassismusbegriff präsentiert, um im folgenden Kapitel die moralische Problematik von Blason populaire-Witzen besser zu verstehen. Dieses Kapitel liefert das notwendige Hintergrundwissen, um die moralischen Implikationen von Stereotypen im Kontext von Humor zu analysieren.
4. Stereotype, Rassismus und Humor: Das zentrale Kapitel der Arbeit analysiert die moralische Problematik von Blason populaire-Witzen. Ausgewählte Witze werden anhand ihrer verwendeten Stereotype untersucht und bewertet. Die moralische Verwerflichkeit von Stereotypen wird herausgearbeitet und in die Diskussion über Blason populaire-Witze eingebunden. Es wird untersucht, wie sich die erörterte Problematik auf Erzähler, Publikum und die Aufrechterhaltung dieser Art von Humor auswirkt.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Moralische Ambivalenz von Blason populaire-Humor
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die moralische Ambivalenz von Blason populaire-Humor, also Witzen, die auf nationalen oder ethnischen Stereotypen basieren. Sie analysiert, wie diese Witze funktionieren, welche Rolle Stereotype spielen und wie sie moralisch bewertet werden können.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Lachen, Humor und Witz; Analyse traditioneller Humortheorien (Überlegenheits-, Entspannungs- und Inkongruenztheorie); Unterscheidung zwischen racialen und rassistischen Stereotypen; Moralische Bewertung von Blason populaire-Witzen; Der Einfluss von Erzähler und Publikum auf die Wirkung des Witzes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Humor und Witz (inkl. Begriffsklärung und Humortheorien), Stereotype und Rassismus (inkl. Definition von Rassismus), Stereotype, Rassismus und Humor (Hauptteil mit Analyse von Blason populaire-Witzen) und Fazit.
Welche Humortheorien werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert drei klassische Humortheorien: die Überlegenheitstheorie, die Entspannungstheorie und die Inkongruenztheorie.
Wie wird der Begriff "Blason populaire" verwendet?
Der Begriff "Blason populaire" wird als präferierter Terminus für ethnische Witze verwendet.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, Blason populaire-Humor aus dem Kontext des reinen Spaßes herauszulösen und in einen philosophischen Diskurs einzubetten, um seine potenziell problematischen Aspekte zu beleuchten.
Wie werden die Witze analysiert?
Ausgewählte Blason populaire-Witze werden anhand ihrer verwendeten Stereotype untersucht und moralisch bewertet. Die Arbeit betrachtet den Einfluss von Erzähler und Publikum auf die Wirkung der Witze.
Welche Rolle spielen Stereotype in der Arbeit?
Die Arbeit unterscheidet zwischen racialen und rassistischen Stereotypen und untersucht deren Rolle in Blason populaire-Witzen und deren moralische Implikationen.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass Blason populaire-Witze eine moralische Ambivalenz aufweisen, da sie auf Stereotypen basieren, die potenziell diskriminierend und verletzend sein können.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutiert die Implikationen für das Verständnis von Humor und Moral. (Der genaue Inhalt des Fazits ist im vorliegenden Auszug nicht vollständig enthalten.)
- Citar trabajo
- Saphira Lopes (Autor), 2019, Stereotype, Rassismus und Humor. Philosophische Analyse zur moralischen Ambivalenz von Blason populaire-Humor, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1012533