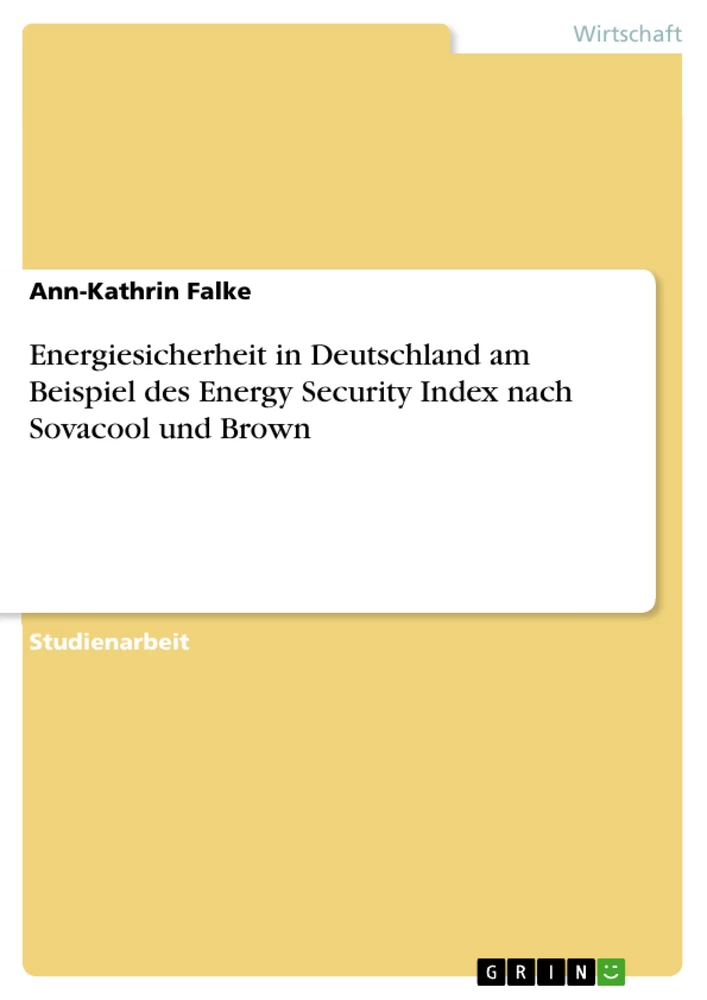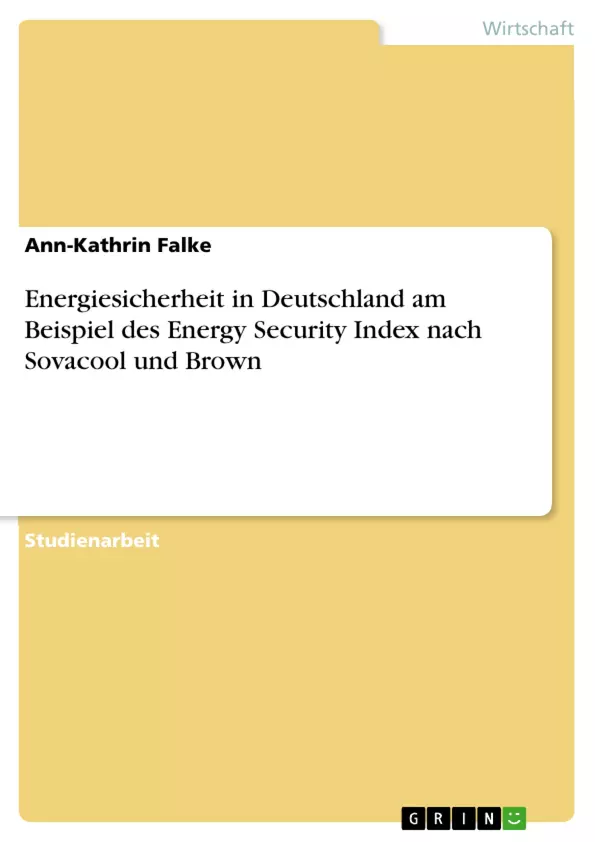In dieser Arbeit ist es Ziel zu hinterfragen, wie es um die Energiesicherheit in verschiedenen Ländern steht und wie die Energiesicherheit in Deutschland zu bewerten ist. Im Folgenden wird deshalb die Energiesicherheit von 24 OECD-Ländern anhand des Energiesicherheitskonzeptes von Sovacool und Brown (2010) bemessen und bewertet. Anschließend wird eine genaue Analyse der Energiesicherheit in Deutschland vorgenommen.
Die Sicherstellung einer zuverlässigen, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Energieversorgung ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon im April 2010 und die Russische Invasion in Afghanistan 1979 markieren nur einige wenige große Energieschocks der jüngeren Geschichte. Neben schwerwiegenden Folgen für die Umwelt, sind wirtschaftliche Verluste zu verzeichnen. "Knapp 800 Millionen Liter Öl schossen nach der Explosion der Ölplattform ins Meer, ehe das vom britischen Ölkonzern BP betriebene Bohrloch gut drei Monate später gestopft werden konnte". In Afghanistan gingen nach der Bombardierung von sowjetische Öl- und Gaspipelines, mehr als 500 Tonnen Petroleum am Tag verloren.
Doch nicht nur Energieschocks beeinflussen die Energiesicherheit eines jeden Landes. Der zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen der Vereinten Nationen dokumentierte, dass die Verwendung fossiler Brennstoffe die Hauptursache für die Zunahme der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre ist, die wiederum die mittlere Temperatur der Erde ansteigen lassen. 1,2 Milliarden Menschen auf der Welt leiden zudem unter Stromarmut. Die Haushalte in Entwicklungsländern sind meist nicht an das Stromnetz angeschlossen oder eine sichere Stromversorgung kann nicht gewährleistet werden. "Energiemangel hemmt die Entwicklung von Landwirtschaft und Gewerbe. […] Ohne Kühlung und Maschinen arbeiten Krankenhäuser nur unzureichend. In Afrika gehen Millionen Kinder in Schulen ohne genügend Beleuchtung und Durchlüftung. Erst recht bleiben ihnen ohne Strom eine Ausbildung am Computer und der Zugang zum Internet verwehrt".
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Schlüsselfaktoren der Energiesicherheit nach Hake und Rath-Nagel
- 2.2 Definition Energiesicherheit nach Sovacool und Brown
- 2.2 Der Energy Security Index nach Sovacool und Brown
- 3. Methodisches Vorgehen
- 4. Diskussion der Ergebnisse
- 4.1 Energiesicherheit im Vergleich der OECD Länder
- 4.2 Energiesicherheit in Deutschland
- 4.2.1 Energieverfügbarkeit
- 4.2.2 Energiebezahlbarkeit
- 4.2.3 Energieeffizienz
- 4.2.4 Energieumweltfreundlichkeit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Energiesicherheit in Deutschland anhand des Energy Security Index nach Sovacool und Brown. Sie untersucht die wichtigsten Faktoren, die die Energiesicherheit beeinflussen, und bewertet die Performance Deutschlands im Vergleich zu anderen OECD-Ländern. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Energiesicherheitslage Deutschlands zu zeichnen und die wichtigsten Herausforderungen und Chancen im Hinblick auf eine nachhaltige und sichere Energieversorgung aufzuzeigen.
- Die Schlüsselfaktoren der Energiesicherheit nach Hake und Rath-Nagel
- Die Definition der Energiesicherheit nach Sovacool und Brown
- Die Anwendung des Energy Security Index auf Deutschland
- Der Vergleich der Energiesicherheitsleistung Deutschlands mit anderen OECD-Ländern
- Die Herausforderungen und Chancen für eine nachhaltige und sichere Energieversorgung in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema Energiesicherheit ein und beleuchtet die Bedeutung einer zuverlässigen, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Energieversorgung. Es werden wichtige Energieschocks der jüngeren Geschichte und deren Folgen für die Umwelt und Wirtschaft aufgezeigt.
Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen der Energiesicherheit. Es werden die Schlüsselfaktoren nach Hake und Rath-Nagel sowie die Definition der Energiesicherheit nach Sovacool und Brown erläutert. Darüber hinaus wird der Energy Security Index vorgestellt, der in der Arbeit zur Bewertung der Energiesicherheit in Deutschland eingesetzt wird.
Kapitel 3 erläutert das methodische Vorgehen der Arbeit. Es wird die Vorgehensweise bei der Anwendung des Energy Security Index auf Deutschland beschrieben und der Vergleich mit anderen OECD-Ländern dargestellt.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Analyse. Es werden die Energiesicherheitsleistungen Deutschlands in Bezug auf die einzelnen Dimensionen des Energy Security Index (Energieverfügbarkeit, Energiebezahlbarkeit, Energieeffizienz und Energieumweltfreundlichkeit) sowie die Ergebnisse des Vergleichs mit anderen OECD-Ländern vorgestellt.
Schlüsselwörter
Energiesicherheit, Energy Security Index, Sovacool und Brown, Hake und Rath-Nagel, Energieverfügbarkeit, Energiebezahlbarkeit, Energieeffizienz, Energieumweltfreundlichkeit, OECD-Länder, Deutschland, nachhaltige Energieversorgung.
- Quote paper
- Ann-Kathrin Falke (Author), 2018, Energiesicherheit in Deutschland am Beispiel des Energy Security Index nach Sovacool und Brown, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1012778