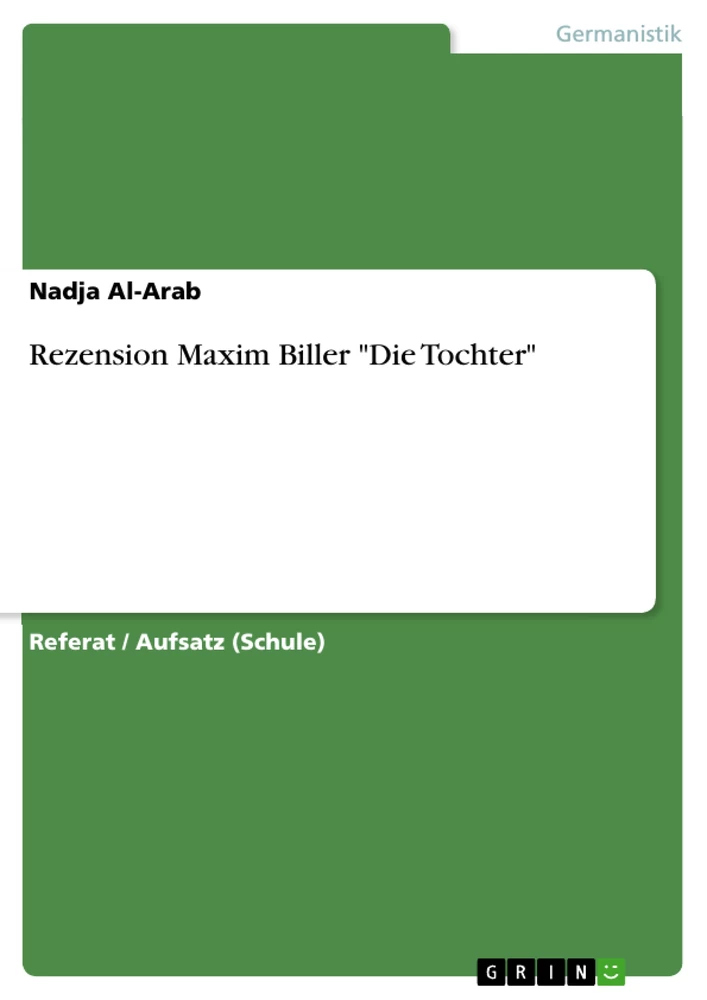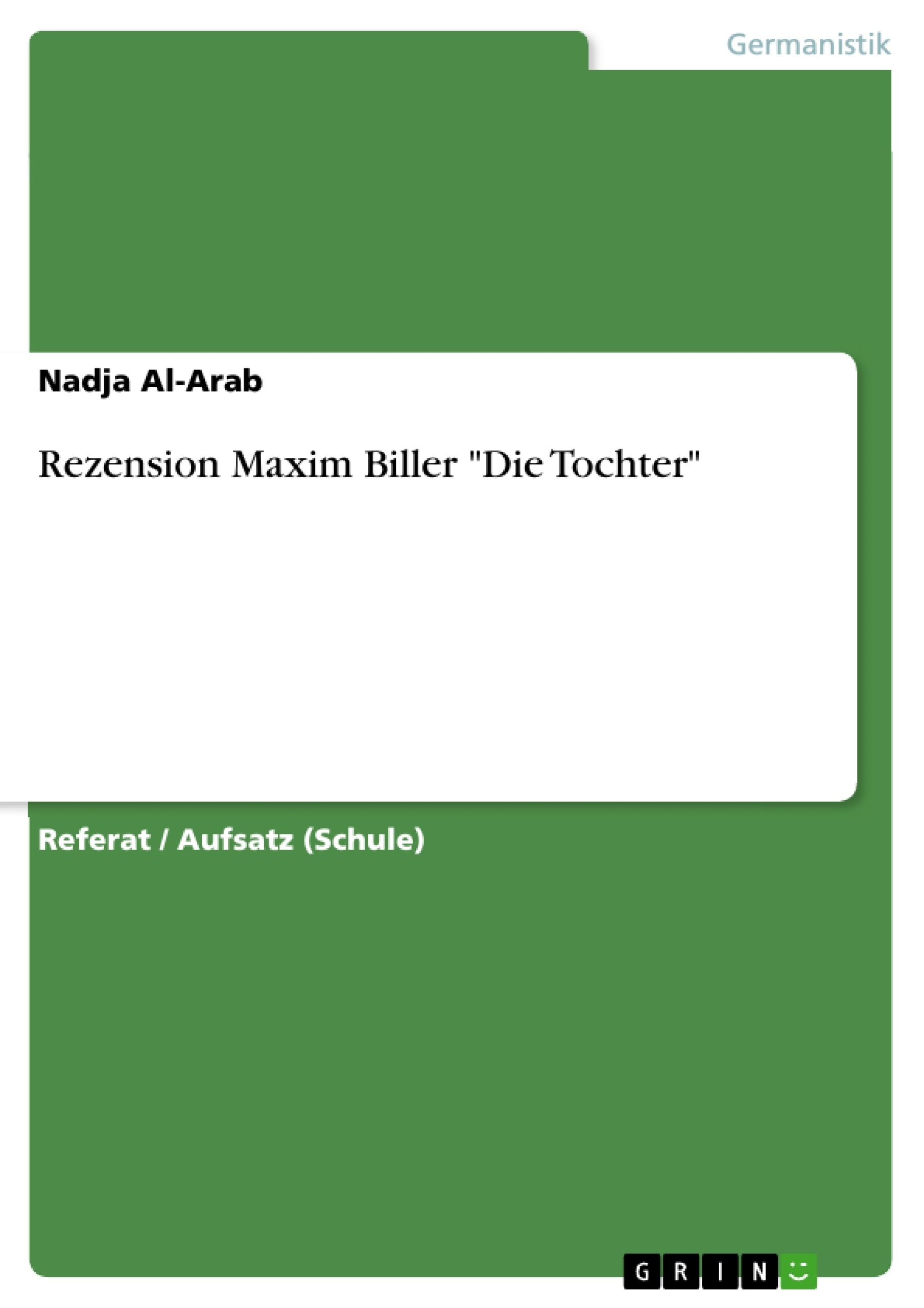Kampf um die Wahrheit
Rezensionüber Maxim Billers Roman-Debüt ,,Die Tochter", erschienen bei Kiepenheuer & Witsch
,,Schwein, Schwein, Schwein. Immer lauter und lauter würde das Wort von allen Seiten seines Schädels widerhallen, aber es wäre nicht nur dort, in seinem Kopf, es wäre auch draußen, es wäre überall um ihn herum, es wäre in dem eisigen schwarzen Wind, gegen den er sich beim Gehen stemmen würde, es wäre unter seinen Füßen, in den silbernen funkelnden Pflastersteinen des Bürgersteigs, es wäre in den grauen Sträuchern und Bäumen, die wie riesiges Märchenunkraut in der Mitte der orangeschimmernden, nächtlichen Vorortstraße wuchsen. Schwein-Schwein-Schwein."
Mottis Leben ist ein Albtraum. Die Schuld, die er im Libanonkrieg auf sich geladen hat, wiegt so schwer, dass er ihr nicht entfliehen kann. Sie zerfrisst ihn, macht ihn aggressiv, vernebelt ihm das Bewusstsein und lässt ihn wiederum neue Schuld auf sich laden. Er lebt als Jude in einer ihm feindlichen Welt, die nie die seine werden kann - in Deutschland. Seine Frau Sofie hat ihn verlassen und ihm sein geliebtes Kind entrissen. Mühsam bestreitet er seinen Lebensunterhalt mit Thora-Stunden für konvertierungswillige deutsche Frauen, obwohl ihm selbst der innere Bezug zum jüdischen Glauben fehlt. Sein innigster Wunsch ist der, nach Israel heimzukehren mit seiner Tochter Nurit, die nur so seltsam geworden ist, weil sie abgeschnitten von ihrer wahren Heimat leben muss.
Den Auftakt des Romans bildet eine Szene, die in ihrer Obszönität direkt einen Keil zwischen Leser und Hauptfigur treibt. Motti liegt onanierend auf dem Bett, stimuliert durch ein Pornovideo, dessen Akteurin seine eigene Tochter ist, die er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Hier schon wird eine Inzest-Geschichte angedeutet, die sich im Verlauf des Romans mehr und mehr konkretisiert, und auch in entsprechend drastischer Sprache dargestellt wird. Nach diesem schockierenden und ebenso irritierenden Beginn wird die Lebensgeschichte Mottis in vielen kleinen Episoden erzählt. Der Leser erfährt diese allerdings gebrochen durch die gestörte und verzerrte Wahrnehmung der Hauptfigur, die mit Halluzinationen und Erinnerungslücken durchsetzt ist, so dass sich die Geheimnisse um Mottis Person und seiner Tochter Nurit erst nach und nach enthüllen, wobei die Enthüllungen immer eine Spur von Zweifel hinterlassen.
Im Zentrum des Romans steht die Darstellung der, in einer perfiden Weise hartnäckigen, selektiven Wahrnehmung der Hauptfigur Motti, durch die fortwährend bestehende Klischees und Feindbilder genährt werden, und die darüber hinaus auch den Umgang mit seinem eigenen schuldhaften Verhalten bestimmt. Diese Vorurteile entsprechen vordergründig, in Form eines Gut-und-Böse-Schemas, dem Verhältnis zwischen Juden und Deutschen. In an Ironie grenzender Häufigkeit finden sich unter Mottis Schülerinnen deutsche Frauen mit harten, fast männlichen Gesichtszügen und kräftiger Statur, dabei von einer emotionalen Kälte und einem Egoismus, die einem Massenmörder zu Gesichte stünden. Keine dieser Frauen hat aus Liebe zu ihrem Mann ein Interesse an dessen Kultur - nein, ein allgegenwärtiger Schuldkomplex treibt sie in die Arme der jüdischen Religion und in das Bett des sie verkündenden Lehrers. Wäre da nicht der bösartige und hasserfüllte Ton, den der Autor Motti zukommen lässt, man wäre an manchen Stellen sogar versucht zu lachen. Auf der anderen Seite stehen die Träume von der Aliah, der Rückkehr ins sonnige und lebensfrohe Israel, wo alles so viel besser ist als in ,,Sofies Totenland". Doch Biller entlarvt dieses üble Spiel mit den griffbereiten Klischees, denn Mottis Repertoire an Verunglimpfungen erschöpft sich nicht mit der deutschen Seite, auch die Hakennase, die Besserwisserstirn, der Assyrerbart oder die jüdische Überheblichkeit schmücken seine Urteile über die eigenen Glaubensgenossen.
Ebenso erinnert er sich - obwohl hier Verdrängungsmechanismen immer wieder hemmend einwirken - an Israel als einen Ort, wo Chaos, Lärm und Schmutz den Alltag prägen, und die ewig währende Bedrohung von außen ein Leben in ständiger Angst bedingt, wobei ihm die Ruhe und rücksichtsvolle Höflichkeit in Deutschland als wohltuend erscheinen. Diese werden allerdings schnell wieder zur Grabesruhe und gehemmten Feigheit, wenn Mottis innerer Hass seine Wahrnehmung bestimmt. In diesen Widersprüchen offenbart sich, dass Billers Anti- Held seine Urteile nicht etwa aufgrund gewonnener Erfahrungswerte fällt, sondern getrieben von der eigenen Unzufriedenheit seine Aggressionen in der plumpen Übernahme gängiger Projektionen entlädt. Gleichzeitig verweigert er sich damit der Wahrheit, letztlich an keinem Ort dieser Erde sein Glück finden zu können.
Nun stellt sich natürlich die Frage, warum gerade ein Jude als unsympathische, mit Vorurteilen behaftete, kinderschändende Hauptfigur in einem deutschsprachigen Roman herhalten muss und nicht ein Deutscher?
Man könnte Maxim Biller die Lust am Tabubruch unterstellen, doch die Antwort ist denkbar einfach. Die Darstellung des Mechanismus, der es bewirkt, dass alte Feindbilder aufrecht erhalten werden, also das Prinzip, seine Wahrnehmung durch ein Negativ-Raster zu filtern, um seine eigene angeschlagene Persönlichkeit zu überhöhen, konnte hier nur aus Sicht der jüdischen Perspektive geschehen, da im umgekehrten Falle - gesetzt der Deutsche sollte scheinbar begründete Kritik an den ,,Juden" haben und sich schließlich als ,,Schwein" entpuppen - nicht funktionieren würde. Zum einen, weil die zu verwendenden jüdischen Klischees den deutschen Lesern des Jahres 2000 kaum mehr präsent sind, zum anderen, weil im Verhältnis zwischen Deutschen und Juden im kollektiven Bewusstsein des deutschen Volkes ohnehin fest verankert ist, dass der Deutsche das ,,Schwein" sein muss.
Hier erweist sich Billers jüdische Abstammung als Vorteil, denn einem nicht-jüdischen Autor würde man gerade in Deutschland eine derartige Konstruktion übel nehmen. Ein Aspekt, der die Brisanz dieses Themas noch erhöht, ist, dass Motti, der im Libanonkrieg zum Täter wurde, gerade nach Deutschland flieht, dem Land, in dem ihm die klassische Opferrolle zukommt. Hier leistet das Buch in gewisser Weise Aufklärungsarbeit, indem es auch auf die gegenwärtigen Probleme des Staates Israel verweist und nicht, wie sonst üblich, den Blick nur in die Vergangenheit richtet.
So stellt sich der Protagonist dem Leser als eine von Krieg und Gewalt - vielmehr von der eigenen Fähigkeit zur Gewaltausübung traumatisierte Figur dar. Diese seelischen Verwüstungen werden mit bewundernswerter sprachlicher Intensität umgesetzt. Als ob sie ihre eigenen Gedanken festhalten müsste, lässt Biller die Hauptfigur stets einzelne Wörter oder Satzteile ihres Gedankenflusses in einer Art Selbstvergewisserung wiederholen. An anderer Stelle dient das gleiche Stilmittel dazu, Mottis infantile Aggressivität zum Ausdruck zu bringen, oder auch als wahnhafter Widerhall seiner ihn selbstanklagenden inneren Stimme. Der Autor findet eine Vielzahl von treffenden Bildern und sprachlichen Formen, die diesen Zustand einer akuten Psychose plastisch umsetzen
Leider schafft es Biller mit ebenso großer Virtuosität, diesen Eindruck wieder zu zerstören, und dass, nachdem der Leser sich schon durch einige Längen hat hindurchmühen müssen. Den äußerst kunstvollen Erzählrahmen, der einen Tag aus dem Leben des Protagonisten schildert, in dessen Verlauf mittels Rückblenden seine gesamte Lebensgeschichte erzählt wird, lässt er völlig überraschend zugunsten eines nur unzureichend verifizierten Ich- Erzählers platzen. Dieser zu Beginn des Romans vereinzelt auftauchende und wie ein Fremdkörper in der personalen Perspektive wirkende Erzähler tritt plötzlich gegen Ende des Romans gehäuft in Erscheinung, um sich schließlich ganz zu etablieren.
Die Übergangsphase vor dem endgültigen Perspektivenwechsel erscheint hier derart konstruiert und inhomogen, dass der Leser dieser eigentümlichen Logik nicht mehr folgen kann oder mag. Um so schwerer fällt es, die Pointe dieser Konstruktion zu akzeptieren - die Offenbarung des Ich-Erzählers als Autor der Geschichte. In beinahe vergnüglich- vertraulichem Ton berichtet dieser nun, dass er es sei, der inspiriert durch einen Bekannten namens Motti, diese Geschichte erfunden habe. Er legt noch einige Quellen dar und verkündet im Plauderton, wie er gedenkt fortzufahren. Dann verschwindet dieser wieder, um dem Ende des Romans Platz zu machen.
Jener Einfall, die Fiktionalität einer Geschichte innerhalb einer Erzählung offen zu legen, die allenfalls als Stoff für eine Kurzgeschichte über literarische Prozesse hätte herhalten können, sprengt nicht nur die Form des Romans, sie löst auch die zuvor aufgebaute Intensität der Darstellung auf und führt die bis dahin eingenommene Erzählhaltung ad absurdum. Gleichermaßen befremdend wirkt der Bruch auf der sprachlich-stilistischen Ebene, der durch einen sich anschließenden, in biblischer Sprache gehaltenen Epilog noch verschärft wird. Dieser ,,Kunstgriff" erscheint wie eine Attacke auf den eigenen Roman, geboren aus der Lust an der Zerstörung traditioneller Erzählformen, jedoch nicht im Sinne einer Erneuerung, sondern eher wie ein abrupt vollzogener Schlussstrich unter ein ehrgeizig begonnenes Werk. Am Ende des Buches steht der Leser vor dem Trümmerhaufen eines Romans, der, nachdem der Ich-Erzähler den Erzählrahmen bereits aufgelöst hat, zu allem Überfluss auch noch an den Buchauftakt zurückkehrt, um die ganze kunstvoll errichtete Geschichte plötzlich zu einem Traum zu erklären.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Rezension ,,Kampf um die Wahrheit"?
Die Rezension befasst sich mit Maxim Billers Roman-Debüt ,,Die Tochter". Sie analysiert die Handlung, die Charaktere und die zentralen Themen des Romans.
Wer ist Motti, die Hauptfigur in ,,Die Tochter"?
Motti ist ein Jude, der im Libanonkrieg traumatisiert wurde und nun in Deutschland lebt. Er ringt mit Schuldgefühlen, Identitätsproblemen und seiner Beziehung zu seiner Tochter Nurit.
Welche Themen werden im Roman behandelt?
Der Roman behandelt Themen wie Schuld, Kriegstrauma, Antisemitismus, jüdische Identität, sexuelle Obsessionen und die Schwierigkeit, mit der Vergangenheit umzugehen.
Wie wird Mottis Wahrnehmung im Roman dargestellt?
Mottis Wahrnehmung wird als verzerrt und selektiv dargestellt. Er neigt dazu, Klischees und Feindbilder zu reproduzieren, um seine eigene angeschlagene Persönlichkeit zu überhöhen.
Was kritisiert die Rezension am Roman?
Die Rezension kritisiert vor allem den plötzlichen Perspektivenwechsel am Ende des Romans, bei dem ein Ich-Erzähler auftritt und die Geschichte als Fiktion offenbart. Dies wird als stilistischer Bruch und Zerstörung der zuvor aufgebauten Intensität empfunden.
Warum wird die jüdische Perspektive im Roman als Vorteil gesehen?
Die jüdische Perspektive wird als Vorteil gesehen, da sie es dem Autor ermöglicht, Klischees und Vorurteile aus einer Insider-Perspektive zu thematisieren, ohne Gefahr zu laufen, selbst des Antisemitismus beschuldigt zu werden.
Wie beurteilt die Rezension das sprachliche Niveau des Romans?
Die Rezension lobt Billers sprachliche Intensität und seine Fähigkeit, den Zustand einer akuten Psychose plastisch umzusetzen. Gleichzeitig kritisiert sie jedoch den stilistischen Bruch am Ende des Romans.
Was ist das Fazit der Rezension?
Das Fazit der Rezension ist enttäuschend. Der Rezensent bedauert den Verlust eines potenziell sehr guten Romans aufgrund der stilistischen Schwächen am Ende des Buches.
- Arbeit zitieren
- Nadja Al-Arab (Autor:in), 2000, Rezension Maxim Biller "Die Tochter", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101382