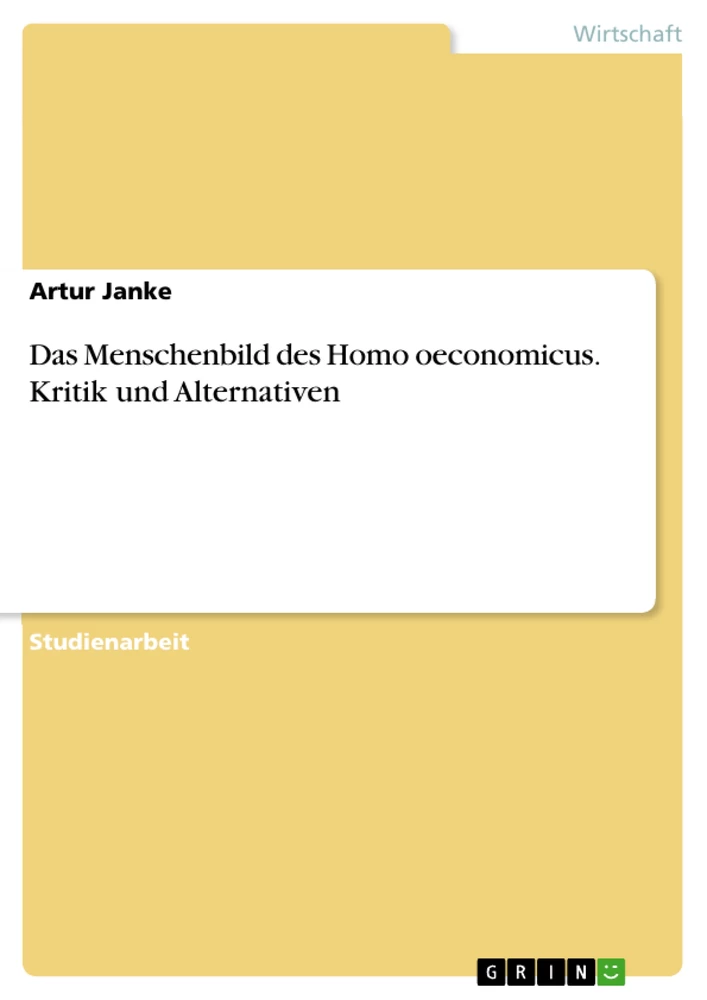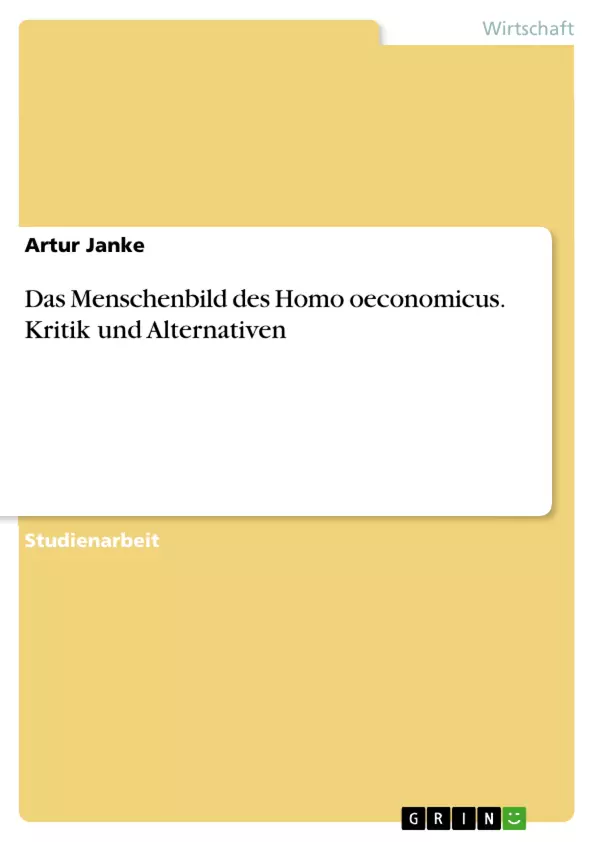Ziel dieser Arbeit ist es, das Modell des Homo oeconomicus zu erläutern und auf die Kritik dieses Modells einzugehen. Dabei wird zunächst das Modell des Homo oeconomicus erläutert und der Bezug zum Konzept der vollständigen Rationalität hergestellt. Im Anschluss wird das reale Verhalten von Menschen im Hinblick auf den Homo oeconomicus untersucht. Dazu werden Experimente herangezogen, um zu analysieren, ob sich die Menschen tatsächlich nach diesem Muster verhalten. Zum Schluss werden noch mögliche alternative Konzepte erläutert.
Um die komplexen Handlungsvorgänge des menschlichen Verhaltens in Bezug auf die marktwirtschaftlichen Tätigkeiten zu analysieren und zu verstehen, bedurfte es einer Modellierung der zentralen Verhaltensannahmen. Mit dem Modell des Homo oeconomicus, dem Nutzenmaximierer, der rational in Bezug auf seine eigne Zielfunktion handelt, entstand ein Instrument zum Betrachten und Analysieren des menschlichen Verhaltens. Damit kann sowohl das beobachtete Verhalten beschrieben werden als auch das Zu-künftige prognostiziert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Homo oeconomicus
- 2.1 Definition Homo oeconomicus
- 2.2 Das klassische Modell des Homo oeconomicus
- 2.3 Beziehung zum Konzept der vollständigen Rationalität
- 2.4 Kritik am Homo oeconomicus
- 3. Homo oeconomicus in der realen Welt
- 3.1 Ultimatumspiel
- 3.2 Zeitinkonsistenz
- 3.3 Vorgabewert (default effect)
- 4. Alternativen zum Homo oeconomicus
- 4.1 REMM
- 4.2 RREEMM
- 4.3 Eingeschränkte Rationalität
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Modell des Homo oeconomicus, einem zentralen Konzept in der Wirtschaftswissenschaft. Das Ziel ist es, das Modell zu erläutern, seine Kritikpunkte zu beleuchten und alternative Konzepte vorzustellen. Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit und Grenzen des Modells in der realen Welt.
- Das Modell des Homo oeconomicus und seine Definitionen
- Kritikpunkte am Modell des Homo oeconomicus und dessen Realitätsnähe
- Das Verhalten von Menschen im Kontext des Homo oeconomicus-Modells
- Alternative Modelle zum Homo oeconomicus
- Die Anwendung des Homo oeconomicus-Modells in verschiedenen Disziplinen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Entstehung des Homo oeconomicus-Modells im Kontext der modernen Industriegesellschaft und der damit verbundenen Veränderung der menschlichen Mentalität hin zu Eigennutzen und Eigeninteresse. Sie hebt die Notwendigkeit einer Modellierung des menschlichen Verhaltens im wirtschaftlichen Kontext hervor und benennt gleichzeitig die bestehende Kritik an der Realitätsnähe und der Anwendbarkeit des Modells, insbesondere im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Die Einleitung legt die Zielsetzung der Arbeit fest: Erläuterung des Modells, Auseinandersetzung mit der Kritik und Vorstellung von Alternativen.
2. Homo oeconomicus: Dieses Kapitel definiert den Homo oeconomicus aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven (Wissenschaftstheorie, Entscheidungstheorie, Wirtschaftstheorie). Es wird herausgestellt, dass der Homo oeconomicus ein wirtschaftender Mensch ist, dessen Handlungen auf Nutzenmaximierung und Rationalitätsprinzipien ausgerichtet sind. Der Bezug zum Konzept der vollständigen Rationalität wird hergestellt, was die Grundlage für die nachfolgende Kritik bildet.
3. Homo oeconomicus in der realen Welt: Dieses Kapitel untersucht, inwieweit sich reales menschliches Verhalten mit dem Homo oeconomicus-Modell deckt. Anhand von Beispielen wie dem Ultimatumspiel, der Zeitinkonsistenz und dem Vorgabewert-Effekt wird gezeigt, dass Menschen nicht immer rational im Sinne des Modells handeln und dass Abweichungen von der vollständigen Rationalität existieren. Diese Beispiele verdeutlichen die Grenzen des Modells und die Notwendigkeit alternativer Ansätze.
4. Alternativen zum Homo oeconomicus: Das Kapitel präsentiert alternative Konzepte zum Homo oeconomicus-Modell, wie REMM (Resourceful, Evaluative, Maximizing Man) und RREEMM (Resourceful, Restricted, Expecting, Evaluating, Maximizing Man), sowie das Konzept der eingeschränkten Rationalität. Diese Alternativen berücksichtigen die Komplexität des menschlichen Verhaltens und die Grenzen der vollständigen Rationalität besser als das klassische Homo oeconomicus-Modell.
Schlüsselwörter
Homo oeconomicus, Nutzenmaximierung, Rationalität, Kritik am Homo oeconomicus, vollständige Rationalität, eingeschränkte Rationalität, REMM, RREEMM, empirische Wissenschaft, Nachhaltigkeit, ökonomisches Verhalten, Entscheidungsfindung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Homo oeconomicus"
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument analysiert das Modell des Homo oeconomicus, ein zentrales Konzept in der Wirtschaftswissenschaft. Es erläutert das Modell, beleuchtet seine Kritikpunkte und präsentiert alternative Konzepte. Der Fokus liegt auf der Anwendbarkeit und den Grenzen des Modells in der realen Welt.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen umfassen die Definition und das klassische Modell des Homo oeconomicus, die Kritik an diesem Modell (inkl. Bezug zur vollständigen Rationalität), die Untersuchung des realen menschlichen Verhaltens im Vergleich zum Modell (z.B. Ultimatumspiel, Zeitinkonsistenz, Default-Effekt), und die Vorstellung alternativer Modelle wie REMM und RREEMM sowie des Konzepts der eingeschränkten Rationalität.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung (Problemstellung und Zielsetzung), Homo oeconomicus (Definition und Kritik), Homo oeconomicus in der realen Welt (mit empirischen Beispielen), Alternativen zum Homo oeconomicus (REM, RREEMM, eingeschränkte Rationalität), und Zusammenfassung. Es enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Darstellung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Was ist der Homo oeconomicus?
Der Homo oeconomicus ist ein Modell des wirtschaftenden Menschen, dessen Handlungen auf Nutzenmaximierung und Rationalitätsprinzipien ausgerichtet sind. Das Dokument beleuchtet verschiedene wissenschaftliche Perspektiven auf diese Definition und den Bezug zur vollständigen Rationalität.
Welche Kritikpunkte werden am Homo oeconomicus-Modell geäußert?
Das Dokument kritisiert die Realitätsnähe des Homo oeconomicus-Modells. Es argumentiert, dass Menschen nicht immer rational im Sinne des Modells handeln und dass Abweichungen von der vollständigen Rationalität existieren. Empirische Beispiele wie das Ultimatumspiel, Zeitinkonsistenz und der Vorgabewert-Effekt untermauern diese Kritik.
Welche Alternativen zum Homo oeconomicus werden vorgestellt?
Als Alternativen werden REMM (Resourceful, Evaluative, Maximizing Man) und RREEMM (Resourceful, Restricted, Expecting, Evaluating, Maximizing Man) sowie das Konzept der eingeschränkten Rationalität vorgestellt. Diese Modelle berücksichtigen die Komplexität des menschlichen Verhaltens und die Grenzen der vollständigen Rationalität besser.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Homo oeconomicus, Nutzenmaximierung, Rationalität, Kritik am Homo oeconomicus, vollständige Rationalität, eingeschränkte Rationalität, REMM, RREEMM, empirische Wissenschaft, Nachhaltigkeit, ökonomisches Verhalten, Entscheidungsfindung.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende und Wissenschaftler im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere für diejenigen, die sich mit Entscheidungstheorie, Verhaltensökonomik und der Kritik am neoklassischen Modell auseinandersetzen. Es kann auch für Personen interessant sein, die sich für die Modellierung menschlichen Verhaltens interessieren.
- Quote paper
- M.Sc. Artur Janke (Author), 2016, Das Menschenbild des Homo oeconomicus. Kritik und Alternativen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1014588