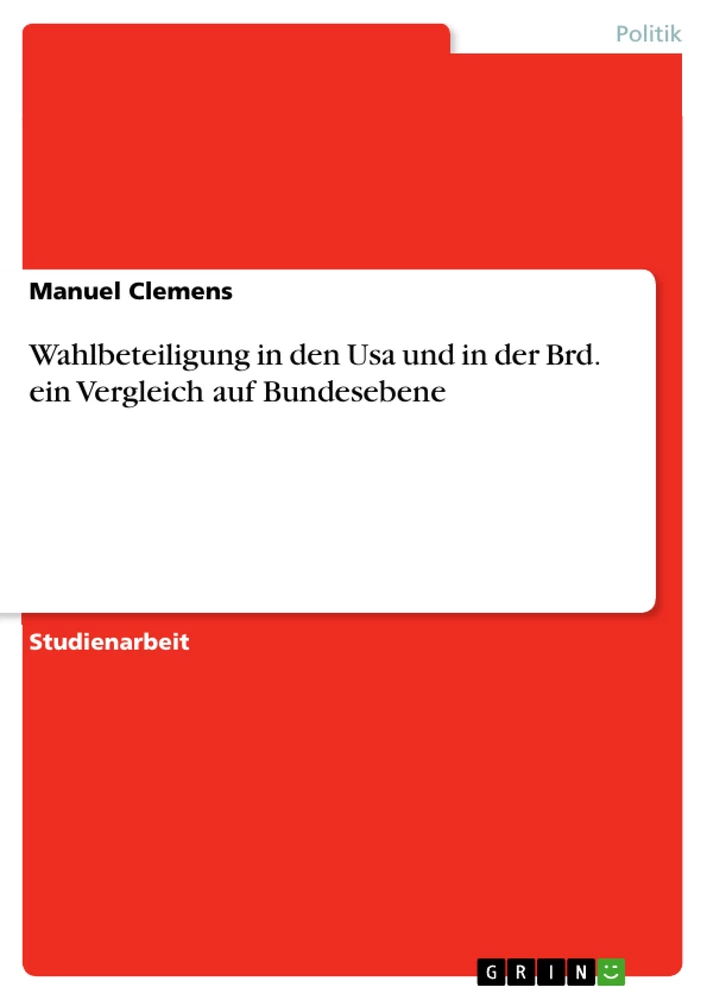Dieser Essay beschäftigt sich mit zwei Hauptfragen: Es wird einerseits untersucht, weshalb die Wahlbeteiligung in Deutschland traditionell hoch und in den USA traditionell niedrig ist. Andererseits, weshalb sie in beiden Ländern zurückgeht.
Außerdem soll noch kurz auf die Frage eingegangen werden, welche Aussage die unterschiedlich hohe Wahlbeteiligung über das politische Engagement in beiden Ländern insgesamt macht. Gerade bei diesem Punkt sollte man keine voreiligen Schlüsse ziehen. Denn der Vergleich Deutschlands mit den USA ist meist so unterschiedlich wie sich eine Präsidiumssitzung einer deutschen Partei zur Bestimmung ihres Kanzlerkandidaten von den Vorwahlen zur Nominierung des Präsidentschaftskandidaten in den USA unterscheidet.
1. Die hohe Wahlbeteiligung in Deutschland
Die Wahlbeteiligung in Deutschland liegt stets -ganz grob- bei 80 Prozent1. Der Hauptgrund für die hohe Teilnahme liegt wohl an einem „konventionellem Pflichtgefühl“2 der Deutschen. Diese Mentalität ist eine Spätfolge der preußischen Pflichtethik, die Gehorsam, Disziplin und Ordnung von der Bevölkerung verlangte. Diese Eigenschaften waren weit vor einem persönlichen Freiheitsgefühl und einem kritischen Verhältnis zum Staat von der Bevölkerung verinnerlicht worden. Dementsprechend wurden Wahlen als „Vaterlandspflicht“ oder als „Pflicht gegenüber der Bundesregierung“3 betrachtet. Dies wirkt sich auch noch heute auf die Wahlbeteiligung aus.
Ein weiterer Grund liegt im hohen Organisationsgrad der deutschen Parteien und ihrer starken Stellung in der Gesellschaft. Sie sind permanente Zusammenschlüsse, ihre Mitglieder sind auch während den Legislaturperioden aktiv und können nicht nur im Wahlkampf Wähler mobilisieren, sondern ständig auf ihre Zielsetzung aufmerksam machen. Durch ihre Macht und ihren Einfluß in allen Bereichen des öffentlichen Lebens erhalten sie eine zusätzliche Autorität und werden oft als halbstaatliche Organisationen betrachtet.
Dies führte zu einer hohen -allerdings sich im Rückgang befindenden- Parteibindung: Die Mehrheit der Wähler hat ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Partei bzw. zu deren Umfeld und wählt sie über einen langen Zeitraum hinweg.
Außerdem sollte die fehlende demokratische Tradition und die Zeit des Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit mit dem Willen zu einer Musterdemokratie kompensiert werden. Dieser Prozeß wurde durch die „Umerziehung“ (Reeducation) der Alliierten hervorgerufen. Sie versuchten nach dem Ende der NS-Herrschaft das politische Leben auf eine demokratische Grundlage zu stellen und von nationalsozialistischen Vorstellungen zu säubern. Dazu gehörte auch -über Medien, Schulen, Universitäten und Erwachsenenbildungdie Deutschen zum Wahlgang zu bewegen. Später wurde das Wählen selbstverständlich und die Demokratie durch das Wirtschaftswunder getragen.
Hinzu kommt, daß die Wahl findet immer an einem Sonntag stattfindet.
2. Die niedrige Wahlbeteiligung in den USA
Im 19. Jahrhundert war die Wahlbeteiligung in den USA hoch (über 70 Prozent)1. Dies änderte sich mit der Einführung der Registrierungspflicht 1890: Um an einer Wahl teilnehmen zu dürfen, mußte man sich vorher registrieren lassen.
Sie wurde eingeführt, weil es in den USA keine Melderegister und Einwohnermeldeämter gibt, von denen in Deutschland automatisch die Wahlbenachrichtigung versendet wird. Außerdem diente sie -offiziell- zur Eindämmung von Korruption und Betrug und - inoffiziell- zur Schwächung der Stadtbevölkerung, die über höhere Anteile von Immigranten verfügten als die ländlichen Gebiete. Denn mit der Registrierung waren folgende Auflagen verbunden: Identitätsnachweis, Wohnsitz und der Besitz der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Manche Registrationsbüros hatten nur wochentags, während den Arbeitszeiten geöffnet. In manchen Staaten mußte man sich bis zu sieben Monate vor der Wahl registrieren lassen. Auch mußte die Registrierung ständig wiederholt werden, da die Behörden die Wählerkarteien so aktuell wie möglich halten wollten.
Diese Auflagen erschwerten die Beteiligung von Immigranten, Obdachlosen, Personen mit niedrigem Einkommen, geringer Bildung und wenig Interesse an Politik.
Die Registrierung besteht noch heute und ist der Hauptgrund für die niedrige Wahlbeteiligung. Allerdings wurde das Verfahren erleichtert: Es wurden Lese- und Schreibtests abgeschafft, ebenso die Wahlsteuer. Zweisprachige Wahlzettel wurden eingeführt, man kann sich nun per Post registrieren lassen oder wenn man sein Auto an- bzw. ummeldet. Auch kann man sich heute noch am Wahltag registrieren lassen.
Trotzdem sind immer noch die gleichen Gruppen benachteiligt und die Wahlbeteiligung stieg auch nicht an - im Gegenteil, lag sie in den sechziger Jahren noch bei etwa 65 Prozent, so sank sie kontinuierlich, bis sie seit den siebziger Jahren auf den heutigen Durchschnittswert sank: 50 Prozent.
Der zweite Grund für die niedrige Wahlbeteiligung liegt an der segmentierten, eher lokal orientierten amerikanischen Bevölkerung. Man lebt größtenteils unter gleichen, in Nachbarschaftsinseln, getrennt nach sozialen, kulturellen, religiösen und politischen Merkmalen.
Dies führt zur Herausbildung einer „Community“, deren Mitglieder basisdemokratisch organisiert sind. Der Sheriff, Richter, Staatsanwalt und die Mitglieder der Schulbehörde werden von der Bevölkerung gewählt. Beispielsweise über die Aufnahme von Krediten, größeren Bauvorhaben und über einzelne Punkte im Curriculum (z.B. in der Frage, ob die darwinistische Evolutionstheorie durch die biblische Schöpfungsgeschichte im Biologieunterricht ersetzt werden soll) gibt es eine Volksabstimmung. Der Abgeordnete fühlt sich in ersten Linie seinem Wahlkreis verpflichtet und nicht seiner Partei oder bundespolitischen Interessen.
Gestärkt wird die „Community“ durch das Prinzip der Selbsthilfe. Freiwillige, selbstorganisierte Gruppen, Vereine, Nachbarschaftsorganisationen und Stiftungen sorgen für die Organisation gesellschaftlicher Aktivitäten und für soziale Unterstützung. Die Kirchengemeinde übernimmt hier die größte Rolle, der Staat oder eine übergeordnete Großorganisation (z.B. Parteien) treten hier nicht in Erscheinung.
Bei diesem ausgeprägtem Lokalismus spielen Wahlen auf Bundesebene eine geringere Rolle. Es herrscht drittens, eine weitverbreitete Ablehnung der Machtanhäufung in Washington bzw. ein starkes Mißtrauen gegenüber Institutionen. Die Zentralbürokratie gilt als ineffizient und als Verschwender von Steuergeldern. Politiker dort als korrupt, machtbesessen und zu interventionistisch orientiert (vor allem in Steuer- und Sozialpolitischen Fragen). Wahlkämpfe werden immer auch gegen das „Big Government“1 und für Privatisierungen und der Stärkung von Einzelstaaten geführt.
Dies ist vor allem auf einen der Grundmythen der amerikanischen Gesellschaft zurückzuführen, die Freiheit. Diese individualistische, staatsferne und staatskritische Tradition entstand im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit von Großbritannien. Dies war die Befreiung vom europäischen Feudalismus und Absolutismus und schuf -damals revolutionär-Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit. Allerdings glaubte man, nur ein schwacher Staat könne diese Errungenschaften erhalten und garantieren, da er so einer mächtigen Öffentlichkeit gegenüberstehe.
Auf individueller Ebene schuf der Freiheitsmythos die Vorstellung, das alles möglich sei („Vom Tellerwäscher zum Millionär“), wenn man nur hart genug arbeite und der Staat einen nicht behindere.
Viertens, die niedrige Parteibindung. Die amerikanischen Parteien sind genauso segmentiert und agieren genauso dezentralisiert wie die amerikanische Gesellschaft. Zwar vertreten die „Republikaner“ eher rechte und die „Demokraten“ eher linke Themen, jedoch sind beide Parteien in zahllose Flügel und Gruppen aufgespaltet. Es gibt keine Fraktionsdisziplin und wenig programmatische Verbindlichkeiten.
Parteien sind in erster Linie dazu da, daß Kandidaten für öffentliche Ämter nominiert und gewählt werden (klassische Definition: „A party is to elect“). Sie sind also nur Wahlplattformen, die in der Öffentlichkeit eine geringe Rolle spielen. Infolgedessen identifiziert sich ein großer Teil der Wähler mit keiner der großen Parteien, sondern begreift sich als unabhängig. Bei diesem niedrigem Zugehörigkeitsgefühl läßt sich der Wähler schwerer zum Wahlgang motivieren.
Fünftens, das Zweiparteiensystem bietet vielen Wählern keine Alternative, wenn sie nicht eine der beiden großen Parteien wählen möchten. Kleinere Parteien haben auf Grund des Mehrheitswahlrechtes fast keine Chance ins Parlament zu kommen. Diese Wähler bleiben dann oft der Wahl fern.
Sechstens, auf Grund der Zeitverschiebung (drei Stunden) haben die Wahllokale im Osten schon geschlossen und deren Hochrechnungen sind schon bekannt, während man im Westen noch wählen gehen kann. Dies hält im Westen viele ab noch zur Wahl zu gehen, wenn ihr Kandidat entweder eh schon vorne liegt oder sich aussichtslos weit hinten befindet.
Siebtens, die Wahl findet an einem Werktag statt. Am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November.
3. Der Rückgang der Wahlbeteiligung in Deutschland
Die Wahlbeteiligung in Deutschland sank -wieder ganz grob- seit 1990 auf plus/minus 80 Prozent. Sonst lag sie immer zwischen 85 und 90 Prozent. In den siebziger Jahren war sie mit über 90 Prozent am höchsten. Was sind die Gründe für den Rückgang?
Erstens, der Wertewandel. Mit zunehmendem Wohlstand und sozialer Sicherheit traten postmaterialistische Werte (z.B. Selbstverwirklichung, Engagement, Emanzipation und Umweltschutz beispielsweise) bei jüngeren Bevölkerungsgruppen an die Stelle der alten, materialistischen Werte (z.B. Sicherheit, Gehorsam, Pflichterfüllung).
Dies wirkte sich zweifach auf das Wahlverhalten aus: Zum einem wurden Wahlen als unzulängliches Instrument zur politischen Partizipation angesehen („Wenn Wahlen etwas verändern könnten, würde man sie verbieten“). Mit Demonstrationen, Unterschriftensammlungen und Bürgerinitiativen glaubte man mehr erreichen zu können. Man engagierte sich also anderswo, anstatt zu wählen.
Zum anderen hat die Entstehung dieser Freiheit zu einem Normalisierungsprozeß im Wahlverhalten geführt. Da die gesellschaftliche Pflichterfüllung nicht mehr im Vordergrund stand, gab es für viele politisch nicht Interessierte oder Enttäuschte kaum noch einen Grund, zur Wahl zu gehen. Oder schärfer ausgedrückt: Die deutsche Untertanenmentalität (siehe oben) war im Laufe der Jahre schwächer geworden und somit auch der gesellschaftliche Druck zur Wahlpflicht.
Zweitens, das Aufweichen der Partei-Wähler-Bindungen: Die Stammwähler jeder Partei gingen zurück und die Wahlentscheidungen wurden somit flexibler. Wer 1990 noch CDU wählte, wählte 1994 vielleicht SPD und 1998 wieder eine andere Partei. Auch sind mehr
Wähler als früher unentschlossen. Viele Wähler wissen manchmal bis kurz vor der Wahl nicht, welche Partei sie wählen sollen.
Nun kann das Aufweichen der Parteibindungen auch dazu führen, daß man der Wahl einfach fernbleibt: hohe Parteibindungen (also auch Entschlossenheit) lassen den Wähler leichter aktiv werden als niedrige Parteibindung und Unentschlossenheit.
Die Ursachen des instabilen Wählerverhaltens liegen im sozio-ökonomischem Wandel: Der wachsende Wohlstand der Arbeiterklasse hat das Wohlstandsgefälle zwischen Arbeiterschicht und Mittelschicht verringert. Die Bindung der Arbeiterschicht an Arbeiterparteien und Gewerkschaften ging zurück, da dieses Problem entschärft worden war.
Das Aufkommen der postmaterialistischen Werte (siehe oben) beschleunigte diesen Prozeß: Individualismus, neue Lebensentwürfe, Befreiung von Tabus wie Sex und Homosexualität, unkonventionelle Protest- und Partizipationsformen und Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem ließe die Bindung an Kirchen, Parteien und anderen gesellschaftlichen Gruppen zurückgehen. Gleichzeitig ließen sie auch neue Parteien, Gruppen und Ideologien entstehen. Die Gesellschaft war vielfältiger geworden.
Durch die Erweiterung von Bildungschancen, Zunahme der Freizeit, Erhöhung der Mobilität und Kommunikation, Informationsflut der Massenmedien und der ständigen Bedürfnisweckung der Werbung wurde aus dieser vielfältigen Gesellschaft eine „Multioptionsgesellschaft“1: Die Politik und die klassischen sozialen Milieus wirkten immer weniger integrierend, da das Angebot größer geworden war. Man war nun gezwungen - zwischen unzähligen Angeboten auswählend und experimentierend- seien eigenen Lebensstil und sein eigenes Weltbild zu finden. Parteien und Wahlen rückten dabei in den Hintergrund.
Drittens, Politikverdrossenheit. Es bleiben nicht nur mehr politisch Desinteressierte den Wahlen fern, sondern auch mehr politisch interessierte Bürger, die gut informiert sind. Dies ist zurückzuführen auf Zufriedenheit, Unzufriedenheit und auf die politischen Veränderungen seit 1989.
Der zufriedene Bürger leistet sich das Wohlstandssyndrom: Um so mehr er mit den politischen Entscheidungen zufrieden ist desto mehr fällt er in politische Aphatie. Der unzufriedene Bürger bleibt der Wahl fern, da er mit den Entscheidungen eben nicht zufrieden ist, ihn Skandale oder unerfüllte Versprechen desillusioniert haben oder er seine Vorstellungen nicht oder nur schlecht erfüllt sieht.
Nach 1989 hat das Konfliktpotential in der Politik abgenommen. Der Ost-West Gegensatz bzw. der Streit zwischen einem kapitalistischen und einem kommunistischen Wirtschaftssystem ist größtenteils beendet worden. Des weiteren waren (und werden in Zukunft auch noch sein) die westlichen Länder auf Grund des geringeren Wirtschaftswachstums zum Sparen gezwungen. Dies führte zu einer Annäherung in der Wirtschaftspolitik und zur Entspannung der politischen Debatte. Alte Feindbilder konnten keine Wähler mehr mobilisieren und teilweise künstliche geschaffene Konflikte auch nicht.
Auch die Übernahme eher konservativer Themen nicht nur in der Wirtschaftspolitik, sondern auch auf dem Gebiet der Innenpolitik von sozialdemokratischen Parteien überzeugten manchen Wähler nicht. Infolge dieser Konfliktarmut haben sich die großen Parteien derart angeglichen, daß sich beim Bürger das Gefühl einstellt, ihm werden keine Alternativen präsentiert, was den Ausgang einer Wahl bedeutungslos machen würde. Alle Politiker seien austauschbar, der Wähler habe nicht mehr die Alternative zwischen Regierung und einer kritischen Opposition, sondern nur noch zwischen Allerweltsparteien.
Hinzu kommen die neuen Probleme der Globalisierung, auf die die Politik erst noch nach Antworten sucht und manchmal auch hilflos gegenüber steht. Am Beispiel der Fusion von der Dresdner Bank mit der Deutschen Bank, bei der 16 000 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen, schreibt die Süddeutsche Zeitung: „Wenn die, die man wählt, eh nicht mehr das sagen haben - warum soll man sie dann überhaupt noch wählen? Die Politik muß also ihren Platz wieder besetzen; es muß den von ihr gesetzten Regeln wieder gelingen, die Menschen im Alltag wirksam zu begleiten“1. So kann es sein, daß sich der Eindruck von Politik einstellt, den Ulrich Beck folgendermaßen beklagt:
An die Stelle des Wettkampfes der Ideen ist in der deutschen Politik ein Wettkampf der Versager getreten. Wer als zweiter Versager durch das Ziel geht, gewinnt. Nicht der regiert, der, wie es im Bilderbuch der Demokratie beschrieben steht, die besten Lösungen vorschlägt, sondern derjenige, der angesichts der noch gr öß eren, noch spektakuläreren Versäumnisse und Verfehlungen der Gegenpartei etwas weniger versagt ... Es entsteht die Politikfigur des glücklichen Versagers 1 .
Viertens, die wirtschaftliche Rezession, die Politikverdrossenheit beschleunigt. Die Demokratiezufriedenheit wird in erster Linie anhand der wirtschaftlichen Situation beurteilt. Geringverdienende und Arbeitslose neigen bei Unzufriedenheit schnell zur Wahlenthaltung.
4. Der Rückgang der Wahlbeteiligung in den USA
Die Ursachen für Deutschland (Wertewandel, Auflösung der Partei-Wählerbindung und Politikverdrossenheit) gelten auch für die USA. Daneben gibt es weitere Gründe:
Erstens, die sozialen Gegensätze sind in den USA größer als in Deutschland und haben sich dort seit den 70er Jahren verschärft. Das Absinken des Bildungsniveaus, der Anstieg der Armut und die Bedrohung des sozialen Abstieges lassen immer mehr Betroffene nicht mehr an den Wahlen teilnehmen.
Gerade die großen Parteien können sie mit ihrer Politik (weniger Staat, weniger Sozialleistungen, mehr Steuersenkungen), die Armut oft diffamiert, nicht mehr ansprechen.
Zweitens, geht das politische Engagement in den USA über die Wahlen hinaus. Seit 1970 haben sich die Gerichtsverfahren gegenüber Politiker mehr als verzehnfacht. Prozesse in Bürgerrechts-, Abtreibungs- und wirtschaftspolitischen Fragen haben sich mehr als verdoppelt2.
5. Die politische Partizipation in Deutschland und in den USA
Die hohe Wahlbeteiligung in Deutschland und die niedrige in den USA lassen bei grober Betrachtung schnell den falschen Schluß zu, das Deutschland das Land mit dem höheren politischem Engagement sei und die USA eine Demokratie, die sich im Niedergang befinde.
Jedoch ist die Demokratie in den USA nach wie vor lebendig. Sie ist nur eine andere als jene, die in Europa heranwuchs. Die amerikanische Demokratie ist basisdemokratisch, der Bürger engagiert sich vor allem und zuerst für Angelegenheiten, die vor seiner Haustüre passieren.
Wie in Abschnitt 2 beschrieben, beteiligt sich der Bürger in seiner „Community“ und das ist unterm Strich mehr bürgerliches Engagement als in jeder anderen Demokratie.
Man sollte zum besserem Verständnis diesen schiefen Vergleich, diese ausgesprochen feuilletonistische Frage wagen: Wie würde das politische Engagement in den Vereinigten Staaten von Europa aussehen? Erweitert auf 27 oder noch mehr Mitglieder und einer Zentralregierung? Mit dem Versuch einer Verschmelzung der unterschiedlichen historischen Prägungen, der verschiedenen Kulturen und sozialer Unterschiede zu einem Staat? Mit -aus deutscher Sicht- einem spanischen Staatsoberhaupt und einem polnischen Außenminister?
Wahrscheinlich wäre die Wahlbeteiligung dann immer noch höher als in den USA und basisdemokratischeres Engagement würde auch nicht über Nacht heranwachsen. Aber dieses Gedankenspiel läßt die Entstehung der kleinen, selbstständigen, abgeschotteteten Teilbereiche verstehen, die die amerikanische Demokratie prägen.