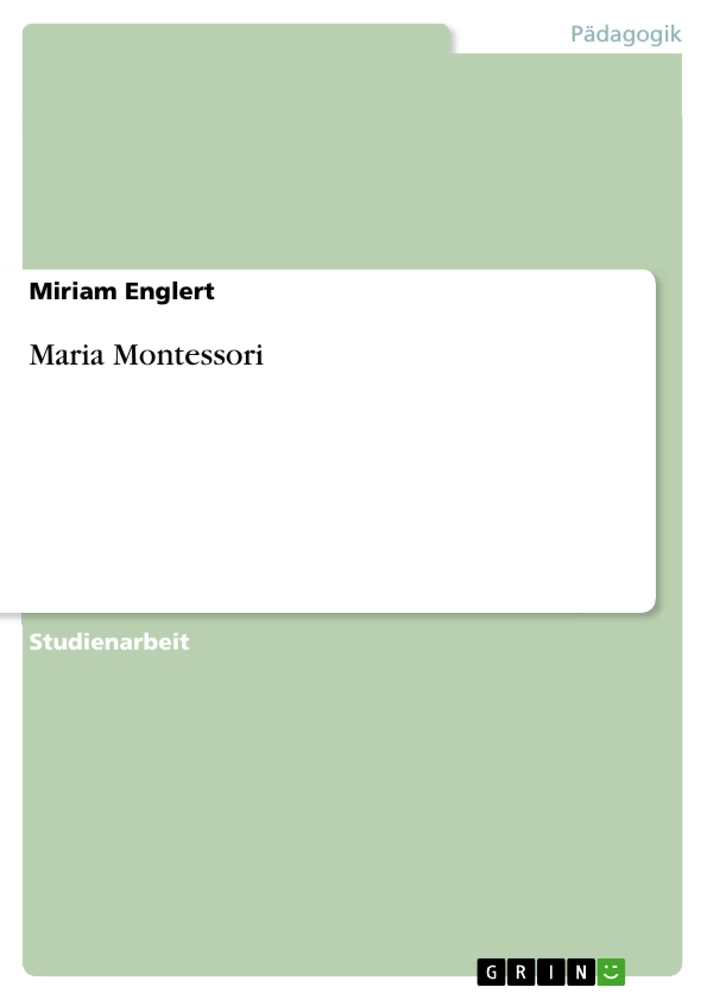Freiarbeit nach Maria Montessori:
Die Montessori Pädagogik ist ein reformpädagogisches Bildungsangebot, das sich pädagogisch und didaktisch am Kind orientiert und somit auch die Grundbedürfnisse des Kindes berücksichtigt. Die Montessori Pädagogik wird heute weltweit praktiziert, vor allem an Schulen und auch in Kinderhäusern.1 Der Begriff der Freiarbeit stammt jedoch nicht von Montessori selbst.2 Im Mittelpunkt der Montessori Pädagogik steht die individuelle und freie Entwicklung der Kinder. Das Kind soll nach Montessori als vollwertiger Mensch angesehen werden. Den Fähigkeiten und Lernbedürfnisse der Kinder soll entgegengekommen werden. Sie sollen in ihren Entscheidungen gefördert und zum selbstständigen Denken angeregt werden.. Montessoris Leitsatz der Kinder sollte heißen: Hilf mir es selbst zu tun
.1 Der Begriff der Freiarbeit wurde in der Zeit der Reformpädagogik geprägt.3 Hier prägen vor allem die Grundgedanken Montessoris die heute praktizierte Unterrichtsform der Freiarbeit. Die Freiarbeit soll sich am Kinde und dessen Entwicklungsphasen orientieren, und auch dementsprechend sollte die Unterrichtsphäre
und die Lernwelt
gestaltet werden.3 Freiarbeit wird oft auch als freie Arbeit bezeichnet, sie ist vor allem in den Grundschulen zu einem wichtigen Bestandteil des Unterrichts geworden.1 Ebenfalls ist sie das Kernstück der reformpädagogischen Bildung Montessoris. Maria Montessori beschreibt damit die freien Tätigkeiten der Kinder. Den Kindern wird bei dieser Form der Arbeitsmethodik ermöglicht, nach freier Entscheidung zu wählen, mit was sie sich beschäftigen wollen. Montessori nennt dies die Freie Wahl der Arbeit, Freie Wahl des Gegenstandes und des Interesses
.3 Die Freiarbeit ist also eine Unterrichtsform, die wesentlich durch die Prinzipien der Montessori Pädagogik geprägt ist. Die Schüler bestimmen auch ihren Arbeitsrythmus und die Beschäftigungsdauer weitgehend selbst. Auch die Partner-, Gruppen-, oder Einzelarbeit wird den Schüler freigestellt. Die Kinder werden somit zur Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit erzogen. Doch vor allem die Freude am Lernen soll natürlich in den Vordergrund rücken. Es wird von den Montessori- Pädagogen versucht, sich so stark wie möglich am Kinde zu und an dessen Fähigkeiten und Bedürfnissen zu orientieren.
Die Schüler haben in der Freiarbeit wirklich die Möglichkeit frei und selbstständig arbeiten zu können, ohne dass sie von Lehren oder Erziehern überwacht werden. Die Montessori - Pädagogen sollen sich als Helfer zur Entwicklung der selbstständigen kleinen Persönlichkeiten verstehen. Sie sollen nur eine Art Begleiter darstellen. Sie sollen die Kinder mit Geduld an die Montessori - Materialien heranführen und diese vor allem in ihren Schwächen zu unterstützen und beratend zur Seite zu stehen. Den Kindern fällt es so auch leichter Eigenverantwortung zu übernehmen. Laut Montessori muß das Kind frei sein, denn nur dann sei es möglich, ihm Wissen anzueignen und seine Fähigkeiten optimal zur Entfaltung zu bringen. Deshalb sollen die Erzieher und die Pädagogen den kleinen Menschen auf ihrem Weg durchs Leben die Freiheiten lassen, um wichtige Erfahrungen selbst sammeln zu können. Die Pädagogen sollen daher versuchen, eine Brücke zwischen ihrer Welt und der des Kindes zu schlagen
.2 Für Montessori stehen drei Aspekte der Freiheit im Vordergrund, welche die Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Kinder darstellen:
Freiheit der spontanen Äußerung
Freiheit in der Wahl des Materials
Freiheit der Bewegung
2
Diese sollen die Pädagogen und die Montessori - Schulen gewährleisten und Miteinbeziehen in ihre pädagogische Arbeit. Diese Arbeit, die von den Kindern frei verrichtet wird, muß vor allem aber am Kinde orientiert, und kindgemäß gestaltet sein. Es soll die Gelegenheit geboten werden, den individuellen Lernbedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Hierbei darf es weder zu einer Überforderung als auch zu einer Unterforderung des Kindes kommen. Die Freiheit für das Kind ist dann gewährleistet, wenn es sich den Bedürfnissen seiner Entwicklung entsprechend entfalten kann
.2 Mit diesem Denkansatz nimmt Montessori auch die Grundgedanken Roussaus auf, nämlich dass das Kind frei in seiner Entwicklung sein soll, und sich dadurch schneller und besser entfalten kann. Das didaktische Material soll bei Montessori wie eine Leiter wirken
, an der das Kind durch eigenständige Schritte zur Selbstverwirklichung gelangt.4
Nach Maria Montessori, welche den Begriff der Freiarbeit nicht nur methodisch, sondern auch in Verbindung mit Lernen unter bestimmten Bedingungen
gesehen hat, gehören zur freien Arbeit drei relative
Freiheiten, die sich gegenseitig bedingen sollen:
Freiheit des Interesses
Freiheit der Kooperation
Freiheit der Zeit
2
Diese Auffassung Montessoris, sollte in der Schul - und Lernwelt der Kinder berücksichtigt werden. Bei der Freiheit des Interesses
, haben die Schüler die Möglichkeit, Aufgaben je nach individuellem Interesse selbst zu wählen. Die Schüler sollen ihre gelösten Aufgaben danach selbst kontrollieren können, wenn die Gelegenheit durch den Lehrer oder ausgelegten Lösungen gegeben ist. Bei der Freiheit der Kooperation
kann der Schüler selbst entscheiden, ob er die Aufgaben lieber alleine, oder in der Gruppe erarbeiten möchte. Durch die gemeinsame Gruppenarbeit wird zusätzlich die Gemeinschaft unter den Schülern gefördert. Die Schüler werden dazu aufgefordert, Rücksicht auf schwächere Mitschüler zu nehmen, und auf diese einzugehen und ihnen zu helfen. Die Schüler sprechen sich untereinander ab, sie beraten sich, tauschen ihre Meinungen und ihr Können aus. Sie arbeiten auch gemeinsam an bestimmten Projekten. So lernen die Schüler hierbei den verantwortungsbewußten Umgang miteinander, sie zeigen Bereitschaft zur Zusammenarbeit
. Und somit ist die Freiarbeit nicht nur eine Unterrichtsmethode
, sondern eine Schullebensform
.2 Bei der Freiheit der Zeit
, steht den Schülern genügend Zeit zur Bearbeitung der gestellten Aufgaben zur Verfügung. Je älter die Schüler werden, desto zeitaufwendiger sind die zu bearbeitenden Aufgaben gestaltet. Kinder wollen also nicht nur irgendetwas lernen, sondern zu einer bestimmten Zeit etwas ganz Bestimmtes. Laut Montessori besitzt jedes Kind einen sogenannten absorbierenden Geist
, welcher für die individuelle und natürliche geistige Auffassungskraft des Kindes steht. D. h., dass das Kind verschiedene Entwicklungsphasen durchläuft, und dass es in der Lage ist, durch eine der bestimmten Phase entsprechend gestalteten Umwelt eigene Kräfte entwickeln zu können, und dadurch mehr Selbstständigkeit und Eigeninitiative von den Kindern gefordert wird. In der Schule bedeute diese Montessori - Theorie, dass den Kindern ihrem Entwicklungsstand gemäßes Unterrichts - und Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt wird.3 Die Aufgaben die der Schüler verrichtet sollten in regelmäßigen Abschnitten vom Lehrer überprüft werden, um sich über dem Leistungsstand des Schülers zu informieren.
Die Freiarbeit ermöglicht dem Lehrer auch ganz gezielt auf schwächere Schüler einzugehen, diese über einen längeren Zeitraum zu beobachten und so mögliche Hilfen bei Problemen zu bieten. Dieser Vorteil der individuellen Betreuung jedes einzelnen Kindes zeigt sich auch in der Notengebung. Die Freiarbeit ist nicht an bestimmte Fächer gebunden. Sie ist bis heute eine oft praktizierte Unterrichtsform, die sich in vielerlei Hinsicht als effektiv, dennoch nach meiner Meinung nach nicht in allen Bereichen perfekt, erwiesen hat.