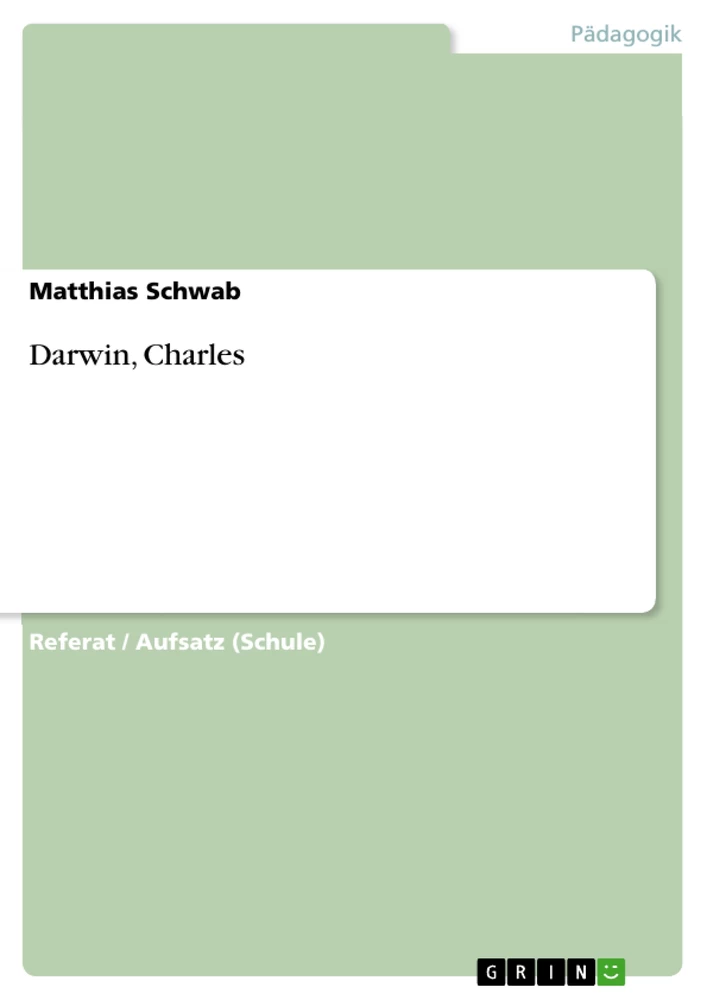Autor: Matthias Schwab
Charles Darwin
1) Leserbrief zur Kritik der Konferenz Evangelikaler Publizisten
Auf berechtigte Kritik der kep stieß das Plakat der AOK, mit dem die Krankenkasse für eine Kampagne gegen Rückenleiden wirbt. Das Plakat zeigt die Entwicklung des Menschen, wie sie nach Darwins Evolutionstheorie abgelaufen wäre. Die Bildüberschrift "Mit der AOK kann sich Ihr Rücken positiv entwickeln" vermittelt den Eindruck, als sei der Mensch noch nicht völlig vollendet, sondern bilde nur eine vorläufige Entwicklungsstufe im Prozess der Evolution. Dabei werden jene Menschen ignoriert, die nicht der Meinung Darwins sind und sich, wie es die kep formuliert, "als Geschöpf Gottes betrachten". Da zudem nicht erwiesen ist, ob sich die Entwicklung des Lebens auf der Erde tatsächlich nach der Hypothese des englischen Forschers vollzogen hat, kann dieses nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden, wie dies auf provokative Weise auf dem Plakat geschieht. Einen weiteren Anlass zur Kritik bildet die Formulierung "Tips und Übungen für den aufrechten Gang", die dem Menschen einen affenähnlichen Charakter was seine Fortbewegung anbetrifft unterstellt. Die AOK sollte als Organisation, die Menschen aller Bevölkerungsgruppen vertritt, von derart einseitigen Kampagnen absehen und sich darüber hinaus nicht wissenschaftliche Theorie zu eigen machen, die in keiner Weise erwiesen sind.
2) Biographie von Charles Darwin und seine Grundthesen
Charles Darwin wird am 12. Februar 1809 in Shrewsbury/Shropshire in England geboren.
Sein Großvater war ein bekannter Dichter und genau wie dieser sollte Charles Darwin später Berühmtheit erlangen. In seiner Kindheit ist er mit dem frühen Tod seiner Mutter konfrontiert, welche stirbt als er acht Jahre alt ist. 1825 beginnt er sein Medizinstudium in Edinburgh, was er aber schon zwei Jahre später abbricht und sich entscheidet Priester der anglikanischen Kirche zu werden. Doch anstelle eine Stelle als Pfarrer zu übernehmen erhält er 1831 das Angebot an Bord des englischen Schiffes HMS Beagle als Biologe an einer Reise in den Südpazifik teilzunehmen und er akzeptiert diese Offerte. Besonderen Eindruck macht der Aufenthalt auf den Galapagosinseln auf Charles Darwin, wo er die besondere Flora und Fauna der Insel erforscht. Nach vier Jahren kehrt er zurück nach England und die Erfahrungen der Reise sollen als Grundlage seines Werkes "On the Origin of Species by Means of Natural Selection" (1859) werden. Nach der Heirat mit seiner Nichte Emma Wedgwood zieht Darwin mit seiner Familie im Jahr 1842 nach Downe/Kent, wo er seine Studien über die Evolution fortsetzt und zunehmend an Bedeutung als Forscher gewinnt. Seine wohl bekannteste These, dass der Mensch von der anthropoiden Gruppe abstammt, begründet er in seiner Schrift "The Descent of Man", die im Jahr 1871 erscheint. Nach seinem Tod 1882 wird er in der Westminster Abbey in London beigesetzt, was zugleich die einzige öffentliche Ehrung seiner Leistungen bedeutet. Charles Darwin wurde in seinen Ansichten stark durch das Werk "Principles of Geology" welches von Charles Lyell (1797-1875) veröffentlicht worden war, sowie durch "Essay on the Principle of Population", einer Abhandlung verfasst von dem britischen Sozialphilospohen Thomas Malthus (1766-1834), beeinflusst und entwickelte aus diesen Voraussetzungen seine eigene Idee.
Die These Darwins, wonach die Natur ein Resultat ständiger Entwicklung ist, sowie die Aussage, dass das Überleben der Arten durch das Prinzip der natürlichen Auslese (Selektion) oder durch den Zufall gesichert wird, ließen ihn auf den Widerstand der Kirchen stoßen, die in der Theorie von Darwin einen Widerspruch zur Bibel und zu den Grundwerten des Christentums sah. Die christliche Theologie sah in der gesamten Welt eine Schöpfung Gottes und empfand demnach die Theorie Darwins als einen Gegenbeweis. Die Tatsache einer allmählichen Entwicklung ohne jegliche Fremdeinwirkung stand aus damaliger Sicht im Kontrast zu den Schöpfungsmythen der Bibel und zu der Vorstellung des christlichen Glaubens. Aus christlicher Sicht bestehen der Sinn und die Bestimmung des Lebens nicht in einer kontinuierlichen Entwicklung sondern in Gott selbst.
Zudem barg Darwins Theorie das Risiko einer Übertragung auf menschliche Verhältnisse in sich, was auch geschah, indem die Evolutionstheorie als Rechtfertigung beispielsweise des englischen Imperialismus zur Zeit Königin Viktorias missbraucht wurde. Die Vorstellung, dass es höhere und weniger entwickelte Rassen gäbe, bewirkte das Entstehen des Sozialdarwinismus, welcher später im Nationalsozialismus öffentlich vertreten wurde. Auch in dieser Hinsicht ist eine Unvereinbarkeit mit dem christlichen Ideal der Nächstenliebe erkennbar, sodass der Darwinismus auch heute noch auf Kritik der Kirche stößt.
3) Argumente Otto Zöcklers
Zöckler sieht in der darwinistischen Evolutionstheorie einen Widerspruch zum christlichen Schöpfungsbericht und ist deshalb der Auffassung, dass diese beiden Standpunkte unvereinbar sind. Für ihn resultiert die Erschaffung der Welt und allen Lebens im "unbedingten Macht- und Liebeswillen Gottes" (4) und er kritisiert gleichzeitig jegliche Angriffe auf den biblischen Schöpfungsmythos. Er stützt seine Argumente auf die "Ergebnisse einer wahrhaft gesunden [...] Naturforschung" (12/13), wobei jedoch offen bleibt, auf welche Forschungsergebnisse er sich bezieht. Aggressiv verteidigt er die christliche Lehre und den Ablauf der Schöpfung, wie er in Genesis beschrieben wird. Er wirft den Darwinisten vor ihre "phantastische Behauptung" (32) nicht belegen zu können. Zöckler sieht in der Evolutionstheorie eine Bedrohung für den christlichen Glauben und ermahnt seine Zeitgenossen sich nicht auf ein "Tauschgeschäft" (43) einzulassen, da nur das Christentum alleine Heil bringen kann.
Insgesamt lässt sich eine einseitige Sichtweise des Autors feststellen, für den ein Christ jeden Teil der Bibel akzeptieren muss, also auch die Schöpfung wie sie in der Bibel beschrieben wird. Für ihn bildet hat der Schöpfungsbericht eine "grundlegende Bedeutung für das Ganze [der] Heilswahrheit" (45/46) und der Zweifel an dessen Richtigkeit beinhaltet gleichzeitig die Gefahr eines Zweifeln an anderen Teilen der biblischen Überlieferungen. Die Einheit der Bibel und ihr Verständnis sind gefährdet, wenn der Mensch beginnt einerseits darwinistisch zu denken, was die Ursprünge der Welt betrifft, andererseits aber die übrigen Teile der Schrift akzeptieren will. Er sieht sich als Verteidiger der Heiligen Schrift kritisiert gerade den Mangel an göttlicher Liebe und Vernunft, der den Darwinismus charakterisiert. Zöckler selbst beruft sich auf wissenschaftliche Belege, die die Erschaffung des Lebens durch Gott unterstützen und verweigert den darwinistischen Forschern jegliche Akzeptanz für ihre
Forschungsergebnisse, obwohl sich keine der beiden Thesen beweisen lässt. Erneut ist eine teilweise intolerante Haltung des Theologen erkennbar, welcher nicht den Versuch unternimmt auf Argumente der Gegenpartei einzugehen, sondern die Darwinisten pauschal diffamiert.
4a) Unterschiede zwischen den zwei biblischen Schöpfungsberichten
Der erste Bericht (1.Mose 1,1-2,4a) beschreibt einen Ablauf der Schöpfung, der den Theorien der darwinistischen Wissenschaft ähnelt. Zuerst erschafft Gott Himmel und Erde und daraufhin das Licht als wichtige Voraussetzung für das Leben. Er trennt das Land vom Wasser und beginnt erste Lebewesen in Form von Pflanzen auf der Erde zu schöpfen.
Nachdem die Gestirne gemacht sind, erfolgt die Erschaffung von Tieren im Meer und dann auf dem Lande. Dieser Teil unterstützt die Theorie, wonach der Ursprung allen Lebens im Wasser zu finden ist. Als Krone seines Werkes wird der Mensch von Gott nach seinem Abbild geschaffen, woraufhin die Schöpfung vollendet ist und Gott für einen Tag ruht. Insgesamt lässt sich feststellen, dass acht Schöpfungsereignisse auf sechs Tage verteilt werden. Weiter wird zwischen der Schöpfung durch das Wort und der Schöpfung durch ein Machen oder Wirken unterschieden Im zweiten Schöpfungsmythos (1.Mose 2,4b-2,25) steht der Mensch am Anfang der Welt, die zuerst leer, aber feucht ist, also Wasser als Lebensvorrausetzung durchaus besitzt. Gott haucht dem Menschen den Lebensatem ein und legt für ihn einen Garten an. Unter den zahlreichen Pflanzen, die er macht befindet sich auch der Baum der Erkenntnis, der später in der Versuchung eine wichtige Rolle spielen soll. Nachdem die Tiere gemacht sind, wird aus einer Rippe des Menschen die Frau erschaffen, die dem Mann als Partnerin gegeben wird. Ein wichtiger Unterschied liegt in der Abfolge der Geschehnisse, die im ersten Bericht chronologisch und in sinnvoller Abfolge stattfinden und den Menschen ans Ende der Schöpfung stellen und ihm damit eine zentrale Rolle zugestehen, da seiner Erschaffung zudem ein ganzer Tag gewidmet ist. Anders im zweiten Mythos, wo der Mensch gleich zu Beginn auftritt und erst danach die Welt um ihn herum erschaffen wird. Doch auch hier hat er die größte Bedeutung, da ihm die Erde zur Erhaltung unterstellt wird. Im Gegensatz zum ersten Mythos findet die Erschaffung aller Dinge an einem durch die Lage der vier Flüsse genau beschriebenen Ort und in einem begrenzten Raum, dem Garten Eden, statt, während die Schöpfung in der ersten Überlieferung auf der gesamten Erde vollzogen wird. Die zweite Schöpfungsgeschichte ist außerdem nicht an einen ähnlich strengen Zeitrahmen wie der erste Bericht gebunden, über die Dauer der Geschehnisse werden keine Angaben gemacht.
4b) Die Autoren, ihre Botschaft und das Umfeld
Die erste Schöpfungsgeschichte gehört dem Werk der Priesterschrift an und wurde zur Zeit der israelitischen Gefangenschaft in Babylon ( ~ 470 v.Chr.) verfasst. Wie der Name zeigt wurden die Erzählungen von der Priesterschaft verfasst und reichen vom ersten Schöpfungsmythos über die Wüstenzeit bis hin zum Bundesschluss Gottes mit dem Volk Israel. In dieser Hinsicht kann die Priesterschrift und die Schöpfungsgeschichte als ein Teil von ihr als Beschreibung der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel verstanden werden, in der die Autoren Rechenschaft über die Herkunft ihres Volkes ablegen. Die Verfasser versuchen so objektiv wie möglich zu berichten, was sich an mehreren Geschlechtsregistern und Gesetzestexten zeigt, die diese Schrift beinhaltet. In ihrer Funktion als Priester wollten die Autoren "in streng geformter Sprache"1 dem Leser nur die für ihn wichtigen Dinge vermitteln und verzichten auf lebhafte Erzählungen. Zentrales Motiv ist die Betonung der Größe und Einzigartigkeit Gottes. Die Erschaffung der Welt wird als grundsätzlich gut beschrieben und es tritt kein Sündenfall auf. Es zeigt sich, dass sich die Priesterschrift mit babylonischen Mythen in der Schöpfungsgeschichte selber auseinandersetzt, vielleicht ein Resultat des Lebens im Exil. Aufgrund der "theozentrischen Bestimmtheit herrscht die Gottesrede vor, der der Mensch schweigend gehorcht"2 und erst später ergreift dieser selbst das Wort (1.Mose 17/18).
Der zweite Bericht wurde von dem sogenannten Jahwisten verfasst, dessen Name von seiner Bezeichnung "Jahwe" für Gott herrührt. Die jahwistischen Erzählungen bilden zugleich den ältesten Teil des Pentateuch und wurden zur Zeit Salomons, also um das Jahr 940 v.Chr. niedergeschrieben. In dieser Epoche empfanden es die Menschen als notwendig die alten Mythen und Erzählungen schriftlich festzuhalten, was mit dem Werk des Jahwisten geschah. Die Spanne seiner Erzählungen reicht vom zweiten Schöpfungsmythos bis zur Wüstenzeit. Die Schriften sind durch eine "lebendig[e] und plastisch[e] Sprache"3 charakterisiert, im Gegensatz zur Priesterschrift, die eher sachlich berichtet. Ein weiters Merkmal sind die zahlreichen Anthropomorphismen, die dem Gott Israels menschliche Züge verleihen ohne jedoch seine Größe in Frage zu stellen. Als theologischer Leitgedanke ist der Sündenfall des Menschen zu erkennen, der mit der Vertreibung aus dem Paradies beginnt, am Brudermord des Kains fortgeführt wird und sich Turmbau zu Babel erneut zeigt. Der Jahwist legt Wert auf die Beschreibung des Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen, wobei der Glaube an die göttliche Geschichtsführung eine wichtige Rolle spielt.
Abschließend lässt sich feststellen, dass beide Mythen schon vor ihrer ersten schriftlichen Erwähnung existierten und über Generationen mündlich überliefert wurden, wobei auch fremdreligiöse Elemente eine Verarbeitung erfuhren.
5) Antworten auf Otto Zöckler
Dem Theologen Zöcklers ist in Hinsicht auf seine Feststellung man könne die Bibel nur als Einheit verstehen und akzeptieren rechtzugeben, denn ein Verneinen der Schöpfung durch Gott würde dieses bedeuten. Das Resultat wäre eine Einstufung der einzelnen Kapitel der Bibel in solche, die beweisbar und rational nachvollziehbar sind, und in solche, die sich nicht mit den Erkenntnissen der Wissenschaft vereinbaren lassen und daher nicht glaubenswert sind. Andererseits muss der Schöpfungsbericht nicht unbedingt wörtlich verstanden werden, sondern auch durch eine bildliche Interpretation ist das Wirken Gottes in der Schöpfung nicht ausgeschlossen, denn eine Lenkung der Schöpfung kann auch anders und über einen längeren Zeitraum erfolgt sein. In neuzeitliche Bibelauslegungen wird auch die Tatsache berücksichtigt, dass die Verfasser der Schöpfungsgeschichte keinen wissenschaftlichen Bericht abfassten, sondern zeitlos gültige Glaubensaussagen über das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen treffen wollten, die auch in unserer Zeit neu interpretiert werden können.
Ein weiterer Ansatz besteht in dem Gedanken, dass in der Materie selber bereits in ihren Ursprüngen die Möglichkeit für höheres Leben angelegt war, was auch als das Wirken Gottes in der Schöpfung verstanden werden kann. Eine Begründung der Entwicklung des Lebens, die sich alleine auf den Zufall oder die Selektion beruft ist jedenfalls nicht zu akzeptieren, da jede Konstruktion einen Bauplan voraussetzt und folgerichtig auch der Existenz eines Konstrukteurs, also Gott, bedarf.
Zudem ist nach biblischer Aussage der Höhepunkt der Schöpfung mit der Erschaffung des Menschen erreicht, wobei im Darwinismus eine weitere Evolution nicht ausgeschlossen ist. Die grundsätzliche Kritik des Autors am Darwinismus ist aus christlicher Sicht nachvollziehbar, auch wenn der Wortlaut der Schöpfungsgeschichte durchaus als interpretierbar angesehen werden kann. Abschließend lässt sich mit dem Satz von Pasteur ein weiteres Argument gegen den Darwinismus finden, der auf die ersten Ursprünge des Lebens nicht eingeht:
"Leben kann nur von Leben abstammen (omne vivum ex vivo)."
6) Quellennachweis
a) Literatur
[1] Grothaus, Hans: Zur Bibel, Dortmund 1976.
[2] La Sor, William Sanford: Das Alte Testament: Entstehung-Geschichte-Botschaft, Gießen 1989.
[3] Ökumenischer Arbeitskreis für Bibelarbeit: Urgeschichten, Köln 1985.
[4] Schlatter, Theodor: Calwer Bibellexikon, Stuttgart 1986.
[5] Weiser, Artur: Einleitung in das Alte Testament, Göttingen 1962.
[6] Westermann, Claus: Genesis 1-11, Darmstadt 1976.
b) Internet
[1] www.rhone.ch /arisf/index.htm
[2] www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/d36/darwinja.htm
[3] www.lib.virginia.edu/cgi-bin/texis/webinator/searchlib
[4] www.biography.com
[...]
[1] Grothaus, Hans: Zur Bibel, Dortmund 1976. Seite 11.
[2] Schlatter, Theodor: Calwer Bibellexikon, Stuttgart 1986. Seite 1072.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Charles Darwin und was sind seine Grundthesen?
Charles Darwin wurde am 12. Februar 1809 in Shrewsbury/Shropshire in England geboren. Er erlangte Berühmtheit durch seine Evolutionstheorie, die besagt, dass die Natur ein Resultat ständiger Entwicklung ist und das Überleben der Arten durch natürliche Auslese oder Zufall gesichert wird. Seine bekannteste These ist, dass der Mensch von der anthropoiden Gruppe abstammt, die er in "The Descent of Man" (1871) begründet.
Warum stießen Darwins Thesen auf Widerstand der Kirchen?
Die Kirchen sahen in Darwins Theorie einen Widerspruch zur Bibel und zu den Grundwerten des Christentums. Die christliche Theologie sah die gesamte Welt als Schöpfung Gottes und empfand Darwins Theorie als Gegenbeweis. Die Vorstellung einer allmählichen Entwicklung ohne Fremdeinwirkung stand im Kontrast zu den Schöpfungsmythen der Bibel und zu der Vorstellung des christlichen Glaubens.
Was sind die Argumente von Otto Zöckler gegen Darwins Evolutionstheorie?
Zöckler sieht in der darwinistischen Evolutionstheorie einen Widerspruch zum christlichen Schöpfungsbericht. Für ihn resultiert die Erschaffung der Welt und allen Lebens im "unbedingten Macht- und Liebeswillen Gottes". Er kritisiert jegliche Angriffe auf den biblischen Schöpfungsmythos und sieht in der Evolutionstheorie eine Bedrohung für den christlichen Glauben.
Welche Unterschiede gibt es zwischen den zwei biblischen Schöpfungsberichten (1.Mose 1,1-2,4a und 1.Mose 2,4b-2,25)?
Der erste Bericht (Priesterschrift) beschreibt einen Ablauf der Schöpfung, der den Theorien der darwinistischen Wissenschaft ähnelt, mit einer chronologischen Abfolge. Der Mensch wird am Ende der Schöpfung geschaffen. Der zweite Bericht (Jahwist) stellt den Menschen an den Anfang, bevor die Welt um ihn herum erschaffen wird. Die Abfolge der Ereignisse und der Stellenwert des Menschen unterscheiden sich deutlich.
Wer waren die Autoren der beiden Schöpfungsberichte und was war ihre Botschaft?
Der erste Bericht stammt von der Priesterschrift und wurde zur Zeit der israelitischen Gefangenschaft in Babylon verfasst (ca. 470 v.Chr.). Die Priesterschaft wollte die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel darstellen und die Größe Gottes betonen. Der zweite Bericht wurde vom Jahwisten um 940 v.Chr. verfasst, zur Zeit Salomons. Der Jahwist legt Wert auf die Beschreibung des Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen, wobei der Glaube an die göttliche Geschichtsführung eine wichtige Rolle spielt.
Wie kann man auf Otto Zöcklers Argumente antworten?
Man kann Zöckler zustimmen, dass die Bibel als Einheit verstanden werden sollte, aber der Schöpfungsbericht muss nicht unbedingt wörtlich interpretiert werden. Eine bildliche Interpretation schließt das Wirken Gottes in der Schöpfung nicht aus. Eine Lenkung der Schöpfung kann auch anders und über einen längeren Zeitraum erfolgt sein. Der Entwicklung des Lebens sollte nicht alleine auf Zufall oder Selektion beruhen, es kann stattdessen als Wirken Gottes in der Schöpfung verstanden werden.
Welche Quellen werden im Text verwendet?
Der Text verweist auf verschiedene Literaturquellen wie "Zur Bibel" von Hans Grothaus, "Das Alte Testament: Entstehung-Geschichte-Botschaft" von William Sanford La Sor, und "Genesis 1-11" von Claus Westermann. Zudem werden Internetquellen wie www.rhone.ch, www.rrz.uni-hamburg.de, www.lib.virginia.edu und www.biography.com genannt.
- Quote paper
- Matthias Schwab (Author), 2001, Darwin, Charles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101758