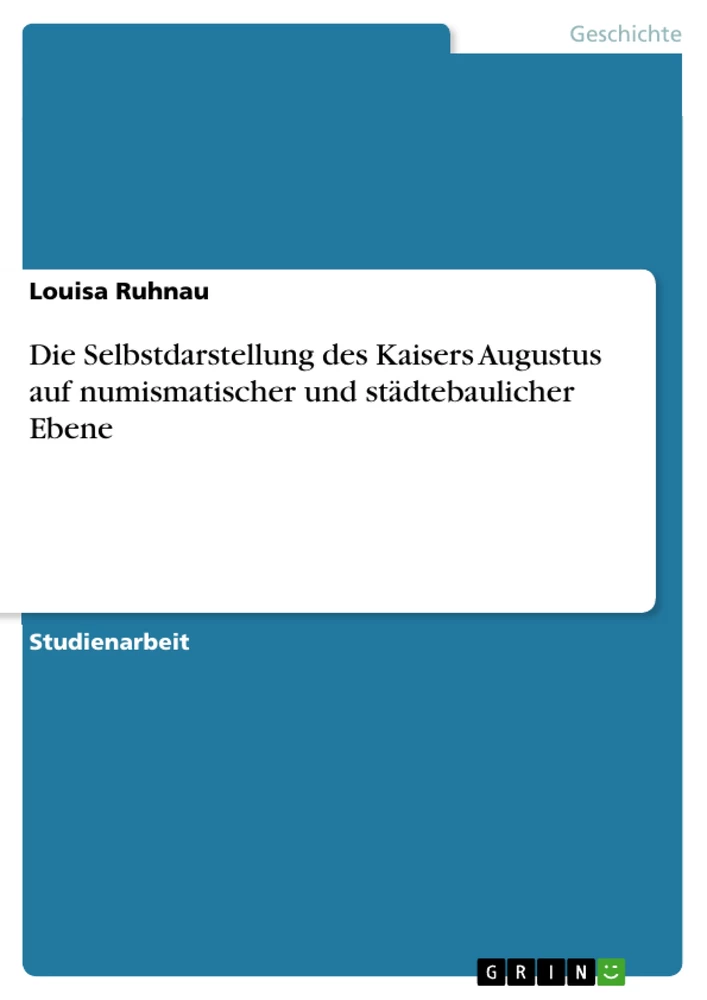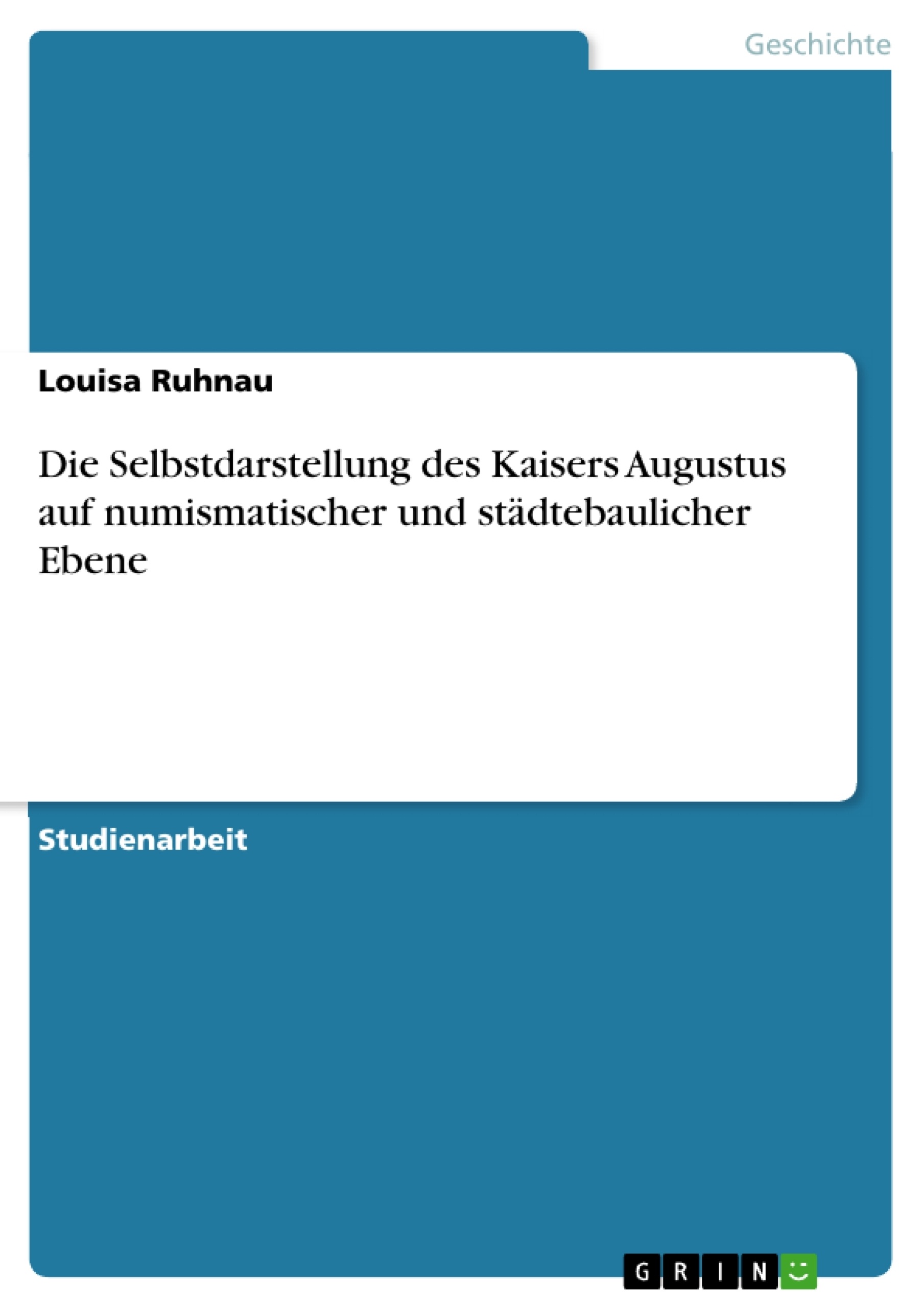Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, wodurch sich die Selbstdarstellung des Augustus in numismatischer sowie städtebaulicher Form auszeichnet, welche Zielgruppen angesprochen werden und inwiefern Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Inszenierung des princeps durch Münzen sowie Gebäude festzustellen sind.
Augustus, der Erhabene, nutzt diverse Darstellungsformen und -medien zur Präsentation seiner Person. Im Vordergrund stehen dabei die Etablierung und Akzeptanz des neuen Herrschaftssystems, des Prinzipats. Von enormer Bedeutung sind in diesem Kontext insbesondere die Numismatik sowie in der Hauptstadt des Römischen Reiches errichteten Bauwerke. Augustus, welcher sich selbst als princeps, der Erste, bezeichnet, versucht seine übergeordnete Stellung im Staat durch unterschiedliche Komponenten zu legitimieren sowie zu stützen. Dazu verwendet er unterschiedliche bildliche, schriftliche sowie bauliche Formen der Selbstdarstellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Münzprägung
- Funktion
- Programmatik
- Bauwerke
- Bauten als Herrschaftsmanifestation
- Forum Romanum und Forum Iulius
- Forum Augustum
- Residenz des Augustus auf dem Palatin
- Aquädukte
- Vergleich der numismatischen und städtebaulichen Selbstdarstellung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Selbstdarstellung des Kaisers Augustus auf numismatischer und städtebaulicher Ebene. Sie analysiert die Funktion und Programmatik der Münzprägung, die Bauten als Herrschaftsmanifestation und den Vergleich beider Darstellungsformen.
- Die Funktion der Münzprägung als Kommunikationsmittel
- Die Programmatik der augusteischen Münzen, die seine Herrschaft legitimieren soll
- Die Rolle von Bauwerken als Ausdruck von Macht und Einfluss
- Der Vergleich der numismatischen und städtebaulichen Selbstdarstellung
- Die Bedeutung von Quellenkritik bei der Interpretation der Selbstdarstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Person des Augustus und seine Bedeutung für das Römische Reich vor. Sie skizziert die Ziele der Arbeit und die zu untersuchenden Fragen.
Münzprägung
Funktion
Dieses Kapitel befasst sich mit der Funktion der Münzen als Kommunikationsmittel im antiken Rom. Es untersucht die Bedeutung der Münze als Geldmittel und Träger von Botschaften.
Programmatik
Dieses Kapitel analysiert die Programmatik der Münzprägung unter Augustus. Es zeigt, wie Augustus die Münzen nutzt, um seine Herrschaft zu legitimieren und ein positives Bild seiner Person zu vermitteln.
Bauwerke
Bauten als Herrschaftsmanifestation
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle von Bauten als Ausdruck von Macht und Einfluss. Es untersucht die Bauprojekte des Augustus in Rom und deren Bedeutung für seine Selbstdarstellung.
Forum Romanum und Forum Iulius
Dieses Kapitel analysiert zwei wichtige Bauwerke des Augustus, das Forum Romanum und das Forum Iulius. Es zeigt, wie diese Bauten zur Stärkung seiner Herrschaft beitrugen.
Forum Augustum
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Forum Augustum, einem wichtigen Bauwerk des Augustus. Es analysiert die Bedeutung des Forums für die Selbstdarstellung des Kaisers.
Residenz des Augustus auf dem Palatin
Dieses Kapitel untersucht die Residenz des Augustus auf dem Palatin. Es analysiert die Bedeutung des Palasts für die Selbstdarstellung des Kaisers.
Aquädukte
Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung der Aquädukte für die Selbstdarstellung des Augustus. Es untersucht die Funktion der Aquädukte und ihre Rolle als Symbol von Macht und Wohlstand.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Augustus, Selbstdarstellung, Münzprägung, Numismatik, Stadtbau, Bauten, Herrschaftsmanifestation, Prinzipat, Römisches Reich, Antike.
- Quote paper
- Louisa Ruhnau (Author), 2020, Die Selbstdarstellung des Kaisers Augustus auf numismatischer und städtebaulicher Ebene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021834