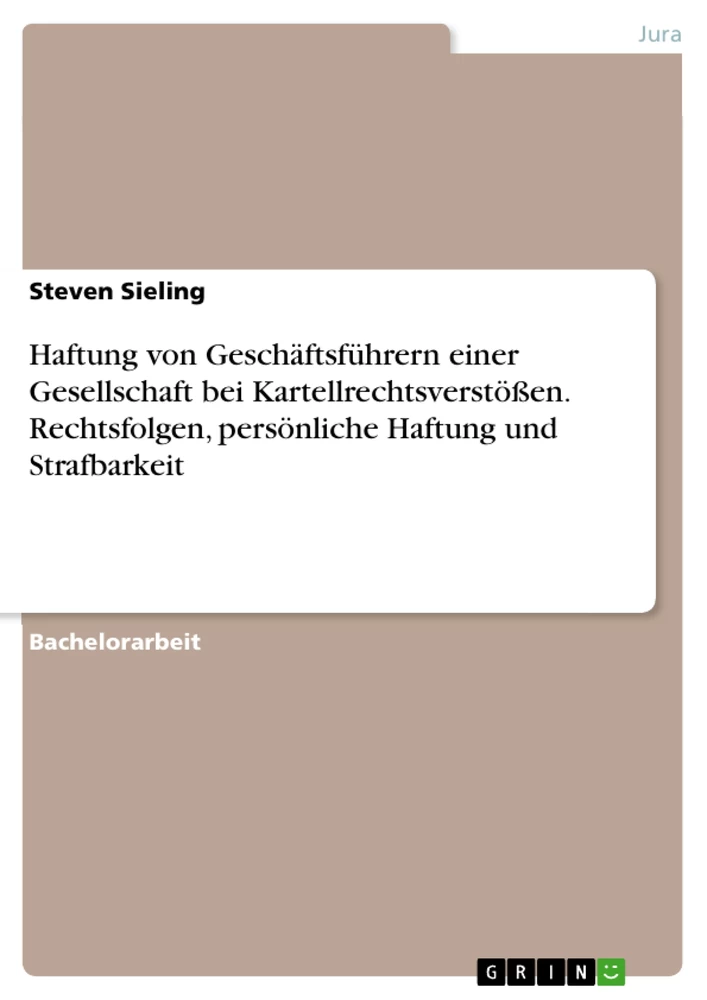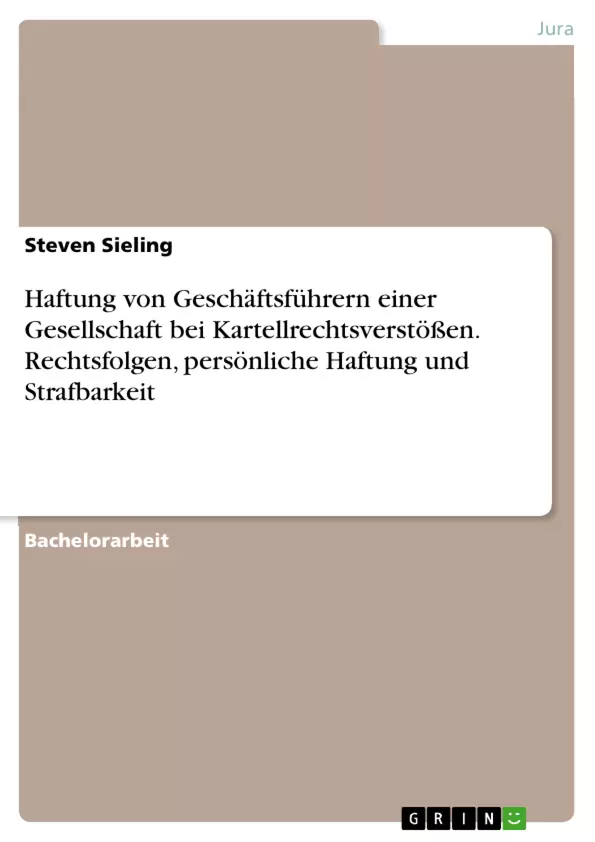Diese Arbeit geht dem Phänomen der Kartellrechtsverstöße und der Haftung von Geschäftsführern einer Gesellschaft bei solchen nach. Dabei ist das Ziel zu erörtern, ob Unternehmen den Taten ihrer Geschäftsführer tatsächlich hilflos ausgesetzt sind und unter welchen Umständen Geschäftsführer persönliche Folgen zu erwarten haben. Konträr wird aufgezeigt, was Geschäftsführer tun können, um sich zu schützen und das persönliche Haftungsrisiko zu minimieren.
Mit dem Schutz vor Wettbewerbsverfälschungen verfolgt das Kartellrecht die Sicherstellung eines freien Wettbewerbs und stützt somit ein grundlegendes Element der Marktwirtschaft. Nicht selten versuchen Unternehmen sich auf verschiedenste Art und Weise dem Wettbewerb zu entziehen, um sich Vorteile gegenüber Konkurrenten zu verschaffen.
Das klassische Beispiel einer solchen Wettbewerbsverfälschung ist in dem höchst aktuellen Kaffeekartell wiederzufinden. Aufgrund einer geheimen Preisabsprache konkurrierender Unternehmen hat allein die Einzelhandelskette Rossmann eine Geldbuße von 30 Mio. Euro hinnehmen müssen. Von solchen Strafen, die mittlerweile die Milliardengrenze erreichen, wird regelmäßig berichtet. Nur aufgrund einiger Cents Unterschied beim Preis des Filterkaffees, den man selber jeden Tag trinkt.
Das zeigt, dass auch wir als Endverbraucher von solchen Absprachen unmittelbar betroffen sind. Doch wer trifft eigentlich die Entscheidungen zu solchen Gesetzesverstößen? Sicherlich hat sich nicht das Unternehmen als Ganzes dazu entschieden die Grenzen des Kartellrechts zu überschreiten. Demnach stellt sich die Frage nach den verantwortlich handelnden Personen – den Geschäftsführern.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemstellung und Ziel der Arbeit
- II. Aufbau der Arbeit
- B. Kartellverbot
- I. Das Kartellverbot
- 1. Tatbestand
- a. Anwendungsbereich
- b. Koordinationssachverhalt
- aa. Vereinbarungen
- bb. Beschlüsse
- cc. Abgestimmte Verhaltensweisen
- c. Beschränkung des Wettbewerbs
- aa. Einschränkung der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit
- bb. Zweck und Wirkung
- cc. Spürbarkeit
- 2. Ausnahmen vom Kartellverbot
- a. Freistellungen
- aa. Einzelfreistellungen
- bb. Gruppenfreistellungen
- cc. Sonderfälle des deutschen Kartellrechts
- b. Tatbestandliche Ausnahmen
- a. Freistellungen
- II. Kartellrechtsverstöße
- 1. Wettbewerbsbeschränkungen
- 2. Missbrauch marktbeherrschender Stellung
- 3. Unternehmenszusammenschlüsse
- 1. Tatbestand
- C. Rechtsfolgen von Kartellrechtsverstößen
- I. Behördliche Sanktionen
- 1. Bußgelder
- 2. Zwangsgelder
- 3. Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils
- II. Zivilrechtliche Folgen
- 1. Schadensersatzpflicht
- 2. Nichtigkeit des betroffenen Rechtsgeschäfts
- 3. Abwehransprüche
- I. Behördliche Sanktionen
- D. Persönliche Haftung
- I. Geschäftsführung nach Rechtsform
- 1. Aktiengesellschaft
- 2. Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- II. Unmittelbare Organhaftung
- 1. Geldbuße
- a. Persönliche Bußgelder durch aktiven Kartellverstoß
- b. Persönliche Bußgelder durch Aufsichtspflichtverletzung
- 2. Schutz gegen persönliche Bußgelder
- a. Erstattungszusagen
- b. Directors & Officers-Versicherung
- c. Compliance
- III. Mittelbare Organhaftung
- 1. Innenregress von Unternehmensgeldbußen
- 2. Schadensersatzansprüche
- IV. Strafbarkeit von Kartellrechtsverstößen
- I. Geschäftsführung nach Rechtsform
- E. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Haftung von Geschäftsführern bei Kartellrechtsverstößen und verfolgt das Ziel, die Verantwortlichkeiten und Risiken im Kontext von Kartellrechtsverstößen zu beleuchten.
- Das Kartellverbot und dessen Anwendungsbereich
- Die verschiedenen Arten von Kartellrechtsverstößen
- Die rechtlichen Folgen von Kartellrechtsverstößen für Unternehmen und Geschäftsführer
- Möglichkeiten der Haftungsminimierung für Geschäftsführer
- Die Strafbarkeit von Kartellrechtsverstößen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Problemstellung und das Ziel der Arbeit, die sich mit der Haftung von Geschäftsführern bei Kartellrechtsverstößen beschäftigt. Der Fokus liegt dabei auf der Erörterung der Verantwortlichkeiten und Risiken von Geschäftsführern im Zusammenhang mit Kartellrechtsverstößen.
Kapitel B beleuchtet das Kartellverbot und dessen Anwendungsbereich. Es werden die verschiedenen Tatbestandsmerkmale des Kartellverbots sowie die Ausnahmen vom Verbot erläutert.
Kapitel C befasst sich mit den Rechtsfolgen von Kartellrechtsverstößen. Sowohl behördliche Sanktionen wie Bußgelder und Zwangsgelder als auch zivilrechtliche Folgen wie Schadensersatzpflicht und Nichtigkeit des betroffenen Rechtsgeschäfts werden ausführlich dargestellt.
Kapitel D widmet sich der persönlichen Haftung von Geschäftsführern bei Kartellrechtsverstößen. Es werden die verschiedenen Arten der Haftung, wie die unmittelbare Organhaftung und die mittelbare Organhaftung, sowie die Möglichkeiten der Haftungsminimierung für Geschäftsführer durch Erstattungszusagen, Directors & Officers-Versicherungen und Compliance-Maßnahmen untersucht.
Schlüsselwörter
Kartellrecht, Kartellrechtsverstöße, Haftung, Geschäftsführer, Unternehmen, Bußgelder, Schadensersatz, Compliance, Wettbewerbsrecht, Marktbeherrschung, Fusionskontrolle, Missbrauchsaufsicht.
Häufig gestellte Fragen
Wann haften Geschäftsführer persönlich für Kartellrechtsverstöße?
Geschäftsführer haften persönlich bei aktiver Beteiligung an Kartellabsprachen oder bei einer schuldhaften Verletzung ihrer Aufsichtspflichten (Compliance-Versagen).
Welche Rechtsfolgen drohen Unternehmen bei Kartellverstößen?
Es drohen behördliche Sanktionen wie Bußgelder in Milliardenhöhe, Zwangsgelder, die Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile sowie zivilrechtliche Schadensersatzforderungen.
Was sind typische Beispiele für Kartellrechtsverstöße?
Klassische Beispiele sind Preisabsprachen (wie beim Kaffeekartell), Marktaufteilungen, der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung oder unzulässige Unternehmenszusammenschlüsse.
Wie können sich Geschäftsführer vor Haftungsrisiken schützen?
Schutz bieten die Implementierung wirksamer Compliance-Systeme, der Abschluss von Directors & Officers-Versicherungen (D&O) sowie rechtlich geprüfte Erstattungszusagen.
Gibt es eine strafrechtliche Relevanz bei Kartellverstößen?
Ja, bestimmte Kartellverstöße können neben Bußgeldern auch strafrechtliche Konsequenzen für die verantwortlichen Personen nach sich ziehen, insbesondere bei Betrug oder wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen.
- I. Das Kartellverbot
- Quote paper
- Steven Sieling (Author), 2018, Haftung von Geschäftsführern einer Gesellschaft bei Kartellrechtsverstößen. Rechtsfolgen, persönliche Haftung und Strafbarkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1023774