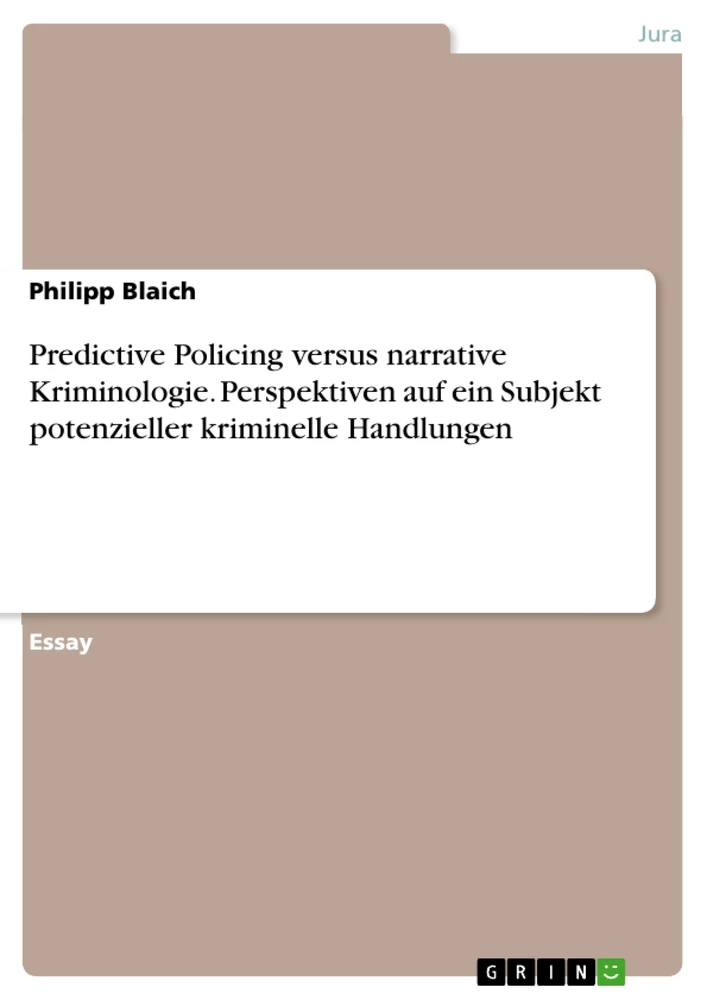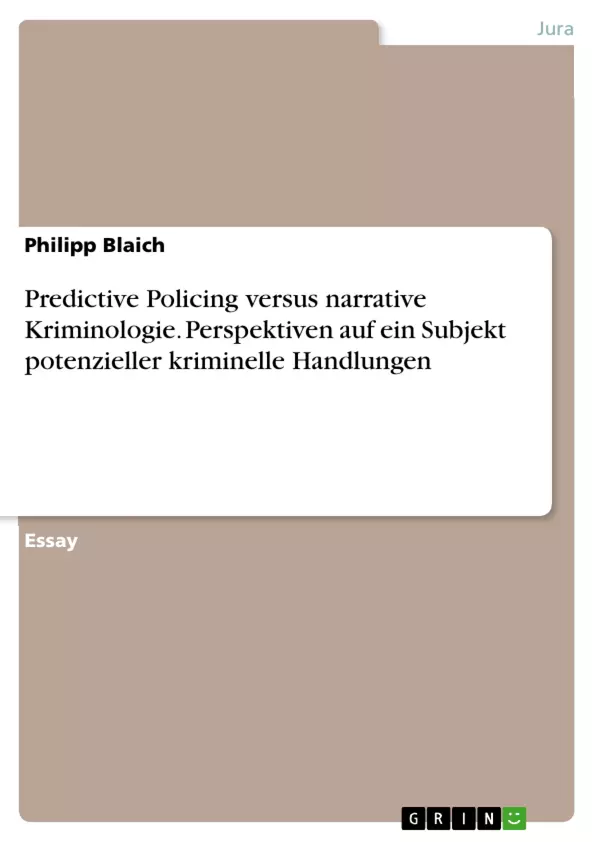In diesem Essay wird gezeigt, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was in der kriminologischen Forschung an Mitteln für eine erfolgreiche Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung vorgeschlagen und angewendet und was auf der anderen Seite an staatlichen Mitteln und Instrumenten dafür verwendet werden.
Der größte Unterschied hierbei ist das Menschenbild, bzw. das Epistem, wie Mehozay und Fisher sich ausdrücken. Auf der einen Seite wird eine emotionsbetonte, kulturelle Kontextualisierung vorgenommen, um die Ursachen einer terroristischen Handlung zu erforschen, um gegen die Ursachen, die bei dem Menschen zu finden sind, vorzugehen, und den Menschen somit als komplexes und wandelbares Wesen verstehen; auf der anderen Seite wird der Mensch als Datenbündel reduziert, dem keine Handlungsmacht oder Wandelbarkeit zugesprochen wird. Es wird aus letzterer, algorithmischer Perspektive also nicht versucht, Umstände, die schädliches Verhalten hervorbringen zu beseitigen, sondern die Menschen zu beseitigen, die aus diesen Umständen erwachsen sind. Dieses letztere System kann schließlich nur wirklichen Erfolg verbuchen, wenn es stark repressiv ist und die Umstände tatsächlich kontrollieren kann, was aktuell nicht der Fall ist. Erklären, erforschen oder gar beheben kann dieses algorithmische System die Umstände nicht. Dazu bedarf es der Theorie und eines humanistischen Menschenbildes.
Inhaltsverzeichnis
- Perspektiven auf ein Subjekt (potenzieller) krimineller Handlungen
- Predictive Policing und das algorithmische Selbst
- Narrative Kriminologie - Narrative Analysen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Frage, wie ein Subjekt, dem ein kriminelles Handeln zugesprochen wird, dargestellt und analysiert werden kann. Er untersucht die Unterschiede zwischen algorithmischen Risikoeinschätzungen und narrativen Analysen im Hinblick auf die Bekämpfung von Kriminalität und die jeweilige Sichtweise auf das menschliche Subjekt.
- Die Entwicklung des "managerialen Denkens" in der Pönologie und die Entstehung des algorithmischen Selbst
- Die Rolle von Predictive Policing und Algorithmen in der Kriminalitätsbekämpfung
- Die Bedeutung von narrativen Analysen in der Kriminologie
- Der Unterschied zwischen ätiologischer und präventiver Kriminalitätsbekämpfung
- Die Relevanz des humanistischen Menschenbildes für die Kriminalitätsbekämpfung
Zusammenfassung der Kapitel
Perspektiven auf ein Subjekt (potenzieller) krimineller Handlungen
Der Essay untersucht die Entwicklung der Kriminalitätsbekämpfung im Hinblick auf die zunehmende Verwendung algorithmischer Analysen. Er stellt fest, dass die Risikoberechnung mittels Algorithmen zwar präventive Maßnahmen ermöglicht, jedoch ein neues Epistem hervorbringt, das vom humanistischen Menschenbild abweicht. Dieses Epistem betrachtet den Menschen lediglich als Datenpunkt und negiert die Rolle von sozialen und kulturellen Faktoren.
Predictive Policing und das algorithmische Selbst
Der Abschnitt beleuchtet die Entwicklung des "managerialen Denkens" in der Pönologie und die damit einhergehende Betonung der Prävention von Kriminalität. Er diskutiert die Entstehung des algorithmischen Selbst, welches den Menschen als Datenpunkt betrachtet, der durch die Algorithmen in Risikokategorien eingeteilt wird. Soziale Theorien werden dabei nicht berücksichtigt und die Algorithmen lernen autonom weiter, ohne ein Verständnis für den Menschen.
Narrative Kriminologie - Narrative Analysen
Im Gegensatz zu Predictive Policing und Algorithmen konzentrieren sich narrative Analysen auf die Selbstdarstellungen von Personen, denen ein kriminelles Handeln zugeschrieben wird. Dieser Ansatz betrachtet den Menschen als soziales und kulturelles Wesen und versucht, die Ursachen für kriminelles Verhalten durch die Analyse von Narrativen und Emotionen zu verstehen.
Narrative Analysen und Terrorismus
Die Anwendung von narrativen Analysen auf das Manifest von Anders Breivik zeigt, wie Selbstdarstellungen durch kulturelle Kontexte und andere Narrative beeinflusst sind. Die Analyse von Breiviks Narrativ offenbart seine Ideologie, seine Emotionen und die Einflüsse, die zu seinen Handlungen geführt haben.
Schlüsselwörter
Dieser Essay befasst sich mit den Themen Predictive Policing, algorithmisches Selbst, narrative Analysen, Terrorismus, Kriminalität, Humanismus, Prävention, Ätiologie, Selbstdarstellung, Narrative, kulturelle Kontextualisierung, Risikoberechnung, Datenanalyse, gesellschaftliche Einflüsse, emotionale Faktoren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Predictive Policing und narrativer Kriminologie?
Predictive Policing basiert auf Algorithmen und Datenpaketen zur Risikoberechnung, während die narrative Kriminologie den Menschen als soziales Wesen betrachtet und Ursachen durch Selbstdarstellungen und kulturelle Kontexte erforscht.
Was versteht man unter dem „algorithmischen Selbst“?
Es beschreibt ein Menschenbild, bei dem das Individuum auf ein Datenbündel reduziert wird, ohne ihm eigenständige Handlungsmacht oder Wandelbarkeit zuzusprechen.
Warum wird Predictive Policing in der Arbeit kritisch gesehen?
Die Kritik lautet, dass Algorithmen zwar Symptome verwalten, aber die tieferliegenden sozialen Ursachen von Kriminalität weder erklären noch beheben können.
Wie hilft die narrative Analyse bei der Erforschung von Terrorismus?
Durch die Analyse von Manifesten (z. B. Anders Breivik) werden Ideologien, Emotionen und kulturelle Einflüsse sichtbar, die zu den Taten geführt haben.
Welche Rolle spielt das humanistische Menschenbild in der Kriminologie?
Ein humanistisches Menschenbild ist notwendig, um den Menschen als komplexes Wesen zu begreifen und präventive Maßnahmen zu entwickeln, die an den Ursachen schädlichen Verhaltens ansetzen.
- Quote paper
- Philipp Blaich (Author), 2020, Predictive Policing versus narrative Kriminologie. Perspektiven auf ein Subjekt potenzieller kriminelle Handlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030301