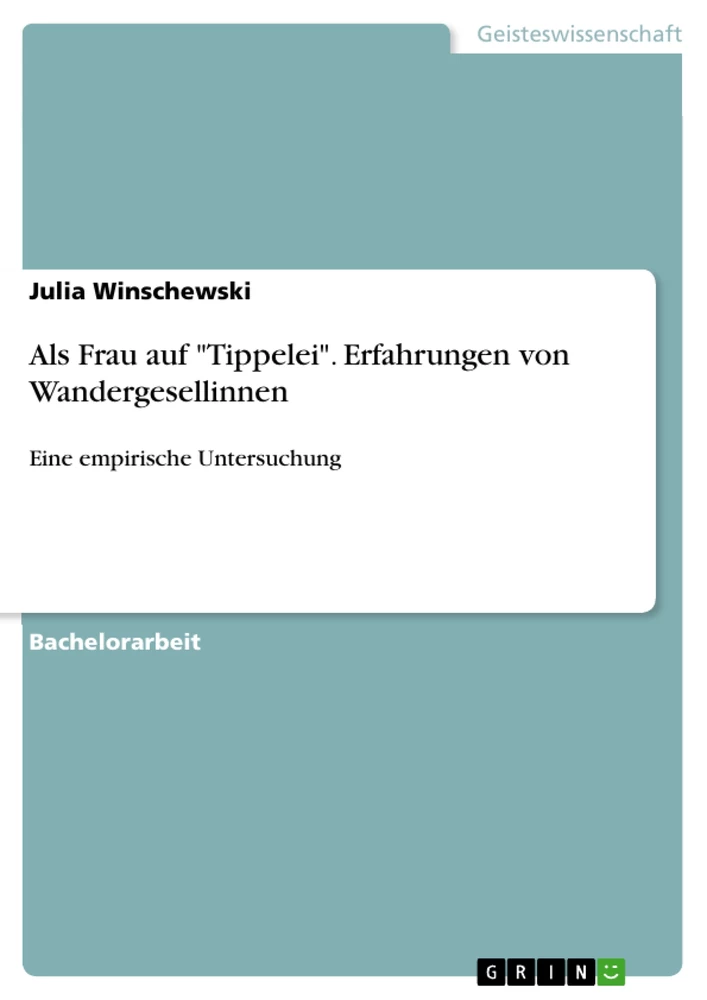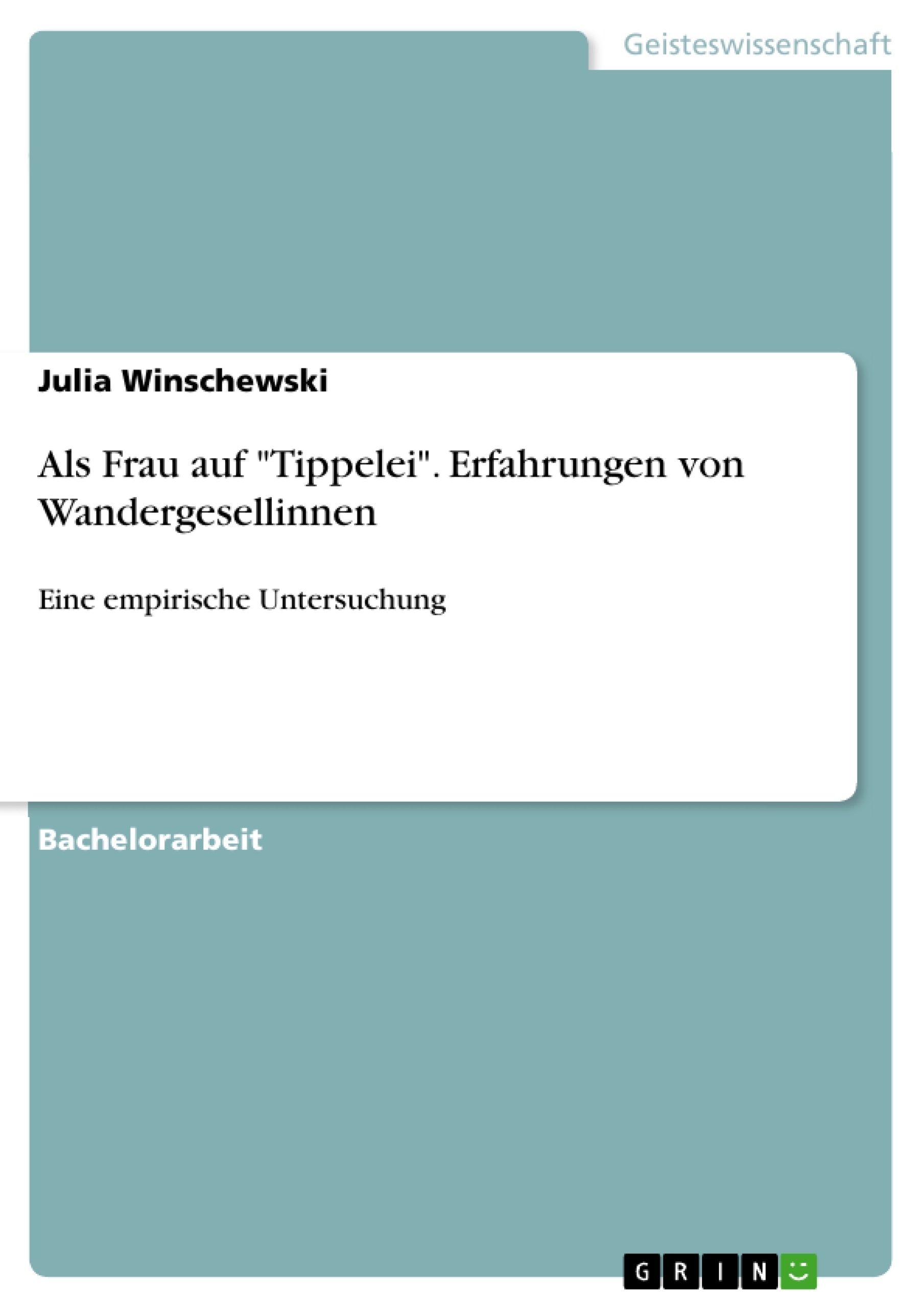Diese Arbeit handelt von den Erfahrungen von Frauen auf der Wanderschaft.
Die Wanderschaft, "Das letzte große Abenteuer unserer Zeit", auch "Walz" oder "Tippelei" genannt, zieht in heutiger Zeit weiterhin GesellInnen nach Abschluss ihrer Lehre für mindestens drei Jahre und einen Tag auf die Straße. Im Alltag sind diese WandergesellInnen nur selten persönlich anzutreffen, da ihre Zahl gemessen an der Gesamtbevölkerung verschwindend klein ist. Innerhalb der Gesellschaft werden WandergesellInnen oftmals mit Exotik, Mystik und Romantik assoziiert und verkörpern dabei bis heute ein Bild von althergebrachter Handwerkstradition. Dafür spricht auch, dass die Wanderschaft im Jahr 2014 von der deutschen UNESCO-Kommission als ein Immaterielles Kulturerbe Deutschlands ausgezeichnet wurde. Die Feststellung, dass reisende HandwerksgesellInnen heutzutage nicht mehr ausschließlich in schwarzer Kluft gekleidete Zimmermänner sind, wirkt dabei auf viele Außenstehende zunächst überraschend. Obwohl der Anteil von Frauen auf Wanderschaft gegenwärtig schätzungsweise bei sogar mehr als 23 Prozent liegt, ist es ein gesellschaftlich weitverbreiteter Irrglaube, dass Gesellinnen bis heute ihr Handwerk nicht traditionell erwandern könnten und es somit ausschließlich Männern vorbehalten sei auf Wanderschaft zu gehen. Die Verbreitung dieses Irrglaubens ist nicht verwunderlich, da jahrhundertelang das Bild des männlichen „zünftigen Wandergesellen“ von der Öffentlichkeit verinnerlicht und später auch immer wieder medial reproduziert wurde. Betrachtet man die jahrhundertelange Geschichte des traditionellen GesellInnenwanderns, so handelt es sich bei diesem vergleichsweise großen Anteil von Frauen auf Wanderschaft noch um ein relativ junges Phänomen, welches innerhalb der Tradition strukturelle und soziokulturelle Konflikte und Chancen birgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlegendes zur historischen Wanderschaft
- 2.1 Historischer Abriss
- 2.2 Traditionsschächte und Männerbund-Mentalität
- 2.3 Die „neuen“ Schächte und „die Freireisenden“
- 2.4 Zur Rolle der Frau im Handwerk
- 3 Quellen und Methoden
- 3.1 Feldzugang
- 3.2 Bemerkungen zur Forschungsethik
- 3.3 Erhebung und Analyse der Daten
- 3.4 Quellen- und Methodenkritik
- 4 Wandergesellinnentum in heutiger Zeit
- 4.1 Grundlegende Regeln der Wanderschaft
- 4.2 Gepflogenheiten auf der „Walz“
- 4.2.1 Die Kluft als Fluch und Segen der Wanderschaft
- 4.2.2 Die „Sprache der Landstraße“
- 5 Frauen auf „Tippelei“ – Genderspezifische Aspekte der Wanderschaft
- 5.1 Motivation für die Wanderschaft
- 5.2 Schacht oder Freireisend? – Struktureller Ausschluss von Frauen?
- 5.3 „Frauen waren doch schon immer auf Wanderschaft“ - Invention of Tradition
- 5.4 FAQ der Wandergesellinnen – Stereotype und Außenwahrnehmung
- 5.5 Frauenthemen, Frauensachen – Hygiene, Verhütung & Co…
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht genderspezifische Aspekte des gegenwärtigen Wandergesellinnentums. Ziel ist es, die subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen von Frauen auf der „Walz“ zu beleuchten und in einem soziokulturellen Kontext zu interpretieren. Die Arbeit verzichtet auf repräsentative Ergebnisse und fokussiert stattdessen auf die individuelle Vielfalt der Erlebnisse.
- Motivationen von Frauen zur Wanderschaft
- Struktureller Ausschluss von Frauen in der Tradition
- Außenwahrnehmung und Stereotype von Wandergesellinnen
- Geschlechtsspezifische Herausforderungen und Chancen der Wanderschaft
- Die Rolle der Frau in der Geschichte des Wandergesellinnentums
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Wandergesellinnentums ein und hebt die überraschend hohe, aber dennoch wenig erforschte, Anzahl von Frauen in dieser traditionell männlich geprägten Tätigkeit hervor. Sie thematisiert den verbreiteten Irrglauben, die Wanderschaft sei Frauen verwehrt, und benennt die Forschungslücke bezüglich genderspezifischer Aspekte. Die persönliche Motivation der Autorin, diese Thematik zu untersuchen, wird durch eine Begegnung mit einer Wandergesellin begründet und die Forschungsfragen der Arbeit werden formuliert.
2 Grundlegendes zur historischen Wanderschaft: Dieses Kapitel liefert einen kurzen historischen Abriss des Wandergesellinnentums, beginnend mit seinen Ursprüngen im 14. Jahrhundert. Es beleuchtet die Entwicklung von der notgedrungenen Arbeitssuche zu einem strukturierten Bestandteil der handwerklichen Ausbildung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und dem Wandel der Tradition, sowie der Rolle der Frau innerhalb dieses historischen Kontextes. Dabei wird die Herausbildung von „Schächten“ und die Bedeutung der „Kluft“ thematisiert.
3 Quellen und Methoden: Der Abschnitt beschreibt die methodischen Vorgehensweisen der Autorin. Es werden der Zugang zum Feld, ethische Aspekte der Forschung, die Datenerhebung und -analyse, sowie eine kritische Auseinandersetzung mit den Quellen und Methoden erläutert. Die Herausforderungen bei der Forschung in diesem traditionsreichen und teilweise geheimnisvollen Bereich werden hervorgehoben. Die Autorin begründet hier ihre Entscheidung für gendergerechte Sprache und reflektiert die Schwierigkeiten, objektive Daten in diesem Bereich zu erheben.
4 Wandergesellinnentum in heutiger Zeit: Das Kapitel beschreibt die gegenwärtigen Regeln und Gepflogenheiten der Wanderschaft, die „Walz“ oder „Tippelei“. Es behandelt die Bedeutung der Kluft und der speziellen Sprache der Wandergesellinnen. Die Regeln und Gepflogenheiten werden im Kontext der heutigen Gesellschaft beschrieben, wobei die Verschiedenartigkeit der Erfahrungen der Wandergesellinnen betont wird.
5 Frauen auf „Tippelei“ – Genderspezifische Aspekte der Wanderschaft: Dieses Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar und analysiert die Motivationen von Frauen zur Wanderschaft, den strukturellen Ausschluss von Frauen in der Vergangenheit und die Herausbildung einer „Invention of Tradition“. Es beleuchtet die Außenwahrnehmung und Stereotype von Wandergesellinnen und beschäftigt sich mit frauenspezifischen Themen wie Hygiene und Verhütung während der Reise.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Genderspezifische Aspekte des gegenwärtigen Wandergesellinnentums"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht genderspezifische Aspekte des gegenwärtigen Wandergesellinnentums. Der Fokus liegt auf den subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen von Frauen auf der „Walz“ und deren Interpretation in einem soziokulturellen Kontext. Es wird die individuelle Vielfalt der Erlebnisse betont, nicht repräsentative Ergebnisse angestrebt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen von Frauen auf der „Walz“ zu beleuchten und in einem soziokulturellen Kontext zu interpretieren. Die Arbeit fokussiert auf die individuelle Vielfalt der Erlebnisse und verzichtet auf repräsentative Ergebnisse.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Motivationen von Frauen zur Wanderschaft, den strukturellen Ausschluss von Frauen in der Tradition, die Außenwahrnehmung und Stereotype von Wandergesellinnen, geschlechtsspezifische Herausforderungen und Chancen der Wanderschaft sowie die Rolle der Frau in der Geschichte des Wandergesellinnentums.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlegendes zur historischen Wanderschaft, Quellen und Methoden, Wandergesellinnentum in heutiger Zeit, Frauen auf „Tippelei“ – Genderspezifische Aspekte der Wanderschaft und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit einem historischen Überblick und der Methodendiskussion, bevor die genderspezifischen Aspekte im Detail analysiert werden.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit beschreibt den Feldzugang, ethische Aspekte der Forschung, die Datenerhebung und -analyse sowie eine kritische Auseinandersetzung mit den Quellen und Methoden. Die Herausforderungen bei der Forschung in diesem traditionsreichen und teilweise geheimnisvollen Bereich werden hervorgehoben. Die Autorin begründet ihre Entscheidung für gendergerechte Sprache und reflektiert die Schwierigkeiten, objektive Daten in diesem Bereich zu erheben.
Welche historischen Aspekte werden behandelt?
Das Kapitel zur historischen Wanderschaft liefert einen kurzen Abriss, beginnend mit den Ursprüngen im 14. Jahrhundert. Es beleuchtet die Entwicklung von der notgedrungenen Arbeitssuche zu einem strukturierten Bestandteil der handwerklichen Ausbildung, die Entwicklung und den Wandel der Tradition, sowie die Rolle der Frau innerhalb dieses historischen Kontextes. Die Herausbildung von „Schächten“ und die Bedeutung der „Kluft“ werden thematisiert.
Welche gegenwärtigen Aspekte des Wandergesellinnentums werden beleuchtet?
Das Kapitel zum gegenwärtigen Wandergesellinnentum beschreibt die Regeln und Gepflogenheiten der „Walz“ oder „Tippelei“, die Bedeutung der Kluft und der speziellen Sprache der Wandergesellinnen. Die Regeln und Gepflogenheiten werden im Kontext der heutigen Gesellschaft beschrieben, wobei die Verschiedenartigkeit der Erfahrungen der Wandergesellinnen betont wird.
Welche genderspezifischen Aspekte werden im Detail untersucht?
Der Kern der Arbeit analysiert die Motivationen von Frauen zur Wanderschaft, den strukturellen Ausschluss von Frauen in der Vergangenheit und die Herausbildung einer „Invention of Tradition“. Es werden die Außenwahrnehmung und Stereotype von Wandergesellinnen beleuchtet und frauenspezifische Themen wie Hygiene und Verhütung während der Reise behandelt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist in der bereitgestellten Textvorlage nicht explizit zusammengefasst. Es wird empfohlen, den vollständigen Text zu lesen, um das Fazit zu erfahren.)
Wo kann ich den vollständigen Text finden?
(Die Quelle des vollständigen Texts ist nicht in der bereitgestellten Information enthalten.)
- Arbeit zitieren
- Julia Winschewski (Autor:in), 2020, Als Frau auf "Tippelei". Erfahrungen von Wandergesellinnen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1033796