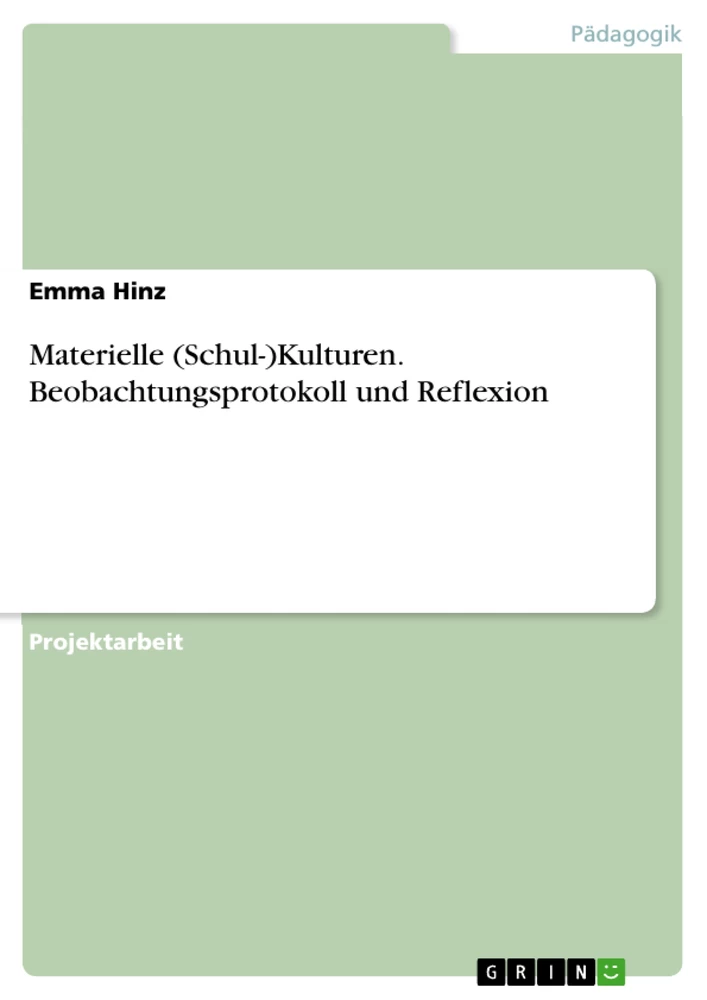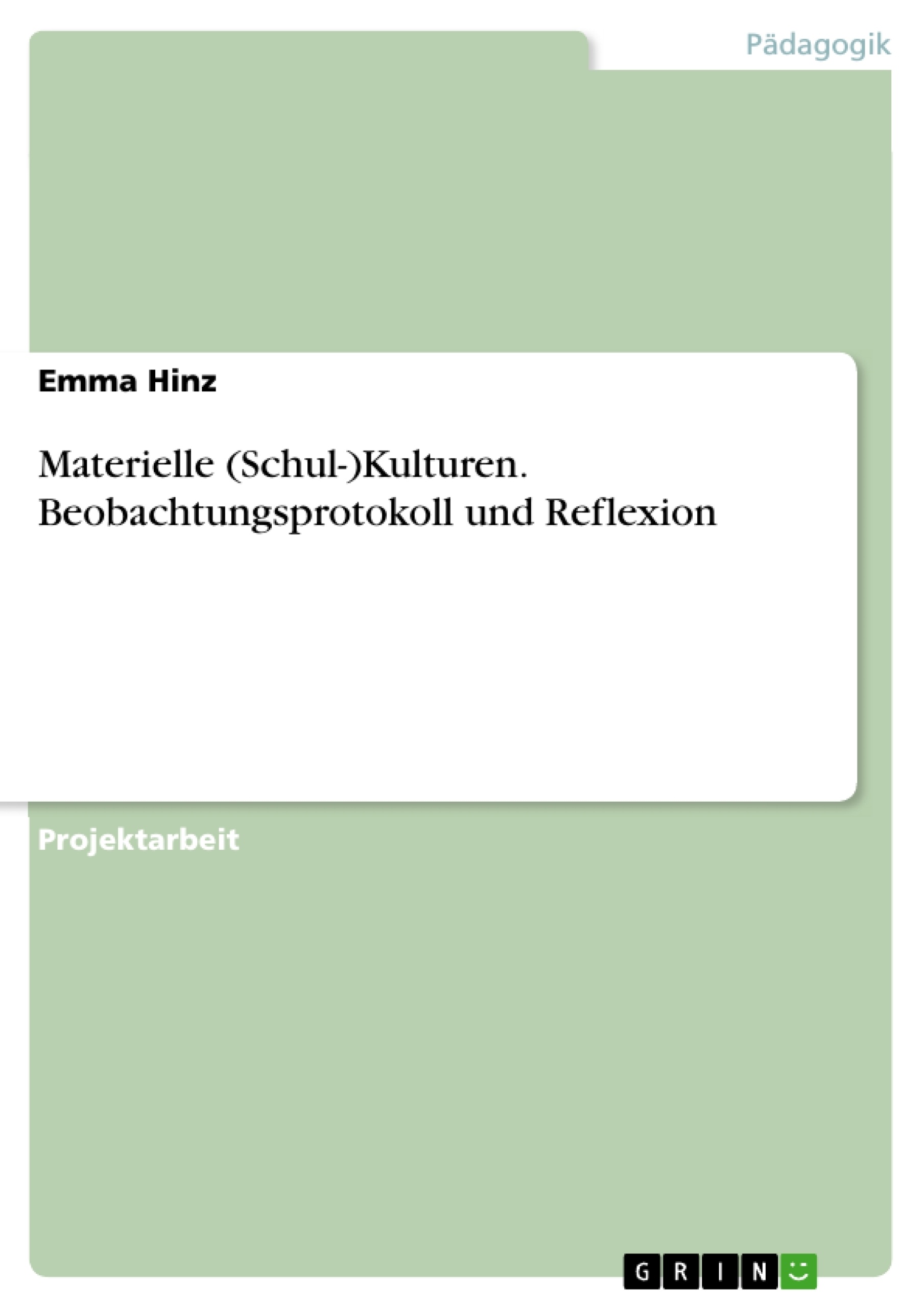Die Beobachtung ist ein wichtiger Aspekt der Ethnografie, welcher Menschen im alltäglichen Leben untersucht, um Eindrücke aus ihrer Lebenswelt zu bekommen. Aus den Beobachtungen können Deutungen und weitere Forschungsfragen entstehen. Dabei ist es wichtig, in der Beobachtung richtig zu notieren. Das bedeutet, es darf weder zu interpretativ sein, noch zu „leer“. Dies fiel mir ziemlich schwer, da es in der Natur des Menschen liegt, alles, was man sieht, auch direkt zu bewerten oder zu analysieren. Das Ziel der Ethnografie ist es, den Bezug der Handlung zum Leben zu verstehen und sich die Sicht der Welt vor Augen zu führen. Dies ist in der Beobachtung nicht immer leichtgefallen, doch die Erstellung der Codes konnte als Verfremdungsmittel eingesetzt werden. Das Kodieren hat ebenfalls dazu beigetragen, individuelle Verhaltensmuster zu verstehen und dann eben auch zu deuten. Ein besonderer Fokus wurde auf die materielle Kultur gesetzt, da es auch das Thema des Projektbandes ist. Dazu gehörten Artefakte und Objekte.
Inhaltsverzeichnis
- Beobachtungsprotokoll
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit dokumentiert und reflektiert eine teilnehmende Beobachtung in der Universitätsbibliothek Hildesheim. Ziel ist es, die Anwendung ethnografischer Methoden im Kontext des forschenden Lernens zu demonstrieren und die Bedeutung materieller Kultur für das Verständnis von Lernprozessen zu beleuchten.
- Methoden der teilnehmenden Beobachtung
- Bedeutung materieller Kultur im Lernprozess
- Reflexion des Beobachtungsprozesses und der Herausforderungen
- Analyse von Körpersprache und Artefakten
- Generierung von Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
Beobachtungsprotokoll: Das Beobachtungsprotokoll detailliert das Verhalten einer männlichen Person in der Universitätsbibliothek. Es beschreibt akribisch ihre Handlungen, wie das Arbeiten am Laptop, die Nutzung von Karteikarten, und die Interaktion mit verschiedenen Objekten (Laptop, Bücher, Mappe, Korb, Handy). Die Beschreibung beinhaltet auch die Reaktion der beobachteten Person auf die Anwesenheit der Beobachterin und deren sichtbare Konzentration und Verhalten, zum Beispiel das ständige Schauen in eine Mappe mit bunten Notizen, das Verwenden einer externen Maus und das gelegentliche Blicken auf das Handy. Die detaillierte Beschreibung dient als Grundlage für die anschließende Reflexion.
Reflexion: Die Reflexion analysiert den Beobachtungsprozess kritisch. Es werden die Herausforderungen bei der uninterpretierten und detaillierten Dokumentation des beobachteten Verhaltens erörtert, und der Prozess des Codierens als Verfremdungsmittel zur Objektivierung der Beobachtung beschrieben. Die Autorin reflektiert ihre eigene Teilnahme an der Beobachtungssituation und die entstehenden Probleme, wie die Reaktion der beobachteten Person und die Herausforderungen bei der gleichzeitigen Wahrnehmung verschiedener Ereignisse. Der Text beschreibt auch den Prozess des "going native" und "coming home". Die Autorin analysiert die Bedeutung materieller Kultur, wie der roten Mappe oder des Laptops, für das Verständnis von Lernprozessen und generiert weitere Forschungsfragen zur Bedeutung von Körpersprache und Körperlichkeit beim Lernen. Schließlich wird die Bedeutung von Dingen und deren Kontextualisierung für die Interpretation und das Verständnis gesellschaftlicher Ordnung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Teilnehmende Beobachtung, Ethnografie, Materielle Kultur, Lernprozess, Körpersprache, Artefakte, Reflexion, Forschungsfragen, Universtätsbibliothek, Kodierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Teilnehmende Beobachtung in der Universitätsbibliothek Hildesheim
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit dokumentiert und reflektiert eine teilnehmende Beobachtung in der Universitätsbibliothek Hildesheim. Der Fokus liegt auf der Anwendung ethnografischer Methoden im Kontext des forschenden Lernens und der Bedeutung materieller Kultur für das Verständnis von Lernprozessen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer teilnehmenden Beobachtung einer Person in der Universitätsbibliothek. Das beobachtete Verhalten wurde detailliert protokolliert und anschließend reflektiert. Die Analyse umfasst die Interpretation von Körpersprache und der Bedeutung von Artefakten (Laptop, Bücher, Mappe etc.) im Lernprozess.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Methoden der teilnehmenden Beobachtung, die Bedeutung materieller Kultur im Lernprozess, Reflexion des Beobachtungsprozesses und der Herausforderungen, Analyse von Körpersprache und Artefakten sowie die Generierung von Forschungsfragen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einem Beobachtungsprotokoll und einer Reflexion. Das Beobachtungsprotokoll beschreibt detailliert das Verhalten der beobachteten Person. Die Reflexion analysiert den Beobachtungsprozess kritisch, beleuchtet die Herausforderungen der Dokumentation und interpretiert die Bedeutung der beobachteten Handlungen und Artefakte im Kontext des Lernens.
Was wird im Beobachtungsprotokoll beschrieben?
Das Beobachtungsprotokoll beschreibt akribisch das Verhalten einer männlichen Person in der Universitätsbibliothek, inklusive ihrer Interaktion mit verschiedenen Objekten (Laptop, Bücher, Mappe, Korb, Handy) und ihrer Reaktion auf die Anwesenheit der Beobachterin. Es beinhaltet detaillierte Beschreibungen von Handlungen wie Arbeiten am Laptop, Nutzung von Karteikarten und Körpersprache.
Worüber wird in der Reflexion berichtet?
Die Reflexion analysiert den Beobachtungsprozess kritisch, erörtert die Herausforderungen der uninterpretierten Dokumentation und den Prozess des Codierens. Die Autorin reflektiert ihre eigene Teilnahme an der Beobachtungssituation und die entstehenden Probleme. Sie analysiert die Bedeutung materieller Kultur für das Verständnis von Lernprozessen und generiert weitere Forschungsfragen. Der Prozess des "going native" und "coming home" wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Teilnehmende Beobachtung, Ethnografie, Materielle Kultur, Lernprozess, Körpersprache, Artefakte, Reflexion, Forschungsfragen, Universitätsbibliothek, Kodierung.
Welche Forschungsfragen werden generiert?
Die Arbeit generiert Forschungsfragen zur Bedeutung von Körpersprache und Körperlichkeit beim Lernen und zur Bedeutung von Dingen und deren Kontextualisierung für die Interpretation und das Verständnis gesellschaftlicher Ordnung.
- Arbeit zitieren
- Emma Hinz (Autor:in), 2020, Materielle (Schul-)Kulturen. Beobachtungsprotokoll und Reflexion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1035657