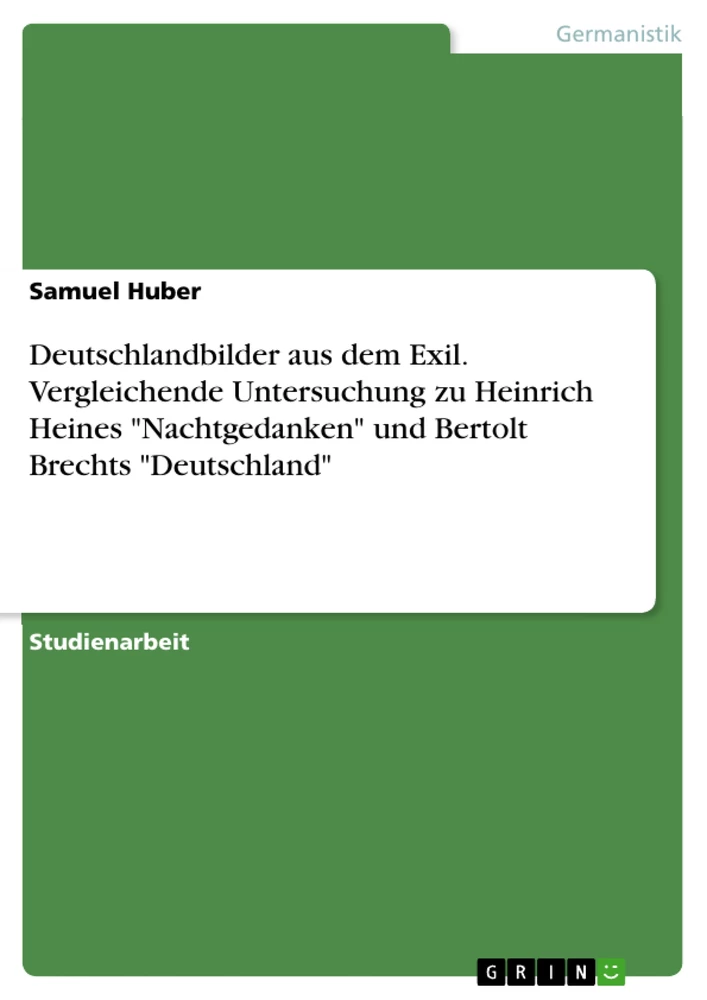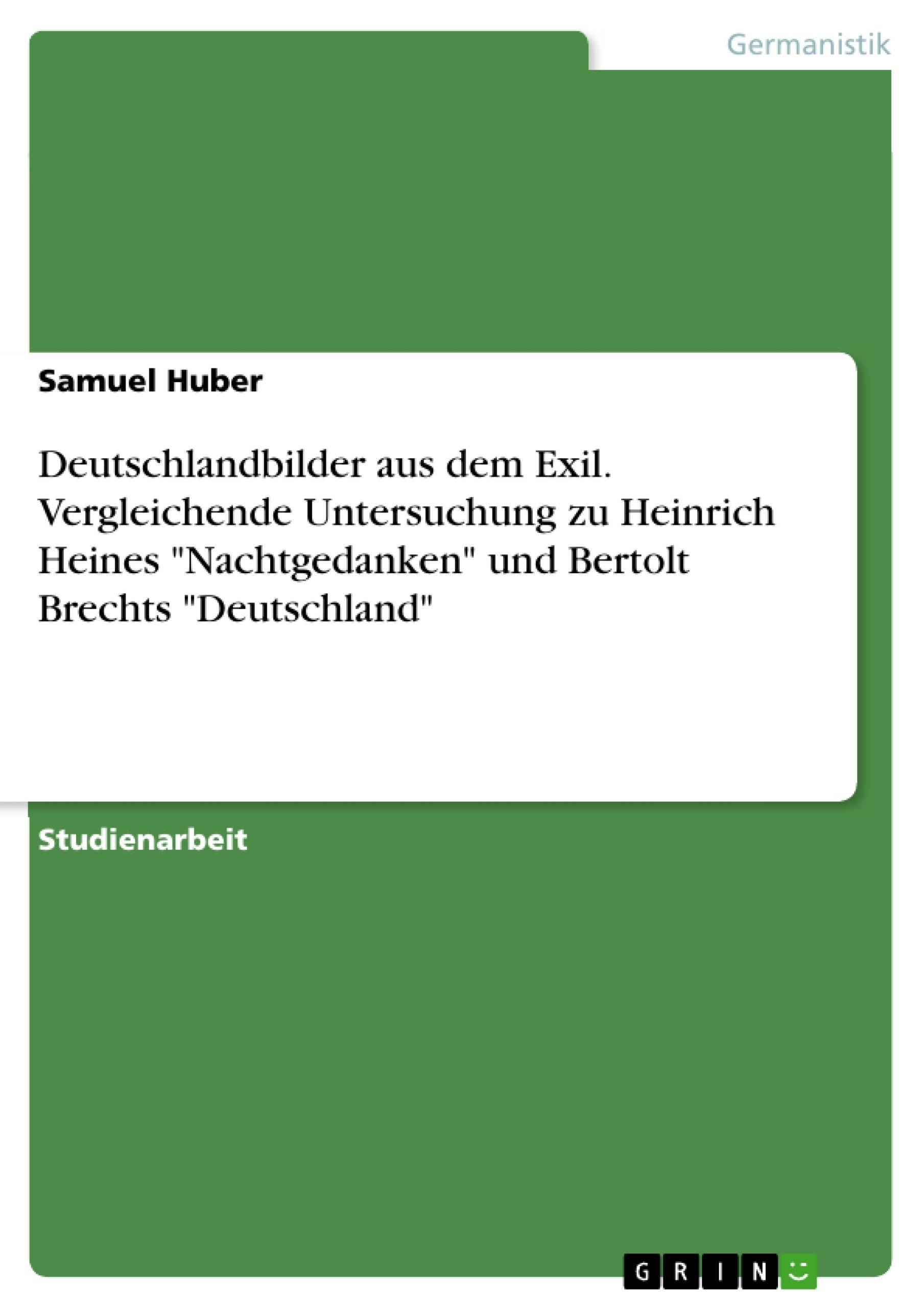In der vorliegenden Arbeit sollen zwei Gedichte, Heines "Nachtgedanken" und Brechts "Deutschland", zum Untersuchungsgegenstand gemacht werden. Ziel der vergleichenden Darstellung wird – in enger Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur – eine Gegenüberstellung der in den Gedichten entworfenen Deutschlandbilder sein, die Parallelen und Gegensätze herausstellt und gleichsam nach deren Ursachen fragt. Dabei soll einerseits aspektorientiert vorgegangen, andererseits dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die von Hermand beschriebene Verknüpfung verschiedenster Topoi kaum isolierte Einzelbetrachtungen zulässt. Die Frage nach den Wirkungsstrategien von Ironie und dramatischer Bildlichkeit in den Darstellungen Deutschlands wird daher an das politische und ideologische Programm der Dichter gekoppelt sein, während die Bildlichkeit der Gender-Thematik stets im Hinblick auf den Konflikt zwischen Nation und nationaler Identität als Teil der politischen Dimension der Gedichte untersucht werden muss.
Der Leitgedanke, der dem Exil als Entstehungssituation besondere Prägekraft bei der Konstruktion der Deutschlandbilder
attestiert, soll dabei weder eine Gleichartigkeit der Exilerfahrungen Heines und Brechts suggerieren, noch den zeitlichen Abstand der Gedichte und ihrer historischen Ausgangsbedingungen unterminieren, sondern zuletzt Hilfestellung leisten, wenn es darum geht, ein Nachdenken über Deutschland zu rekonstruieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Nachtgedanken
- 2.2 Deutschland
- 3. Vergleich
- 3.1 Das Exil als Entstehungssituation
- 3.2 Wirkungsstrategien von Ironie und dramatischer Bildlichkeit
- 3.3 Mutter und Vaterland - Gender, Nation und nationale Identität
- 4. Schluss
- 5. Literaturverzeichnis
- 5.1 Primärliteratur
- 5.2 Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Deutschlandbilder in Heinrich Heines "Nachtgedanken" und Bertolt Brechts "Deutschland" (1933) im Kontext des Exils. Ziel ist es, Parallelen und Gegensätze in den von den Dichtern entworfenen Bildern herauszuarbeiten und deren Ursachen zu beleuchten. Dabei wird die Entstehungssituation des Exils, die Wirkungsstrategien von Ironie und Bildlichkeit sowie die Genderthematik im Spannungsfeld von Nation und nationaler Identität betrachtet.
- Deutschlandbilder im Exil
- Wirkungsstrategien von Ironie und dramatischer Bildlichkeit
- Gender, Nation und nationale Identität
- Exil als Entstehungssituation
- Vergleichende Analyse von Heines "Nachtgedanken" und Brechts "Deutschland"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Kontext des Exils als produktivem Nährboden politischer Lyrik. Sie stellt die beiden Dichter Heine und Brecht im Kontext der Forschung vor und skizziert den Ansatz der Arbeit, der auf einem Vergleich der beiden Gedichte "Nachtgedanken" und "Deutschland" basiert.
Das Kapitel "Grundlagen" widmet sich zunächst Heines "Nachtgedanken" und beleuchtet dessen Popularität sowie die vielschichtigen Deutungen, die das Gedicht in der Forschung erfahren hat.
Schlüsselwörter
Deutschlandbilder, Exil, politische Lyrik, Heinrich Heine, Bertolt Brecht, "Nachtgedanken", "Deutschland", Ironie, dramatische Bildlichkeit, Gender, Nation, nationale Identität, Vergleichende Analyse, Forschungsliteratur.
- Citar trabajo
- Samuel Huber (Autor), 2021, Deutschlandbilder aus dem Exil. Vergleichende Untersuchung zu Heinrich Heines "Nachtgedanken" und Bertolt Brechts "Deutschland", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1036022