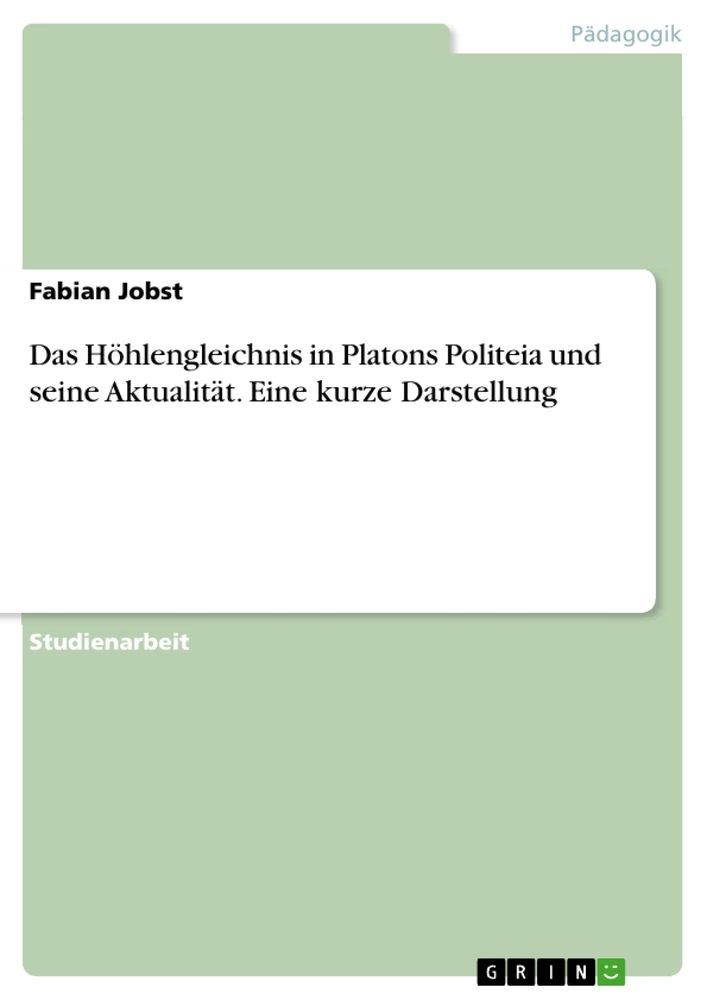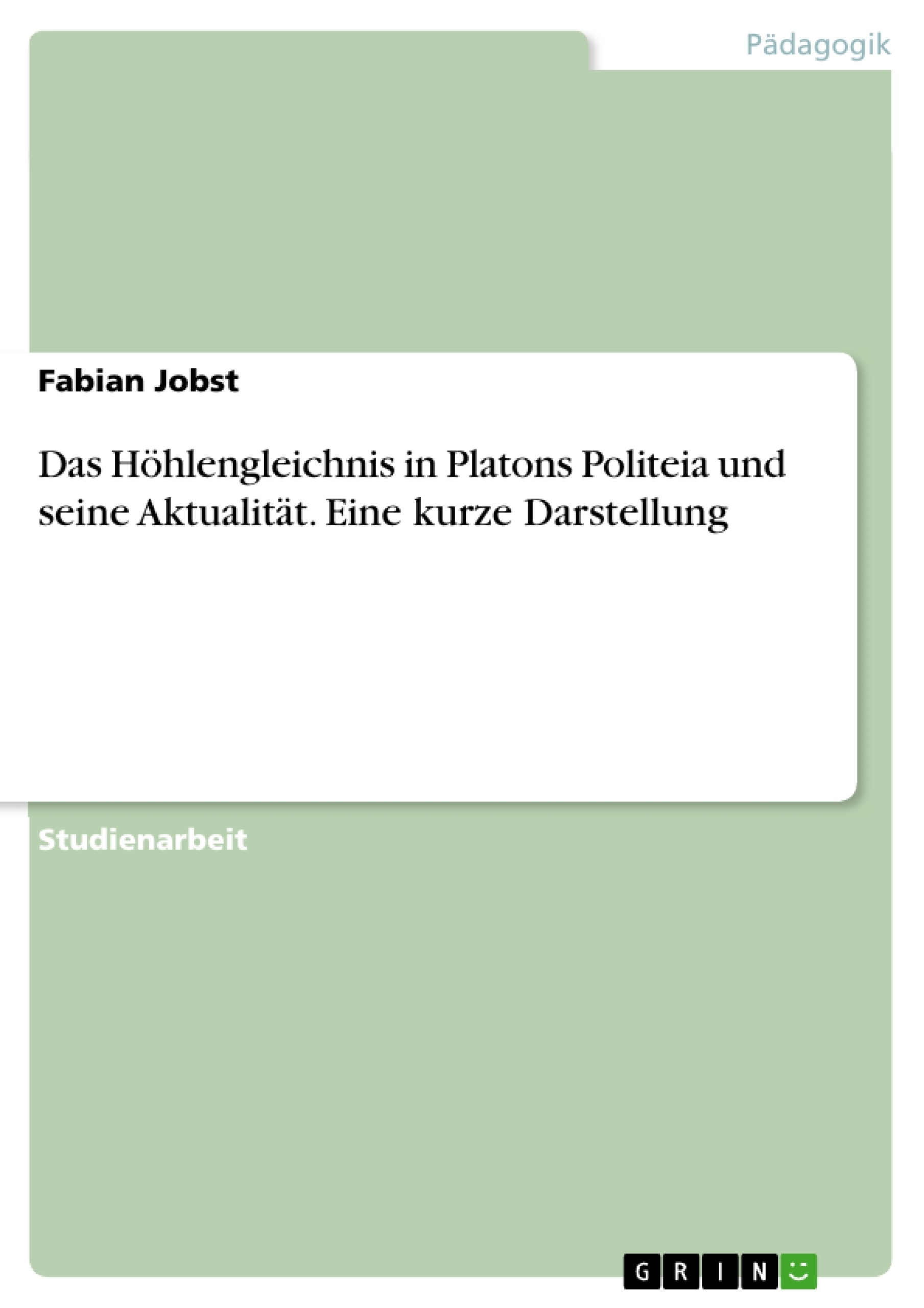Diese Arbeit ist ein kurzer Aufriss der drei bekannten Gleichnisse des griechischen Philosophen Platon geleistet. Seine Ideen werden anschließend in Zusammenhang zur aktuellen Zeit gebracht.
In dem dramaturgisch und in zehn Bücher aufgebauten fiktiven Gespräch des Sokrates (Platons Lehrer) wird unter anderem dieser Aspekt thematisiert. Bevor sich Sokrates allerdings auf die Makroebene (Staat) bezieht, wird zunächst die Mikroebene, das Individuum, angesprochen.
In seinem Bericht über den vorangegangenen Austausch mit Kephalos, Polemarchos und Thrasymachos (im als Proömium fungiernden Buch I) zeigt der Erzähler dem Zuhörer auf, welch unterschiedliche Ansichten jeder einzelne zum Thema Gerechtigkeit hat. Kephalos definiert Gerechtigkeit als Ehrlichkeit, also sowohl die Wahrheit kundzutun, als auch eines anderen Eigentum zu respektieren. Damit drückt er, wie später von Platon noch kritisch abzuwerten sein wird, aus, dass eigener Besitz keine negativen Auswirkungen auf Gerechtigkeit hat.
Sokrates versteht sich diese Annahme ebenso zu falsifizieren, wie die des Polemarchos. Dieser unterscheidet demnach zwischen Freund und Feind und erörtert, dass man Freunden nichts Schlechtes sondern Gutes, den Feinden allerdings tatsächlich Schlechtes tun soll.
Die im Folgenden angeführte These des Thrasymachos, der die Gerechtigkeit als das definiert, was den Herrschenden zum Vorteil dient, wird durch den radikaleren Gedanken des Kleitophon ergänzt, der Gerechtigkeit als das alles definiert, was der Machthaber will.
Sokrates schafft es auch hier, Argumente gegen diese Thesen zu finden und belegt diese mit Beispielen, sodass sich seine „Gegner“ gewissermaßen geschlagen geben. Der eigentliche Grund, diese verschiedenen Positionen anzuführen, ist die in den nachfolgenden Büchern durchgeführte Ausweitung des Gerechtigkeits-Begriffes auf den Staat.
Platon entwirft in diesen einen aus seiner Sicht begründeten Idealstaat, den er im Folgenden anhand vieler Kriterien zu definieren versucht, in ständiger Bezugnahme zu den Eigenschaften der Seele des Individuums. Auf den fundamentalsten Säulen - den Grundtugenden - lassen sich die drei von Platon eingeführten Gesellschaftsschichten gründen. Die unterste Stufe stellen die Ökonomen dar, die die Tugend der Besonnenheit vor allem vor dem Hintergrund des uneigennützigen Handelns vertreten sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Bedeutung der im Proömium diskutierten Gerechtigkeit
- Begründung der Besitzregelung als zentrales Kriterium für Gerechtigkeit
- Die drei platonischen Gleichnisse aus neuzeitlicher Perspektive
- Platons Überlegungen zur Idee des Guten
- Die Idee im Sonnengleichnis
- Die vier Erkenntnisstufen im Liniengleichnis
- Die Grundbedingung für vernünftiges bzw. vernunftgeleitetes Handeln: Das Höhlengleichnis
- Seine Aktualität in der multimedialen Welt des 21. Jahrhunderts
- Ausgewählte Positionen in der (modernen) Bildungstheorie
- Das Wesen der Begriffe nach Aristoteles - eine Gegenüberstellung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Platons Konzeption von Gerechtigkeit im Idealstaat und untersucht dabei insbesondere die Rolle der Besitzregelung und die Bedeutung der platonischen Gleichnisse, insbesondere des Höhlengleichnisses, für ein vernunftgeleitetes Handeln.
- Platons Idealstaat und seine Hierarchisierung
- Die Bedeutung von Gerechtigkeit und Vernunft
- Die Rolle der Besitzregelung in Platons Staatsmodell
- Platons Gleichnisse: Sonne, Linie und Höhle
- Die Aktualität der platonischen Philosophie in der modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Bedeutung der im Proömium diskutierten Gerechtigkeit
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Positionen zum Thema Gerechtigkeit, die in Platons Proömium zur Sprache kommen. Der Text beleuchtet die Ansichten von Kephalos, Polemarchos und Thrasymachos und analysiert, wie Sokrates auf diese Positionen reagiert. Abschließend wird auf die Bedeutung der Gerechtigkeit im Idealstaat Platons eingegangen.
2. Begründung der Besitzregelung als zentrales Kriterium für Gerechtigkeit
Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Besitzregelung im Idealstaat Platons. Der Text untersucht, warum Platon besitzlose Regenten vorschlägt und wie die Besitzregelung zum Erhalt des Staates beitragen soll. Die Analyse stützt sich auf verschiedene sekundärliterarische Positionen, insbesondere auf die Ansichten von Schriefl und Otto.
3. Die drei platonischen Gleichnisse aus neuzeitlicher Perspektive
Dieses Kapitel widmet sich den platonischen Gleichnissen, insbesondere dem Sonnengleichnis, dem Liniengleichnis und dem Höhlengleichnis. Der Text analysiert Platons Überlegungen zur Idee des Guten und erläutert die Bedeutung der Gleichnisse für die Entwicklung eines vernunftgeleiteten Handelns. Das Kapitel befasst sich auch mit der Aktualität des Höhlengleichnisses im Kontext der multimedialen Welt des 21. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Der Text beschäftigt sich mit zentralen Themen der platonischen Philosophie, darunter Gerechtigkeit, Idealstaat, Besitzregelung, Vernunft, Bildung, Dialektik, Gleichnisse, Höhlengleichnis, und die Aktualität platonischer Gedanken in der modernen Welt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Platons Höhlengleichnis?
Das Höhlengleichnis beschreibt den mühsamen Weg der Erkenntnis von der Wahrnehmung bloßer Schattenbilder hin zur Schau der wahren Ideen und der Sonne als Symbol für das Gute.
Wie aktuell ist das Höhlengleichnis im 21. Jahrhundert?
Die Arbeit setzt das Gleichnis in Bezug zur heutigen multimedialen Welt und untersucht, inwiefern wir auch heute noch durch mediale „Schattenbilder“ von der Realität abgelenkt werden.
Wie definiert Platon Gerechtigkeit in seinem Idealstaat?
Gerechtigkeit bedeutet für Platon, dass jeder Stand im Staat (Lehrstand, Wehrstand, Nährstand) die ihm gemäße Aufgabe erfüllt und die Grundtugenden wie Besonnenheit und Vernunft walten.
Warum fordert Platon eine spezielle Besitzregelung für Herrscher?
Um Korruption zu vermeiden und sicherzustellen, dass Regenten ausschließlich dem Gemeinwohl dienen, schlägt Platon vor, dass die Wächterklasse keinen Privatbesitz haben sollte.
Welche drei Gleichnisse werden in der Politeia unterschieden?
Es handelt sich um das Sonnengleichnis (Idee des Guten), das Liniengleichnis (Erkenntnisstufen) und das Höhlengleichnis (Bildungsprozess).
Wie unterscheidet sich Platons Ideenlehre von Aristoteles' Ansichten?
Die Arbeit bietet eine Gegenüberstellung zum Wesen der Begriffe nach Aristoteles, der Platons transzendente Ideenwelt kritisch betrachtete.
- Quote paper
- Fabian Jobst (Author), 2020, Das Höhlengleichnis in Platons Politeia und seine Aktualität. Eine kurze Darstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1037258