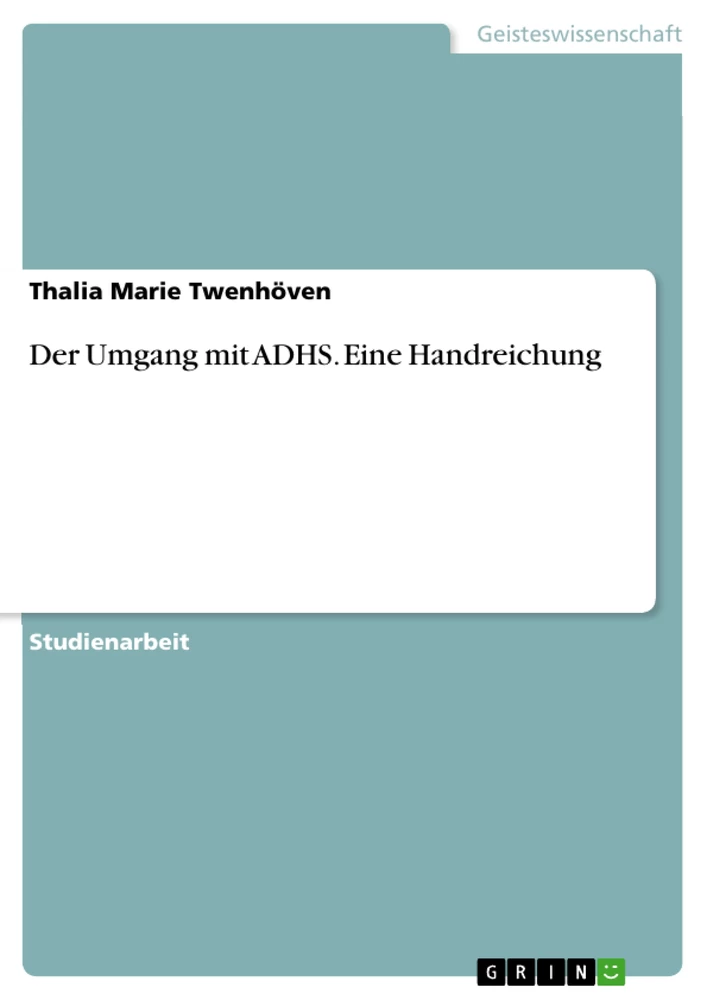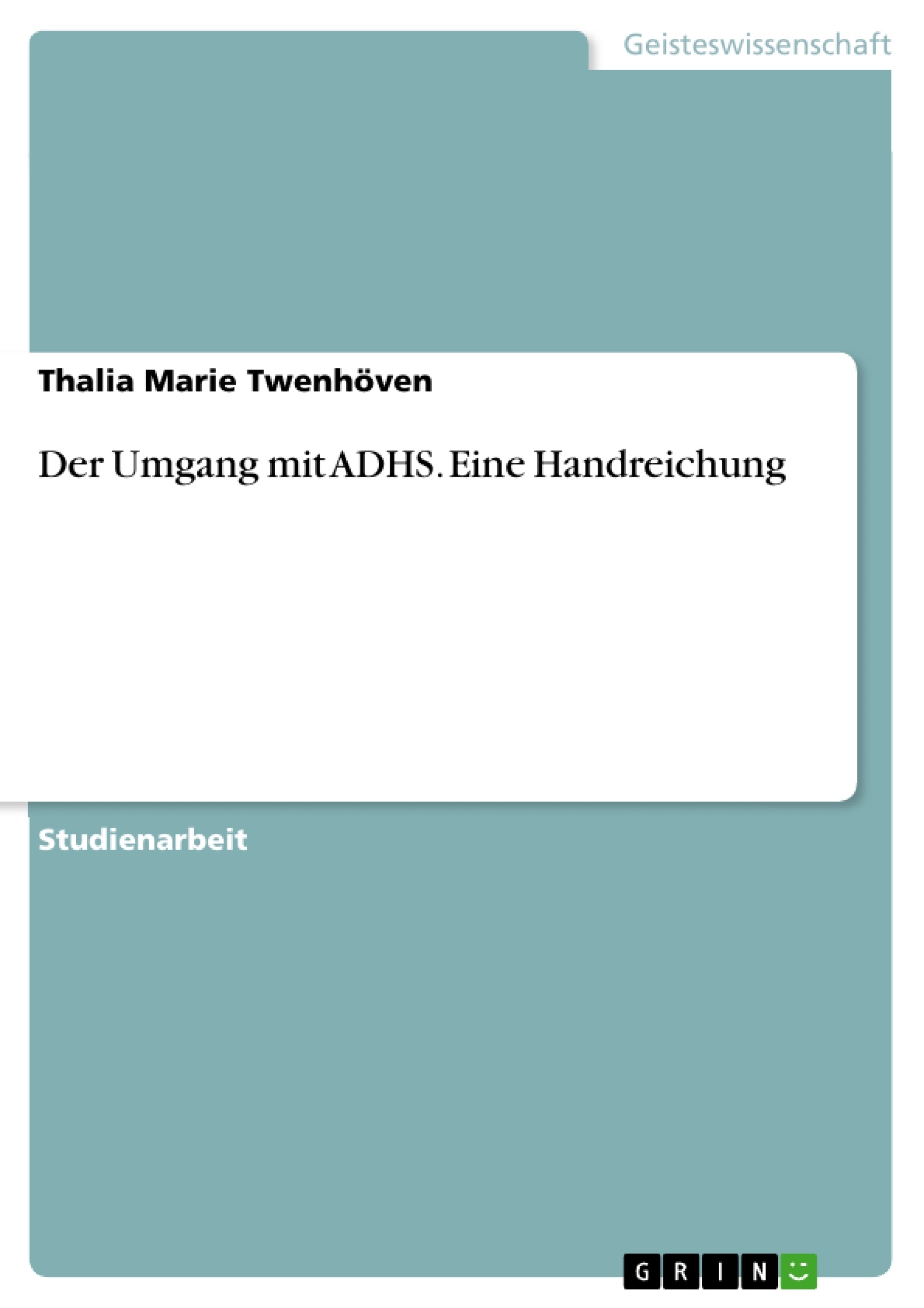In der vorliegenden Arbeit mit dem Titel "Handreichung zum Umgang mit ADHS" geht es um die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Sie ist als eine Art Handreichung für Lehrpersonen konzipiert, um mit Schülern und Schülerinnen, die ADHS aufweisen, korrekt umgehen zu können.
Dabei wird die Pathogenese inklusive Symptomatik dargestellt. Weiter wird erläutert, weshalb ADHS relevant ist. Anschließend wird ein Diagnoseverfahren und eine Fördermaßnahme vorgestellt, die Lehrkräfte anwenden können.
Vielen Menschen ist bewusst, dass es sich bei ADHS um eine Verhaltensstörung handelt, doch nicht alle weisen ein tiefergehendes Wissen auf und pflegen den richtigen Umgang dahingehend. In der folgenden Handreichung wird auf die Auffälligkeit genauer eingegangen, um besonders den Umgang mit der Auffälligkeit zu thematisieren, wobei als Zielgruppe vor allem Lehrkräfte angesprochen werden. Aus diesem Grund fokussiert die vorliegende Arbeit überwiegend ADHS bei Kindern.
Zum Einstieg in das Thema erfolgt eine Begriffsdefinition, indem die Symptome von sowie die Stärken ADHS fokussiert werden. Im nächsten Schritt wird die Pathogenese dargelegt und anschließend die Relevanz der Auffälligkeit erläutert. Bezogen auf den Umgang mit ADHS wird ein Diagnoseverfahren vorgestellt, sowie Fördermaßnahmen inklusive Handlungsmaßnahmen für Lehrkräfte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinition
- 2.1 Symptomatik
- 2.2 Stärken
- 3 Pathogenese
- 4 Zur Relevanz von ADHS
- 5 Vorstellung eines Diagnoseverfahrens
- 6 Konkrete Fördermaßnahmen
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Handreichung soll Lehrkräfte im Umgang mit ADHS bei Kindern unterstützen und ein tiefergehendes Verständnis für die Störung fördern. Sie zielt darauf ab, die Symptome und Stärken von ADHS zu erläutern, die Pathogenese aufzuzeigen, die Relevanz der Störung zu beleuchten und konkrete Diagnoseverfahren sowie Fördermaßnahmen vorzustellen.
- Symptome und Stärken von ADHS
- Pathogenese von ADHS
- Relevanz von ADHS für Lehrkräfte
- Diagnoseverfahren für ADHS
- Konkrete Fördermaßnahmen für Kinder mit ADHS
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Der Text führt in die Thematik von ADHS ein und erläutert die Relevanz der Störung für den schulischen Kontext. Er hebt die Bedeutung des richtigen Umgangs mit ADHS im Bildungsbereich hervor, vor allem für Lehrkräfte.
2 Begriffsdefinition
Dieses Kapitel definiert den Begriff ADHS und erklärt seine Symptome, die sich in Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefiziten und Impulsivität äußern. Es werden die beiden Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV sowie deren Kriterien für die Diagnose von ADHS vorgestellt. Zudem werden sekundäre Symptome wie eine geringe Frustrationstoleranz und Schlafprobleme erwähnt.
2.1 Symptomatik
Dieses Unterkapitel beschreibt die Kernsymptome von ADHS im Detail und erläutert, wie sich diese auf die Lebensbereiche der Betroffenen auswirken. Es wird die Bedeutung der fortlaufenden und situationsübergreifenden Präsenz der Symptome sowie deren Einfluss auf die psychosoziale und kognitive Funktionsfähigkeit der Betroffenen betont.
2.2 Stärken
Hier wird die positive Seite von ADHS beleuchtet und es werden die Stärken, die Kinder mit ADHS aufweisen können, hervorgehoben. So können sie spontan, kreativ, neugierig und reaktionsstark sein sowie verbale und kommunikative Stärken besitzen. Es wird betont, wie wichtig es ist, die Kompetenzen und Stärken von Kindern mit ADHS zu erkennen und zu fördern.
3 Pathogenese
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Ursachen von ADHS. Es wird auf die Konnexion zwischen psychosozialen und biologischen Faktoren hingewiesen und die Bedeutsamkeit biologischer Faktoren, insbesondere der Dysfunktion des kortikalen-striatalen Netzwerkes, hervorgehoben.
Schlüsselwörter
ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizite, Impulsivität, ICD-10, DSM-IV, Diagnoseverfahren, Fördermaßnahmen, Stärken, Pathogenese, Neurobiologie, kortikales-striatales Netzwerk, Lehrkräfte, Schule, Unterricht.
- Quote paper
- Thalia Marie Twenhöven (Author), 2021, Der Umgang mit ADHS. Eine Handreichung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1037290