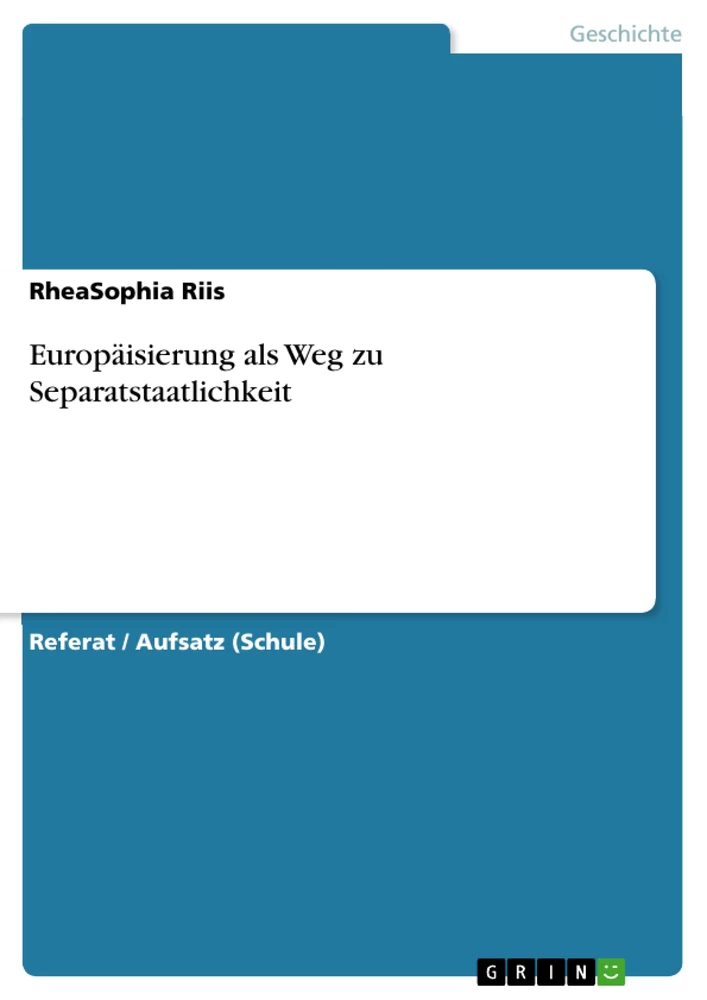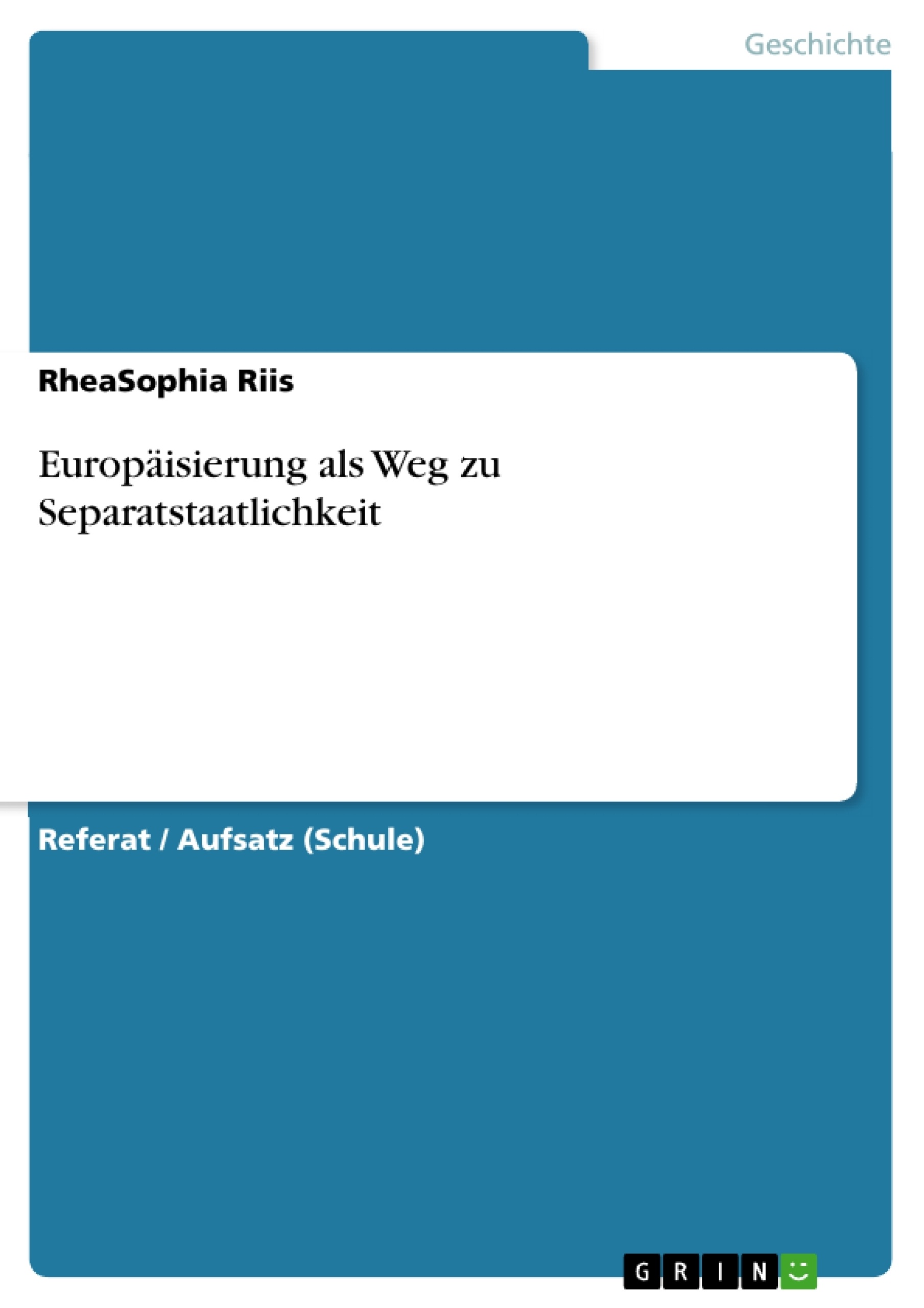Europaisierung als Weg zu Separatstaatlichkeit
Konrad Adenauers Politik hat als vorrangiges Ziel „die nationale und staatliche Einheit des deutschen Volkes“ zu wahren und „als gleichberechtigtes Mitglied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen“. -Getreu den Worten, die im Grundgesetz formuliert sind. Adenauer sieht es als seine Aufgabe, das Vertrauen der Alliierten wiederzuerlangen und Deutschland vom Status eines besetzten Landes, welchem allenfalls die Aufgabe eines Prellbocks gegenüber dem Osten zukommt, zu einem gleichberechtigten Partner der Weststaaten zu machen. Zudem fürchtet Adenauer nichts so sehr, wie einen Rückfall Deutschlands in jene Mittelrolle zwischen Ost und West, die nach seiner Überzeugung erneut in die Katastrophe führen würde- deswegen setzt er hartnäckig auf den Westen und ebenso auf den Weg der westlichen Demokratie.
Die oberste Gewalt des Nachkriegsdeutschland liegt vollkommen bei den Alliierten. Verbote und Einschränkungen kennzeichnen nicht nur das alltägliche Leben, sondern auch die Industrie, die Wissenschaft und Forschung sowie sämtliche auswärtigen Angelegenheiten.
Schritt für Schritt möchte Adenauer die Freiheit des deutschen Volkes erkämpfen.
Ein erster Beitrag hierzu ist das sogenannte „Petersberger Abkommen“, das am 22. November 1949 von den Verhandlungspartnern der USA, Groß-Britanniens, Frankreichs und Deutschlands unterzeichnet wird. Hier wird der Beitritt der Bundesrepublik zum Europarat und zur Ruhrbehörde festgelegt, mit dem Saargebiet als eigenständigem Mitglied. Dies ist der erste Schritt Deutschland zu einer Zusammenarbeit mit den westeuropäischen Ländern zu führen und als friedliebendes Mitglied in die europäische Gemeinschaft zu integrieren. Durch das Petersberger Abkommen wird der Austausch von Handels- und Konsularvertretungen mit anderen Ländern gefördert.
Erste Anzeichen des Widerstands der Opposition, der SPD, zeigen sich, als Kurt Schuhmacher von einem „Bundeskanzler der Alliierten“ spricht. Hiermit trennen sich die Wege der Regierungskoalition und der Opposition. Dieser Weg scheint eine deutsche Einigung zu erschweren und zudem verpflichtet sich die Bundesrepublik die Entmilitarisierung des Bundesgebiets aufrechtzuerhalten und jede Neubildung von Streitkräften zu unterbinden.
Den zweiten Schritt zu einem freien Deutschland unternimmt Adenauer indem er erreicht, daß auf der Außenministerkonferenz vom September 1950 die Bundesregierung als die einzige freie und gesetzlich konstituierte deutsche Regierung anerkannt wird und als Repräsentant für das deutsche Volk von ganz Deutschland sprechen kann. Gleichzeitig wird eine Sicherheitsgarantie gegenüber etwaigen Angriffen aus dem Osten gewährt. Weiterhin treten im März 1951 erhebliche Revisionen des Besatzungsstatuts in Kraft; die Bundesregierung kann ein Außenministerium einrichten und erstmals wieder diplomatische Beziehungen zu den Nachbarstaaten aufnehmen.
Im Juli 1951 erklären die drei Westmächte USA, Groß-Britannien und Frankreich den Kriegszustand mit Deutschland als beendet. Die restlichen Klauseln des Besatzungsstatuts werden durch ein System von Verträgen abgelöst. Am 26. Mai 1952 wird feierlich der „Deutschlandvertrag“ abgeschlossen. Der Deutschlandvertrag ist ein ungemeiner Erfolg auf dem Weg zu einer selbstbestimmten Republik und löst Deutschland aus seiner Isolierung. Als gemeinsame Ziele der Unterzeichnenden werden die Eingliederung der Bundesrepublik in die freie Welt auf der Grundlage der Gleichberechtigung und die Wiederherstellung eines völlig freien und vereinigten Deutschlands auf friedlichem Wege verkündet.
Mit dem Abschluß des DV wird die Bundesrepublik Vorkämpferin eines europäischen Bündnisses.
Einen Tag nach der Unterzeichnung des DV wird der Vertrag über die „Europäische Verteidigungsgemeinschaft“ (EVG) von den Vertretern Belgiens, Luxemburgs, den Niederlanden, Frankreichs, Italiens und der Bundesrepublik unterzeichnet. Von dem Franzosen René Pleven ins Leben gerufen ist dies das Projekt einer europäischen Armee. Man braucht ebenfalls den Verteidigungsbeitrag Deutschlands, da dies nur eine Verstärkung in der Verteidigung Europas darstellen würde. Der defensive Charakter des Nordatlantikpakts bleibt von diesen Vorgängen unberührt.
Weiterhin ist der DV durch ein Junktim mit dem EVG-Vertrag verbunden. Dadurch, daß Deutschland in ein Sicherheitssystem, bestehend aus der Mitgliedschaft in der EVG und deren Abkommen mit der NATO, eingefügt ist, würde ihm der Beistand einer mächtigen, weltumspannenden Organisation im Falle eines Angriffs auf ihr Gebiet sicher sein. Deutschland ist somit endgültig aus der Prellbock-Rolle in die eines eigenständigen Subjekts in der internationalen Politik gerückt, wenngleich es immer noch zwischen den Fronten liegt.
Adenauer versucht stets durch ein deutsch-alliiertes Vertragswerk eine Mitverantwortung und somit Mitbestimmung in der internationalen Politik zu erreichen.
Das bisher erreichte muß nun noch durch eine Ratifizierung der Verträge gefestigt werden. Doch auch hier entstehen neuerliche Spannungen zwischen der Regierungskoalition und der Opposition im Bundestag.
Die Durchführung der Verträge ist für Adenauer von entscheidender Bedeutung für eine Eingliederung Deutschlands in den freien Westen. Die SPD wiederum verurteilt Adenauers ablehnende Haltung gegenüber Verhandlungen mit der UdSSR, da sie darin eine Chance für eine Wiedervereinigung Deutschlands sieht. Adenauer hingegen hält die sowjetischen Annäherungen nur für ein Störmanöver in seiner Westpolitik und möchte andererseits nicht durch positive Äußerungen das Mißtrauen der Westmächte erregen. Zudem fürchtet Adenauer in den sowjetischen Vorschlägen zur Einigung ein Abrutschen in den eisernen Vorhang, da das geeinigte Deutschland unter dem Diktat der UdSSR zustande kommen würde. Ein weiteres wesentliches Argument der SPD gegen den Eintritt in die EVG ist, daß im Grundgesetz eine Aufstellung bewaffneter Streitkräfte nicht vorgesehen war. Dies rüttelt an den Pfeilern der staatlichen Ordnung, da es verfassungswidrig ist. Diese Erklärungen der SPD, daß die Verträge verfassungswidrig seien rufen im Ausland große Verwirrungen hervor und schwächen das Vertrauen gegenüber der Bundesrepublik. Der amerikanische Senat hat den DV als erster der beteiligten Staaten ratifiziert, kurz darauf folgen die Briten. Von den drei Westmächte fehlt nun nur noch Frankreich, daß aber der Nationalversammlung die Verträge erst vorlegen würde, wenn sie den Bundestag passiert hätten. Ebenfalls wirft die Opposition Adenauer vor, daß der Besatzungsstatus nur scheinbar beseitigt wird. Sie forderte erneute Verhandlungen und Arbeitsgemeinschaften auf internationaler Basis. Adenauer argumentiert damit, daß eine Verneinung der Verträge einer Verneinung Europas gleichkäme und die Gefahr bestünde, daß in einem Spannungsherd zwischen Ost und West, wie es Deutschland einer sei, politisch angesetzt würde, ohne, daß Deutschland ein Mitspracherecht hätte, wie es ihm in den Verträgen zugesichert würde. Am 15. Mai 1953 stimmt der Bundestag schließlich über die Verträge ab und billigt sie mit einer Mehrheit von 27 gegen 15 Stimmen.
Die Politik Adenauers für ein vereintes Europa, in dem ein freies Deutschland eine Rolle spielt, die seinen Grundsätzen entspricht, sowie ein fester Anschluß an den Westen statt einer Neutralisierung Deutschlands, kennzeichnen den Wahlkampf 1953 aus dem er mit seiner Regierungskoalition am 6 September mit einer absoluten Mehrheit hervorgeht.
Doch die Verzögerung der Ratifizieren der Verträge hat Konsequenzen: In Frankreich gibt die lange Diskussion innerhalb der Bundesrepublik den Gegnern der Verträge starken Auftrieb. Im Juni 1954 wird infolge eines Regierungswechsels Mendès-France als französischer Ministerpräsident gewählt. Für ihn ist die Ratifizierung der Verträge nicht vorrangig, im Gegenteil, er folgt sowjetrussischen Manövern, die auf die Verhinderung einer einheitlichen westlichen Politik gerichtet sind, und auch ein Gespräch mit dem chinesischen Ministerpräsidenten gibt Anlaß zu der Vermutung, daß Frankreich eventuell aus dem westlichen Lager ausbrechen könnte. Zudem stellt Mendès-France eine Reihe von Forderungen betreffend einer Änderung des EVG-Vertrages. Unter diesen Forderungen befindet sich eine Beschränkung der Integration der in Deutschland stationierten Streitkräfte und ein auf acht Jahre beschränktes sog. „Rekursrecht“, womit jedem Mitgliedsstaat die Möglichkeit gegeben würde durch sein Veto sämtliche Beschlüsse zu verhindern. -Und Frankreich somit sämtliche Beschlüsse blockieren könnte.
Am 19. August 1954 wird eine Konferenz in Brüssel einberufen, auf der versucht werden soll die Meinungsverschiedenheiten mit der französischen Regierung zu überwinden. Man befürchtete bereits vorher, daß Mendès-France den EVG-Vertrag zu scheitern beabsichtigte. Diese Absicht spricht er aber nicht offen aus, so, daß es aussehen soll, als ob die anderen Staaten sich weigern seine Vorschläge zu diskutieren. Da die Änderungsvorschläge hauptsächlich eine Diskriminierung Deutschlands darstellen und abzusehen ist, daß vor allem Adenauer wesentliche Einwände erheben würde, würde somit Deutschland in die Rolle eines Schuldigen am Scheitern des EVG-Vertrages gedrängt. Eine weitere Außenpolitische Folge dessen wäre, daß Frankreich ein Arrangement mit der UdSSR als einzige Alternative zu dem gescheiterten europäischen Zusammenschluß hinstellen würde. Wenn man aber hingegen den Anträgen Mendès-Frances stattgeben würde, so würde dies nicht nur eine ungemeine Diskriminierung Deutschlands darstellen, sondern auch eine neue Ratifizierung in den Ländern, die bereits eingewilligt hatten erforderlich machen. Dies würde eine erhebliche Verzögerung bedeuten, was von der UdSSR als außenpolitischer Sieg gewertet werden würde.
Die Verhandlungen in Brüssel verdeutlichen, daß eine klare Linie zwischen Frankreich und den restlichen Staaten gezogen wurde. Man kommt Mendès-France soweit wie möglich entgegen, ohne dabei allerdings gegen Hauptgrundsätze wie die Gleichberechtigung aller Mitgliedsstaaten oder die militärische Wirksamkeit der Organisation zu verstoßen. Als man feststellt, daß die Verhandlungen stagnieren wird die Konferenz abgebrochen. Mendès-France würde den Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft der französischen Nationalversammlung zur Entscheidung vorlegen.
Am 30.August 1954 kommt es dann zur schicksalhaften Abstimmung. Die Versammlung verwirft mit 319 gegen 264 Stimmen und 12 Enthaltungen den EVG-Vertrag, nachdem sich vier gegnerische Gruppen herausgebildet hatten; unter diese zählen nicht nur betont national eingestellte Politiker sowie Gegner Deutschlands, die mit dem Scheitern des Vertrages auch Deutschland schwächen wollen, und Politiker, die auf eine friedliche Lösung im West-Ost- Konflikt hoffen, sondern auch Kommunisten, deren Stimmenanteil die Entscheidung im Endergebnis vor allem stark beeinflußt.
Da es Adenauer gelungen ist deutlich zu machen, daß er einer deutsch-französischen Freundschaft nicht abgeneigt ist und ebenso ein Verfechter Europas ist, fördert die Ablehnung der EVG durch Frankreich eine besonders enge Annäherung zwischen Washington und Bonn. Die Ära der „Dulles-Adenauer-Freundschaft“ beginnt. Man beschließt trotz der Niederlage die konsequente Fortsetzung einer Politik der europäischen Einigung. Die Souveränität
Deutschlands soll wiederhergestellt werden mit dem ständigen Ziel der Wiedervereinigung vor Augen. Dies ist ein Versprechen die wichtigsten Punkte des Deutschlandvertrages- dessen in Kraft treten mit dem Scheitern der EVG einstweilig ausgeschlossen wird- beizubehalten. Das Schicksal Europas soll nicht von etwa 100 kommunistischen Mitgliedern der französischen Nationalversammlung, die nach dem Kommando Moskaus abstimmen, entschieden werden.
Auch Groß-Britannien unterstützt Deutschland; die britische Regierung arbeitet an einer Alternative, die der Bundesrepublik weiterhin Chancengleichheit gewähren soll.
Man beschließt Deutschland den Beitritt zur NATO zu gewähren. Man wünscht zwar immer noch, daß Deutschland nicht unkontrolliert aufrüstet, aber man will den Aufbau einer deutschen Wehrmacht unterstützen, die einen Beitrag zur Verteidigung Europas leisten soll. Ebenfalls soll Deutschland mit Italien in einen umgeänderten Brüsseler Pakt eintreten, da auf ihm die NATO überhaupt begründet war, und man deutsche Soldaten nicht einem fremden Kommando unterstellen kann ohne, daß Deutschland gleichberechtigtes Mitglied der bestimmenden Organisation ist. Vor allem soll der Besatzungszustand Deutschlands zu einem möglichst frühen Zeitpunkt beendet werden.
Allerdings befürchtet man ein Abgleiten Deutschlands in den Osten, wenn nicht zügig gehandelt würde. Eines der von Deutschland abzugebenden Versprechen ist, daß man sich definitiv für den Westen entscheiden müßte; bei einer Schaukelpolitik wäre kein Kompromiß möglich.
Die USA zeigt deutliches Mißfallen über das französische Verhalten und man ist durchaus gewillt diesmal auch ohne Frankreich zu handeln. -Hierbei stellt sich allerdings das Problem, daß man mit größtem diplomatischen Geschick vorgehen muß um ein Zusammengehen Frankreichs mit Rußland zu verhindern. Ein geeignetes Druckmittel ist die Wirtschaft, da auch Frankreich stark von den USA abhängig ist.
Die Taktik Mendès-Frances hingegen scheint wieder in die gleiche Richtung zu tendieren: Man will unerfüllbare Forderungen stellen und den anderen Staaten, wenn sie nicht darauf eingingen, die Schuld zuschieben. Dies liegt auch unter anderem an der Angst vor einer wiedererstarkenden deutschen Wehrmacht, die eine Bedrohung darstellen könnte. Die Forderungen Frankreichs sind erneut für die Bundesrepublik Deutschland stark diskriminierend: Sie enthalten keinen Hinweis auf eine Beendigung der Besatzung was eine Gleichberechtigung Deutschlands verhindern würde. Zudem sollen die vertraglichen Regelungen nur die Streitkräfte betreffen, die unter das Kommando der NATO gestellt werden sollen, aber eine Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO ist nicht vorgesehen. Deutschland ist allerdings nur bereit als gleichberechtigtes Mitglied einen Verteidigungsbeitrag zu leisten; zudem soll auf jeden Fall der Besatzungsstatus aufgehoben werden.
Diese Probleme bedürfen einer weiteren Konferenz. Hinzu kommt, daß man die Grenzen des Brüsseler Paktes festlegen und mit der NATO -da sich die Zuständigkeitsbereiche beider überschnitten- koordinieren muß.
Man beschließt also am 28. September 1954 die Londoner Konferenz abzuhalten. Auf dieser Konferenz soll sowohl die Besatzung, der Brüsseler Pakt als auch die Zulassung zur NATO behandelt werden.
Zu der Problematik der französischen Forderungen gesellt sich das Problem, daß die amerikanische Stimmung aufgrund zu schneller wirtschaftlicher Erfolge Deutschlands ins negative umschlägt. Genauso, wie es in Vergessenheit geraten war, daß die EVG ursprünglich auf einen französischen Vorschlag zurückging, hatte man verdrängt, daß es ein amerikanischer Wunsch gewesen war die deutsche Wiederbewaffnung voranzutreiben.
Die Gegner Deutschlands machen daraus eine „deutsche Forderung zur Wiederaufrüstung“. Dennoch will sich Dulles für einen Eintritt Deutschlands in die NATO einsetzen. Frankreich befindet sich inzwischen in einem isolierten Zustand; in Paris will man deshalb ebenfalls zu einem Abkommen der Kombination des Brüsseler Vertrages und der NATO gelangen, ohne dabei aber die gleichzeitige Einschaltung von Kontrollen zu vernachlässigen.
Somit ist Deutschland vor die Aufgabe gestellt, nicht nur ein gutes deutsch-französisches Verhältnis herstellen und wahren zu müssen, sondern auch mit betonter Sorgfalt vorzugehen und unter Vermeidung des Ausdruckes „Wiederaufrüstung“ dennoch eine gleichrangige Stellung inmitten der anderen Bündnisstaaten zu erreichen.
Quellen: „Erinnerrungen“, K. Adenauer
„Der große Ploetz“
„Das 20. Jahrhundert“, Cd-Rom „Brockhaus“
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel von Konrad Adenauers Politik laut diesem Text?
Laut dem Text war das vorrangige Ziel von Konrad Adenauers Politik, „die nationale und staatliche Einheit des deutschen Volkes“ zu wahren und „als gleichberechtigtes Mitglied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen“. Er wollte Deutschland von einem besetzten Land zu einem gleichberechtigten Partner der Weststaaten machen.
Was ist das Petersberger Abkommen und welche Bedeutung hatte es für Deutschland?
Das Petersberger Abkommen wurde am 22. November 1949 unterzeichnet und legte den Beitritt der Bundesrepublik zum Europarat und zur Ruhrbehörde fest, mit dem Saargebiet als eigenständigem Mitglied. Es war ein erster Schritt, Deutschland in die Zusammenarbeit mit den westeuropäischen Ländern zu führen und als friedliebendes Mitglied in die europäische Gemeinschaft zu integrieren. Es förderte auch den Austausch von Handels- und Konsularvertretungen mit anderen Ländern.
Wie stand die SPD, insbesondere Kurt Schuhmacher, zu Adenauers Politik?
Die SPD und Kurt Schuhmacher kritisierten Adenauers Politik. Schuhmacher bezeichnete Adenauer als "Bundeskanzler der Alliierten", was die unterschiedlichen Wege zwischen Regierungskoalition und Opposition verdeutlichte. Die SPD befürchtete, dass Adenauers Politik die deutsche Einigung erschweren würde.
Welche Schritte unternahm Adenauer, um die Freiheit Deutschlands zu erreichen?
Adenauer unternahm mehrere Schritte, darunter das Petersberger Abkommen, die Anerkennung der Bundesregierung als einzige freie und gesetzlich konstituierte deutsche Regierung auf der Außenministerkonferenz 1950, die Revisionen des Besatzungsstatuts im März 1951 und den Abschluss des "Deutschlandvertrags" am 26. Mai 1952.
Was war der Deutschlandvertrag und welche Ziele wurden damit verfolgt?
Der Deutschlandvertrag war ein wichtiger Schritt zur Selbstbestimmung der Bundesrepublik und löste Deutschland aus seiner Isolierung. Als gemeinsame Ziele der Unterzeichnenden wurden die Eingliederung der Bundesrepublik in die freie Welt auf der Grundlage der Gleichberechtigung und die Wiederherstellung eines völlig freien und vereinigten Deutschlands auf friedlichem Wege verkündet.
Was war die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und warum scheiterte sie?
Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) war das Projekt einer europäischen Armee, initiiert von René Pleven. Der Vertrag scheiterte, weil Frankreich ihn am 30. August 1954 verwarf, vor allem aufgrund des Widerstands national eingestellter Politiker, Gegner Deutschlands und Kommunisten.
Welche Rolle spielte Frankreich bei der Verhinderung der EVG und welche Konsequenzen hatte dies?
Frankreich, unter Ministerpräsident Mendès-France, stellte Forderungen zur Änderung des EVG-Vertrages, die hauptsächlich eine Diskriminierung Deutschlands darstellten. Das Scheitern des EVG-Vertrages führte zu einer engeren Annäherung zwischen Washington und Bonn und zur Entscheidung, Deutschland den Beitritt zur NATO zu ermöglichen.
Wie reagierten die USA und Großbritannien auf das Scheitern der EVG?
Die USA und Großbritannien unterstützten Deutschland nach dem Scheitern der EVG. Die britische Regierung arbeitete an einer Alternative, die der Bundesrepublik weiterhin Chancengleichheit gewähren sollte, und man beschloss, Deutschland den Beitritt zur NATO zu gewähren.
Welche Befürchtungen gab es bezüglich eines möglichen Abgleitens Deutschlands in den Osten?
Es gab Befürchtungen, dass Deutschland in den Osten abgleiten könnte, wenn nicht zügig gehandelt würde. Eines der von Deutschland abzugebenden Versprechen war, dass man sich definitiv für den Westen entscheiden müsse; bei einer Schaukelpolitik wäre kein Kompromiss möglich.
Welche Rolle spielte die Angst vor einer wiedererstarkenden deutschen Wehrmacht?
Die Angst vor einer wiedererstarkenden deutschen Wehrmacht spielte eine Rolle bei den französischen Forderungen und dem Widerstand gegen die EVG. Frankreich befürchtete, dass eine solche Wehrmacht eine Bedrohung darstellen könnte.
- Citar trabajo
- RheaSophia Riis (Autor), 2001, Europäisierung als Weg zu Separatstaatlichkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103777