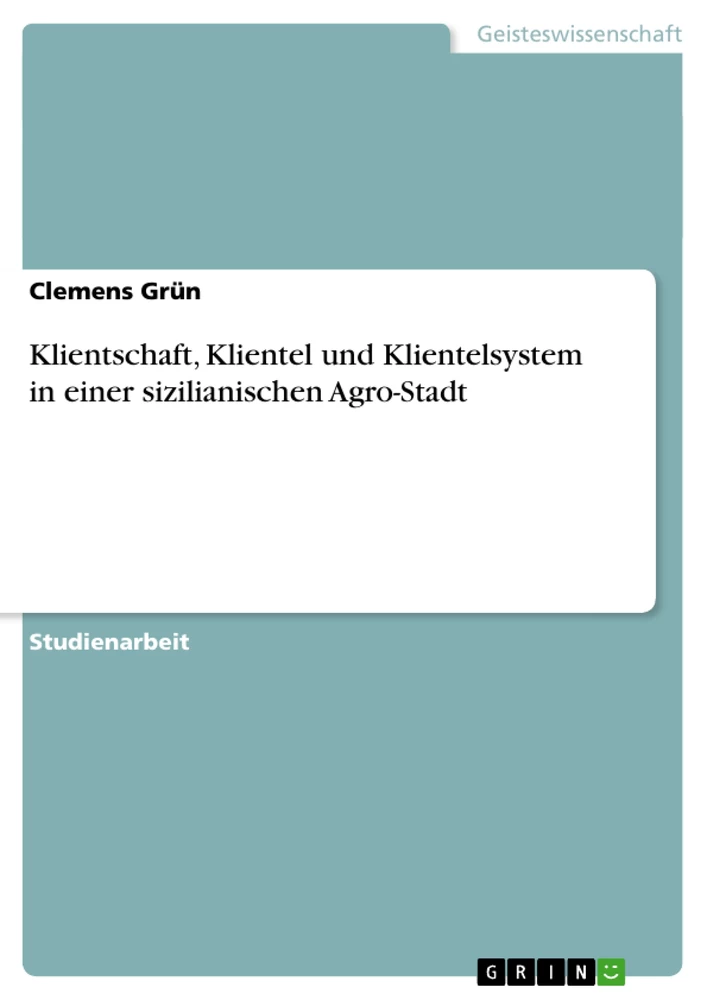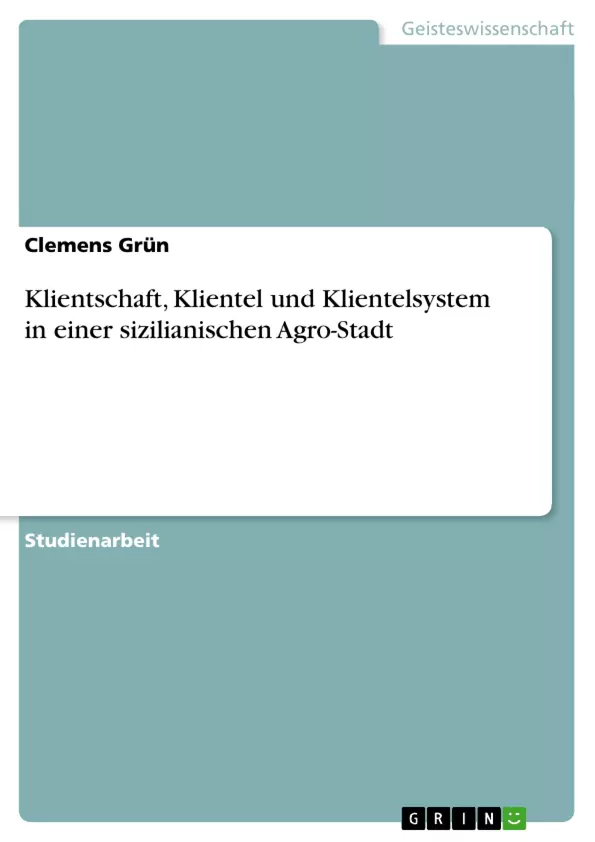Der Zeichenlehrer Calogero hat sich nie in seinem Leben für Politik interessiert. Dennoch wird er zum Hauptkandidaten der sozialdemokratischen Partei für die Kommunalwahlen des Jahres 1966 im sizilianischen Campopace. Durch persönliche Beziehungen mobilisiert er außerdem zusätzliche Wählerschaft für die Partei. Diese ihm auferlegte Verpflichtung ist Gegenleistung für die Begünstigung bei einer Abiturprüfung, die der Verlobten Calogeros auf dessen Bitten durch eine Studienrätin zuteil wird, die ihrerseits mit einem sozialdemokratischen Parteisekretär vermählt ist...1
Behörden bearbeiten Anträge, Akten und andere Dokumente bevorzugt, wenn sie von Personen kommen, die Macht besitzen oder durch solche geschützt werden. Bei der Vergabe von Bauprojekten und der Besetzung von Angestellten- oder Beamtenstellen entscheiden nicht Sachgesichtspunkte, sondern die persönliche Beziehungskette zwischen Bewerber und Prüfer. Private Firmen werden zu defizitären Verwaltungsapparaten aufgebläht und in staatliche Abhängigkeit getrieben, weil Banken Kredite nur im Gegenzug zur Stellenvermittlung vergeben...
Solcherlei „Futterkrippenwirtschaft“ („spoils system“/ M. Weber2), die Mühlmann und Llaryora Mitte der 60er Jahre bei ihren sozialanthropologischen Untersuchungen in Campopace antreffen, fällt genauso wie das zuerst genannte lavoro capillare (Werben um Wählerstimmen bei Freunden und Verwandten) soziopolitisch unter den Begriff der Patronage, ein Phänomen, das, so J. Boissevain3,. „den Staat schwächt, Vetternwirtschaft, Korruption und influence-peddling ermöglicht und die Autorität der Gesetze untergräbt.“ Es handelt sich um ein System von Leistungen, die zwischen einer Patron (P) benannten Machtperson und ihren Klienten (C) ausgetauscht werden. Der Patron ist im Besitz eines Patronates, einer permanenten und institutionalisierten Position, die ihm bestimmte „Chancen“ (M. Weber4) an Macht, Prestige, Einfluss und Reichtum ermöglicht, kraft derer er niedriger gestellte Personen durch Dienstleistungen begünstigen kann. Hierfür erwartet P Gegenleistungen von C5. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriffsbestimmung
- 2. Deskriptive Dimension
- (a) Beziehung zwischen Patron und Klient
- (b) Kommunikationsstruktur innerhalb der Klientel
- 3. Diskurs
- (a) 60er Jahre
- (b) Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Konzept der Patronage und Klientelsysteme, basierend auf der Studie von Mühlmann/Llaryora über eine sizilianische Agro-Stadt. Ziel ist es, den Begriff der Patronage zu definieren, die deskriptive Dimension des Systems zu beleuchten und den wissenschaftlichen Diskurs dazu zu analysieren.
- Begriffsbestimmung von Patronage und Klientelsystemen
- Analyse der Beziehungen zwischen Patron und Klient
- Kommunikationsstrukturen innerhalb der Klientel
- Der wissenschaftliche Diskurs über Patronage in den 60er Jahren und darüber hinaus
- Anwendung des Konzepts auf ein Beispiel aus der Berliner Hochschulwelt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem es den Begriff der Patronage präzise definiert. Es beschreibt das System als einen Austausch von Leistungen zwischen einem mächtigen Patron (P) und seinen abhängigen Klienten (C). Die Beziehung ist asymmetrisch und vertikal, wobei der Patron über mehr Macht, Prestige und Ressourcen verfügt. Der Autor hebt die Bedeutung von Gegenleistungen von den Klienten an den Patron hervor, die oft implizit und nicht klar definiert sind. Die Einführung des Beispiels von Calogero, dem Zeichenlehrer, der zum politischen Kandidaten wird, dient als Illustration, wird aber später als nicht vollständig repräsentativ für das theoretische Konzept des Textes betrachtet.
2. Deskriptive Dimension (a) Beziehung zwischen Patron und Klient: Dieser Abschnitt beschreibt die Art der Leistungen, die zwischen Patron und Klient ausgetauscht werden. Beispiele reichen von medizinischer Versorgung und Rechtsbeistand gegen Landarbeit bis hin zu politischen Begünstigungen im Austausch für Wahlhilfe oder Einflussnahme auf Behörden. Die Autoren betonen, dass die Gegenleistungen oft implizit und unklar definiert sind, was die Macht des Patrons stärkt. Die Willkür dieser Beziehungen festigt die Abhängigkeit der Klienten. Die Rolle der Klientengewinnung als zentrale Verpflichtung der Klienten gegenüber dem Patron wird hervorgehoben.
2. Deskriptive Dimension (b) Kommunikationsstruktur innerhalb der Klientel: Dieses Kapitel beleuchtet die Kommunikationsstruktur innerhalb von Klientelen. Es beschreibt Klientele als Quasi-Gruppen, in denen die Mitglieder ein gemeinsames Ziel verfolgen, aber das Gesamtkonstrukt nicht vollständig erfassen. Der Autor hebt die Bedeutung der Kommunikation zwischen den einzelnen Klienten für die Reputation des Patrons hervor. Die Erweiterung der vertikalen Patron-Klient-Beziehung auf eine horizontale Ebene durch Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen wird erklärt, ebenso wie die Bildung von „Cliquen“ mit intensiver Interaktion. Die Bedeutung des „underlying network“ bestehender Beziehungen als Grundlage für die Klientelbildung wird betont.
3. Diskurs (a) 60er Jahre und (b) Kritik: Dieser Abschnitt untersucht den wissenschaftlichen Diskurs rund um Patronage und Klientelsysteme, insbesondere in den 1960er Jahren. Es wird die Arbeit von Mühlmann und Llaryora im Kontext der damaligen sozialanthropologischen Forschung positioniert. Die Kritik an dem Konzept der Patronage wird angedeutet und es wird erwähnt, dass der Text das theoretische Konzept und die empirischen Daten auf ein Beispiel aus der Berliner Hochschulwelt anwenden möchte, was jedoch nicht im gegebenen Textteil enthalten ist. Der Schlussabschnitt verspricht eine Anwendung des theoretischen Konzepts auf ein konkretes Beispiel aus der Lebenswelt Berliner Hochschulangehöriger, das aber nicht explizit dargestellt ist.
Schlüsselwörter
Patronage, Klientelsystem, Patron, Klient, asymmetrische Beziehungen, soziale Macht, Kommunikationsstrukturen, Quasi-Gruppen, soziopolitische Strukturen, Gegenleistungen, Sizilien, Campopace, Mühlmann/Llaryora.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse eines Patronage- und Klientelsystems
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Analyse untersucht das Konzept der Patronage und Klientelsysteme, basierend auf der Studie von Mühlmann/Llaryora über eine sizilianische Agro-Stadt (Campopace). Der Fokus liegt auf der Definition des Begriffs „Patronage“, der Beschreibung der deskriptiven Dimension des Systems und der Analyse des wissenschaftlichen Diskurses dazu.
Welche Aspekte der Patronage werden behandelt?
Die Analyse behandelt die Begriffsbestimmung von Patronage und Klientelsystemen, die Beziehungen zwischen Patron und Klient (Austausch von Leistungen, implizite Gegenleistungen, Machtstrukturen), die Kommunikationsstrukturen innerhalb der Klientel (Quasi-Gruppen, horizontale Beziehungen, „underlying network“), und den wissenschaftlichen Diskurs über Patronage, insbesondere in den 1960er Jahren und die daran geknüpfte Kritik.
Wie wird die Beziehung zwischen Patron und Klient beschrieben?
Die Beziehung zwischen Patron und Klient wird als asymmetrisch und vertikal beschrieben. Der Patron verfügt über mehr Macht, Prestige und Ressourcen. Der Austausch von Leistungen ist oft implizit und unklar definiert, was die Macht des Patrons stärkt und die Abhängigkeit der Klienten festigt. Beispiele für Leistungen reichen von medizinischer Versorgung und Rechtsbeistand bis hin zu politischen Begünstigungen.
Welche Rolle spielt die Kommunikation innerhalb der Klientel?
Die Kommunikation innerhalb der Klientel ist essentiell für die Reputation des Patrons. Die Klientel wird als Quasi-Gruppe beschrieben, in der Mitglieder ein gemeinsames Ziel verfolgen, aber das Gesamtkonstrukt nicht vollständig erfassen. Horizontale Beziehungen durch Verwandtschaft und Freundschaft sowie die Bildung von „Cliquen“ spielen eine wichtige Rolle. Das „underlying network“ bestehender Beziehungen bildet die Grundlage für die Klientelbildung.
Wie wird der wissenschaftliche Diskurs über Patronage behandelt?
Die Analyse untersucht den wissenschaftlichen Diskurs über Patronage, insbesondere die Arbeit von Mühlmann und Llaryora im Kontext der sozialanthropologischen Forschung der 1960er Jahre. Die Kritik an dem Konzept wird angedeutet. Die Arbeit beabsichtigt eine Anwendung des Konzepts auf ein Beispiel aus der Berliner Hochschulwelt, welches jedoch im vorliegenden Text nicht detailliert dargestellt wird.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Patronage, Klientelsystem, Patron, Klient, asymmetrische Beziehungen, soziale Macht, Kommunikationsstrukturen, Quasi-Gruppen, soziopolitische Strukturen, Gegenleistungen, Sizilien, Campopace, Mühlmann/Llaryora.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Begriffsbestimmung, der deskriptiven Dimension (Beziehung Patron-Klient und Kommunikationsstruktur innerhalb der Klientel) und dem Diskurs über Patronage (60er Jahre und Kritik). Ein angekündigtes Beispiel aus der Berliner Hochschulwelt ist nicht im vorliegenden Text enthalten.
Wo finde ich ein Beispiel aus der Berliner Hochschulwelt?
Ein Beispiel aus der Berliner Hochschulwelt wird zwar angekündigt, ist aber in diesem Text nicht enthalten.
Was ist der Zweck der Zusammenfassung?
Die Zusammenfassung dient als umfassende Übersicht über den Inhalt der Arbeit, inklusive Titel, Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
- Citar trabajo
- Clemens Grün (Autor), 1998, Klientschaft, Klientel und Klientelsystem in einer sizilianischen Agro-Stadt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10385