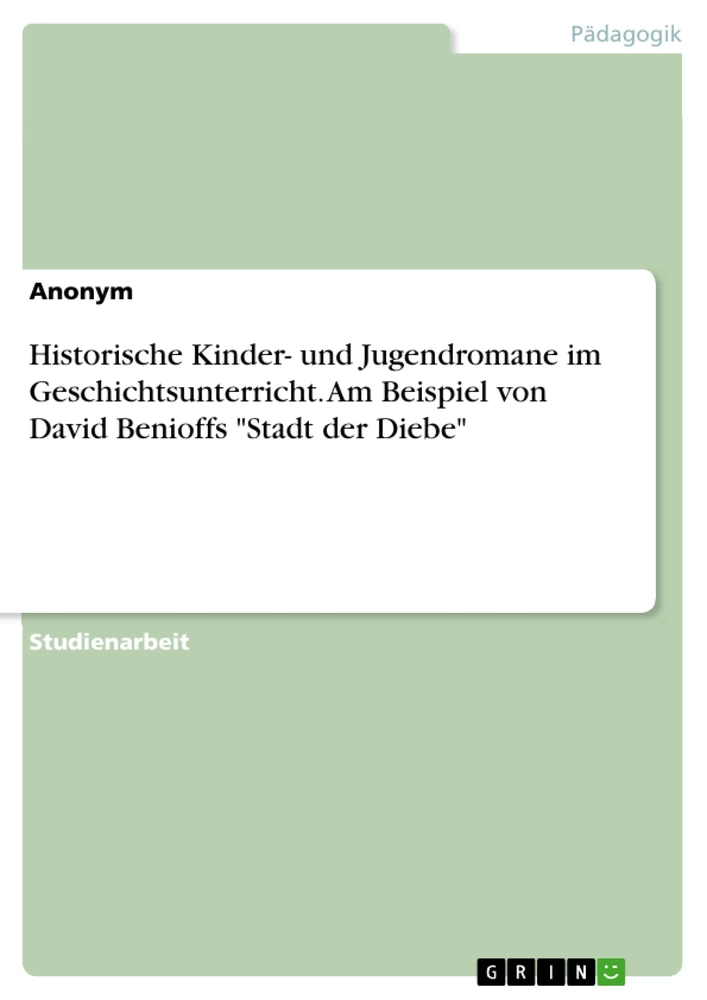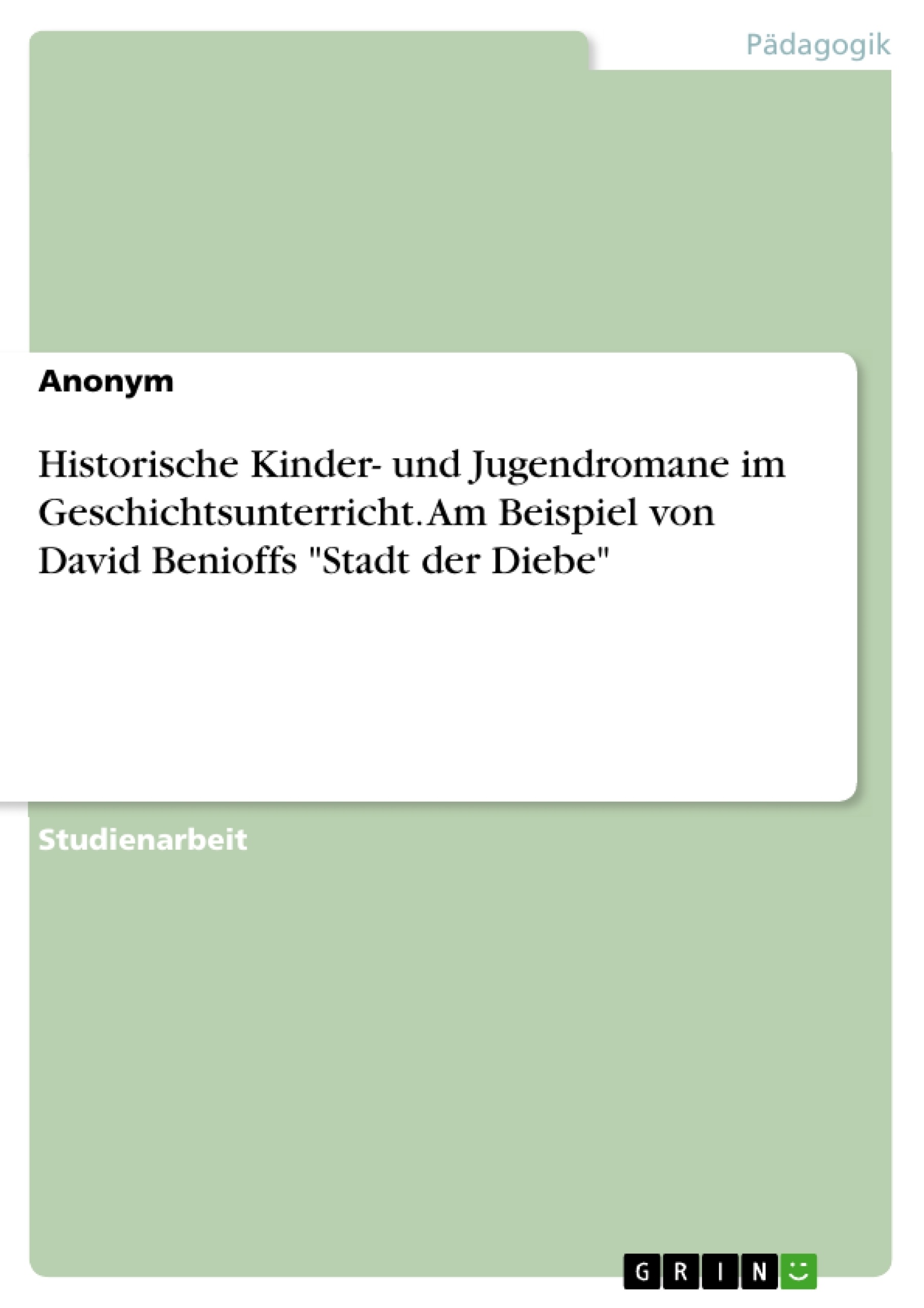In dieser Arbeit steht das historische Kinder- und Jugendbuch "Stadt der Diebe" von David Benioff und dessen Einsetzbarkeit im Geschichtsunterricht im Fokus. In dem Roman geht es um zwei pubertierende Jungen, die sich im besetzen Leningrad im Winter 1942 auf die Suche nach Eiern begeben müssen, um ihr Leben zu retten. Auf ihrem Weg erfährt der Leser einiges über die Zustände zur Zeit der Belagerung und deren Auswirkungen auf das Leben der Zivilbevölkerung. Somit wird eine historische Thematik in den Mittelpunkt gestellt, die im Unterricht kaum Beachtung findet. Das Thema wäre in der 9ten Hauptschule und in der 10ten Realschule und Gymnasium einzubinden. Einzuordnen wäre die Besatzung Leningrads in der Haupt- und Realschule unter dem Aspekt "Beschwichtigung, Aggression, Vernichtung – Eskalation der Gewalt in der Außenpolitik", im Gymnasium unter "Vernichtungskrieg und Völkermord".
Als erstes wird auf die Vor- und Nachteile von historischer Kinder- und Jugendliteratur eingegangen und erläutert, welche Auswahl- und Analysekriterien, je nach Lernziel relevant sind, um das Medium sinnvoll im Unterricht einzubinden. Danach wird der Roman „Stadt der Diebe“ im Fokus der Arbeit stehen. Zunächst wird der Inhalt des Buches wiedergegeben und eine fachdidaktische Beurteilung auf Grundlage der vorher erarbeiteten Auswahl- und Analysekriterien, abgebeben. Zum Schluss der Arbeit werden verschiedene thematische Schwerpunkte, die mit dem Roman erarbeitet werden können, herausgearbeitet und für einen ein konkreter Arbeitsvorschlag unterbreitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Historischer Kinder- und Jugendliteratur“ im Unterricht
- 2.1 Vor- und Nachteile des Einsatzes im Unterricht
- 2.2 Auswahl- und Analysekriterien
- 3. Der Roman „Stadt der Diebe“
- 3.1 Inhaltszusammenfassung
- 3.2 Sachanalyse
- 3.3 Fachdidaktische Beurteilung
- 3.3.1 Auswahl- und Analysekriterien nach Rox-Helmer
- 3.3.2 Geschichtsbewusstsein nach Pandel
- 4. Didaktische Idee
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz des historischen Kinder- und Jugendromans „Stadt der Diebe“ im Geschichtsunterricht. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile dieser Methode zu beleuchten und anhand des Beispielromans aufzuzeigen, wie „historische Kinder- und Jugendliteratur“ didaktisch sinnvoll eingesetzt werden kann. Die Arbeit analysiert den Roman im Hinblick auf seine Eignung für den Unterricht und entwickelt eine konkrete didaktische Idee für dessen Verwendung.
- Vor- und Nachteile des Einsatzes historischer Kinder- und Jugendromane im Unterricht
- Analyse von Auswahl- und Analysekriterien für die Auswahl geeigneter Romane
- Fachdidaktische Beurteilung von „Stadt der Diebe“
- Entwicklung eines Geschichtsbewusstseins anhand des Romans
- Konkrete didaktische Umsetzungsideen für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Einsatzes historischer Kinder- und Jugendromane im Unterricht ein. Sie hebt die zunehmende Popularität dieser Romane hervor und betont die unterschiedliche Qualität der Bücher. Hochwertige Romane können den Geist der Zeit vermitteln und historische Sachverhalte plausibel in die Geschichte einbinden. Die Arbeit fokussiert auf den Roman „Stadt der Diebe“ und seine didaktische Einsetzbarkeit im Geschichtsunterricht, insbesondere in Bezug auf die Belagerung Leningrads, ein Thema, das im regulären Unterricht oft zu kurz kommt. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die einzelnen zu behandelnden Aspekte.
2. „Historischer Kinder- und Jugendliteratur“ im Unterricht: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Historische Kinder- und Jugendliteratur“ und klärt die fachliche Irreführung des Namens. Es werden die Vor- und Nachteile des Einsatzes dieser Art von Literatur im Unterricht diskutiert. Kritische Punkte wie Personalisierung von Geschichte, Erfindung von Geschichten ohne Beachtung historischer Fakten und das Auslassen von Konflikten werden angesprochen. Im Gegenzug werden die Vorteile hervorgehoben: die Anregung der Imagination, die Möglichkeit, Alltagsgeschichte darzustellen und einen Gegenwartsbezug herzustellen, sowie die Förderung eines kritischen Geschichtsbewusstseins. Die Kapitel erläutern, wie durch eine geeignete Auswahl und didaktische Aufbereitung die Kritikpunkte entkräftet werden können.
3. Der Roman „Stadt der Diebe“: Dieses Kapitel widmet sich dem Roman „Stadt der Diebe“. Es beinhaltet eine Inhaltszusammenfassung, eine Sachanalyse und eine fachdidaktische Beurteilung. Die Beurteilung stützt sich auf die zuvor erarbeiteten Auswahl- und Analysekriterien und bezieht die Dimensionen des Geschichtsbewusstseins nach Pandel mit ein. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Lebensumstände in Leningrad während der Belagerung und der Einbindung dieser Darstellung in den Geschichtsunterricht.
4. Didaktische Idee: Dieses Kapitel präsentiert eine konkrete didaktische Idee, wie der Roman „Stadt der Diebe“ im Unterricht eingesetzt werden kann. Es wird ein thematischer Schwerpunkt herausgearbeitet und ein konkreter Arbeitsvorschlag unterbreitet, der auf den vorherigen Analysen und Beurteilungen basiert. Es wird gezeigt, wie die Geschichte die Schüler zum Nachdenken über das Thema anregen kann.
Schlüsselwörter
Historischer Kinder- und Jugendroman, Geschichtsunterricht, Stadt der Diebe, David Benioff, Belagerung Leningrads, Geschichtsbewusstsein, Didaktik, Imagination, Wirklichkeitsbewusstsein, kritisches Geschichtsbewusstsein, Lernziele, Analysekriterien.
Häufig gestellte Fragen zu: Einsatz des Romans "Stadt der Diebe" im Geschichtsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einsatz des historischen Kinder- und Jugendromans „Stadt der Diebe“ im Geschichtsunterricht. Ziel ist die Beleuchtung der Vor- und Nachteile dieser Methode und die Darstellung, wie „historische Kinder- und Jugendliteratur“ didaktisch sinnvoll eingesetzt werden kann. Die Arbeit analysiert den Roman hinsichtlich seiner Eignung für den Unterricht und entwickelt eine konkrete didaktische Idee für dessen Verwendung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vor- und Nachteile historischer Kinder- und Jugendromane im Unterricht; Analyse von Auswahl- und Analysekriterien für geeignete Romane; fachdidaktische Beurteilung von „Stadt der Diebe“; Entwicklung eines Geschichtsbewusstseins anhand des Romans; konkrete didaktische Umsetzungsideen für den Unterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung; 2. „Historischer Kinder- und Jugendliteratur“ im Unterricht (inkl. Vor- und Nachteile sowie Auswahlkriterien); 3. Der Roman „Stadt der Diebe“ (inkl. Inhaltszusammenfassung, Sachanalyse und fachdidaktische Beurteilung nach Rox-Helmer und Pandel); 4. Didaktische Idee; 5. Fazit.
Was sind die Vor- und Nachteile des Einsatzes historischer Kinder- und Jugendromane im Unterricht?
Vorteile: Anregung der Imagination, Darstellung von Alltagsgeschichte, Gegenwartsbezug, Förderung eines kritischen Geschichtsbewusstseins. Nachteile: Personalisierung der Geschichte, Erfindung von Geschichten ohne Beachtung historischer Fakten, Auslassen von Konflikten. Durch geeignete Auswahl und didaktische Aufbereitung können die Nachteile minimiert werden.
Wie wird der Roman „Stadt der Diebe“ fachdidaktisch beurteilt?
Die fachdidaktische Beurteilung von „Stadt der Diebe“ basiert auf den erarbeiteten Auswahl- und Analysekriterien und bezieht die Dimensionen des Geschichtsbewusstseins nach Pandel mit ein. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Lebensumstände in Leningrad während der Belagerung und der Einbindung dieser Darstellung in den Geschichtsunterricht.
Welche didaktische Idee wird für den Roman "Stadt der Diebe" vorgestellt?
Kapitel 4 präsentiert eine konkrete didaktische Idee für den Einsatz des Romans im Unterricht. Ein thematischer Schwerpunkt wird herausgearbeitet und ein konkreter Arbeitsvorschlag unterbreitet, der auf den vorherigen Analysen und Beurteilungen basiert. Es wird gezeigt, wie die Geschichte die Schüler zum Nachdenken über das Thema anregen kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Historischer Kinder- und Jugendroman, Geschichtsunterricht, Stadt der Diebe, David Benioff, Belagerung Leningrads, Geschichtsbewusstsein, Didaktik, Imagination, Wirklichkeitsbewusstsein, kritisches Geschichtsbewusstsein, Lernziele, Analysekriterien.
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung führt in die Thematik des Einsatzes historischer Kinder- und Jugendromane im Unterricht ein, betont die unterschiedliche Qualität der Bücher und fokussiert auf den Roman „Stadt der Diebe“ und seine didaktische Einsetzbarkeit im Geschichtsunterricht, insbesondere in Bezug auf die Belagerung Leningrads. Sie skizziert den Aufbau und die behandelten Aspekte der Arbeit.
Was ist der Fokus des Kapitels über "Historische Kinder- und Jugendliteratur" im Unterricht?
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Historische Kinder- und Jugendliteratur“, diskutiert Vor- und Nachteile des Einsatzes im Unterricht und erläutert, wie durch geeignete Auswahl und didaktische Aufbereitung Kritikpunkte entkräftet werden können.
Welchen Schwerpunkt hat das Kapitel über den Roman "Stadt der Diebe"?
Dieses Kapitel beinhaltet eine Inhaltszusammenfassung, Sachanalyse und fachdidaktische Beurteilung des Romans "Stadt der Diebe". Der Fokus liegt auf der Darstellung der Lebensumstände in Leningrad während der Belagerung und deren Einbindung in den Geschichtsunterricht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Historische Kinder- und Jugendromane im Geschichtsunterricht. Am Beispiel von David Benioffs "Stadt der Diebe", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1041534