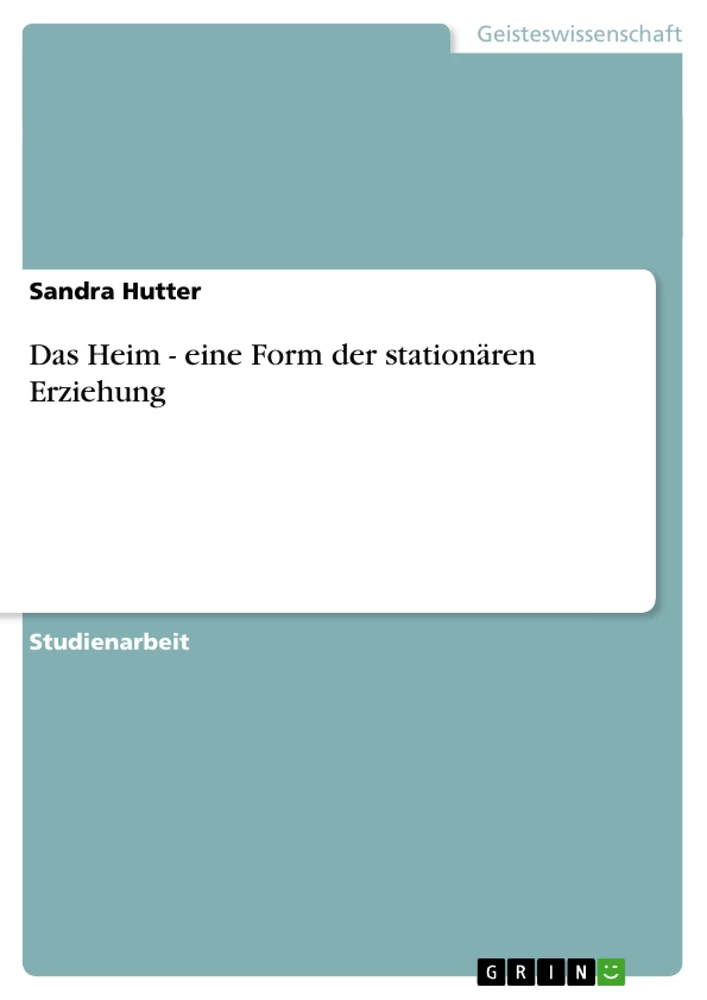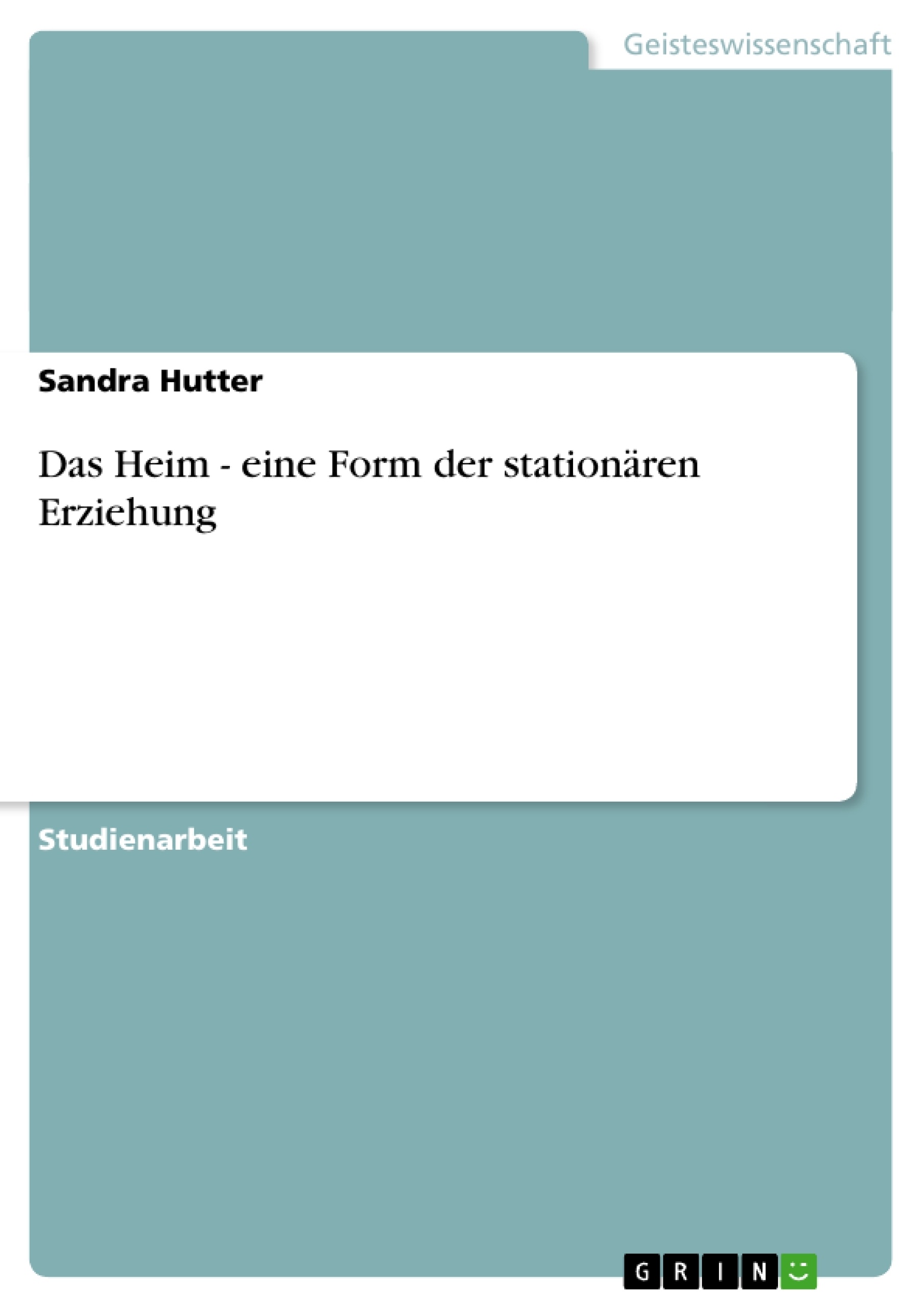1. Einleitung
Der Bearbeitungsgegenstand meiner Hausarbeit ist die stationäre Erziehung mit der Fragestellung, wie sich die Institution Heim im Laufe der Jahre verändert hat. Um vorab schon mal einen Leitgedanken zu vermitteln, möchte ich ein Zitat von Erich Fried wiedergeben:
“Befreiung von den großen Vorbildern:
Kein Geringerer als Leonardo da Vinci lehrt uns `Wer immer nur Autoritäten zitiert macht zwar von seinem Gedächtnis Gebrauch doch nicht von seinem Verstand` Prägt euch das endlich ein: Mit Leonardo los von den Autoritäten.“
(A. von Bülow 1987, Seite 5)
Ich denke, daß man, nachdem man meine Hausarbeit gelesen hat, weiß, was Erich Fried gemeint hat. Trotzdem werde ich im Schlußteil dieses Zitat noch einmal aufnehmen.
Thematisch betrachten möchte ich mittlere und große Heime, als eine frühere Form der Heimerziehung, über die Kleinheime, wie sie auch jetzt noch vereinzelt vorzufinden sind, bis hin zu den heutigen aktuellen Formen der Heimerziehung, wie Außenwohngruppen, Wohngemeinschaften, Tagesgruppen, betreutes Wohnen und die intensive sozialpädagogische Einzelhilfe. Die mittleren und großen Heime werden nur als eine Art von Verwahranstalten für Kinder und Jugendliche beschrieben, wo mehr auf die körperliche, als auf die seelische Verfassung der Heimkinder geachtet wird. Bei den Kleinheimen geht es um die Beteiligung der Kinder an der Alltagsgestaltung des Heimes sowie einbezogene Elternarbeit. In den aktuellen Formen der Heimerziehung wird schon eine Art Prävention beschrieben, um die stationäre Heimerziehung zu unterbinden und die Nachversorgung der Jugendlichen, nachdem sie aus dem Heim entlassen wurden, wird ins Auge gefaßt.
Auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen werde ich Auskunft geben, sowie ein paar statistische Angaben, um sich die aktuelle Situation in Zahlen zu verdeutlichen.
Ich werde mich nicht auf sozialarbeiterische und sozialpädagogische Aufgaben innerhalb eines Heimes beziehen, weil es mir lediglich um das Heim als Institution geht.
2.1. Mittlere und große Heime
Die mittleren und großen Heime sind wohl die ältesten sozialpädagogischen Institutionen, die Kinder und Jugendliche aufnehmen. In der Umgangssprache sind sie auch als „Kinderheime“ bekannt. Es ist eine Wohnungs-, Arbeitsplatz- und Freizeitgestaltung an einem Ort in einer bestimmten Organisationsform (vgl. A. von Bülow 1987, Seite 78). In vielen Büchern werden die Großheime nach dem Goffman´schen Modell als „totale Institutionen“ bezeichnet. Und weisen demzufolge auch wesentliche Merkmale dieser auf.
In großen Heimen findet man meist eine Binnenstruktur auf, die wiederum die Bildung von Hierarchien, Reglementierungen und Heimordnungen hervorruft. Diese Reglementierungen gehen nicht aus den Bedürfnissen der Heiminsassen hervor, was zur Folge hat, daß die Kinder und Jugendlichen keine positiven Lernerfahrungen im Umgang mit Ordnungen bekommen. Im Gegensatz, es kommt lediglich zur schlichten Unterwerfung und bloßen Anpassung. Die Heimordnung dient in erster Linie dafür, daß die Organisation nicht in Gefahr gerät und für den reibungslosen Ablauf des Heimalltages sorgt. Dieser Alltag ist gekennzeichnet durch feste Regeln und einen vorgesetzten Tagesablauf. Man könnte sagen, daß die Interessen der Gesamtsituation wichtiger sind, als die Bedürfnisse des Einzelnen.
Die Resultate sind, daß die Kinder und Jugendlichen sich anpassen, der Lethargie verfallen, ständig unzufrieden sind. Sie erlernen Umgehung- und Vermeidungstechniken, Austricksen und das offensichtliche oder heimliche Übertreten von Regeln.
Die großen Heime begünstigen gleichmachende Tendenzen. Durch das weitgehende, zentrale Versorgungssystem tritt ein Mangel am Erlernen von Selbständigkeit bei den Heiminsassen auf. Sie bekommen wenig lebensrealistische Erfahrungen. Das heißt, es wird nicht die Bewältigung von lebensnotwendigen und alltäglichen Abläufen, wie Einkaufen von Lebensmitteln und Bekleidung, und lebenspraktischen Fähigkeiten, wie die Selbstversorgung, kochen, waschen, erlernt. Dadurch können positive Änderungen gar nicht erst erwartet werden und die Potenzierung von Störungen wächst. Dies wiederum führt zu Stigmatisierungsprozessen gegenüber den Kindern und Jugendlichen, was die Reintegration erschwert.
Ein weiteres Merkmal der großen Heime ist die heiminterne Verwaltung. Den Jugendlichen wird der notwendige Kontakt mit Behörden abgenommen, was die Einengung des Lernfeldes zur Folge hat.
Durch die weite räumliche Entfernung vom Herkunftsmilieu, und meist eigene Schulen und Werkstätten, entsteht eine regionale und soziale Isolierung der Heiminsassen, was sich schädigend auf die Entwicklung auswirkt. Die Tatsache, daß die Kinder und Jugendlichen in einer Anonymität in der Masse aufwachsen, und daß die physischen Bedürfnisse mehr als die psychischen befriedigt werden führt dazu, daß es meist schlecht zur Entfaltung der Individualität, zur Verhinderung der Identitätsbildung und Emanzipation der Kinder und Jugendlichen kommt. Auch die Entfaltung der Selbstkompetenz kommt nicht zustande, da sie gar nicht von den Jugendlichen erwartet wird oder gar hinderlich für das Funktionieren des Heimes ist.
2.2. Heimkritik
Im Zusammenhang mit der Studentenbewegung und Goffman´schen Begriff der „totalen Institution“ hat sich Ende der 70-er Jahre und Anfang der 80-er Jahre Kritik geäußert gegenüber der damaligen Heimerziehung.
Einer der wichtigsten Reformziele war die Reduzierung der Gruppengrößen. Man forderte maximal 10 Kinder bei langfristiger Unterbringung und maximal 6 bei therapiebedürftigen Kindern. Je größer also der Therapiebedarf, desto kleiner die Gruppe, denn kleinere Gruppen bieten bessere Sozialisationsbedingungen. Durch die kleineren Gruppen kann die Individualität, Identität, Intimität und Integration besser erreicht werden. (In den 60-er Jahren waren bis zu 20 Kinder in einer Gruppe.)
Es kam die Forderung nach Dezentralisierung von Heimen und somit Regionalisierung, Schaffung von Außenwohngruppen und die Auflösung zentraler Versorgungseinrichtungen. Die Kompetenzen zur Alltagsgestaltung der Mitarbeiter sollten erhöht werden und eine günstigere Gestaltung der Lebensbedingungen erreicht werden. Man war der Meinung, daß die Alltagsorientierung, Dezentralisierung und autonome Organisation nur durch die Schaffung von einzelnen Wohngruppen erreicht werden konnte. Außerdem hielt man eine stetige Anpassung von Personen und Regeln für notwendig. Es kamen die Forderungen nach der Entspezialisierung, also die Auflösung oder Reduktion gruppenübergreifender Dienste innerhalb der Organisation hoch, wie auch die Forderung nach der Entinstitutionalisierung, das heißt die Aufhebung arbeitsteiliger Organisation. Man hielt es pädagogisch für sinnvoller von Kindern und Pädagogen die Regelanwendung gestalten zu lassen, und die Ressourcen der Einrichtung flexibel zu nutzen.
Ein weiterer Punkt war die Forderung nach Demokratisierung der Heimerziehung. In diesem Zusammenhang kann man fünf Bedingungen einer demokratischen Heimerziehung nennen. Als erstes sollen die pädagogischen Belange vor Verwaltungsprinzipien gehen. Der zweite Punkt ist die Erziehung zur Emanzipation durch emanzipierte Erzieher. Der nächste verlangt Teamarbeit vor Einzelentscheidungen und Anweisungen. Der vierte Punkt beschreibt die Bedeutung der Entscheidungsbeteiligung der Kinder und Jugendlichen durch/und Informationsvermittlung. Die letzte Forderung bezieht sich darauf,
Entscheidungen da zu treffen, wo Probleme gerade sind, also von unten und nicht von oben. Denn wenn die Verwaltung dominiert, tritt das Problem auf, daß die Erziehung zur Selbstbestimmung, Selbständigkeit und Selbstverantwortung durch fremdbestimmte Erzieher erfolgt.
2.3.1. Kleinheime
Wie der Name schon sagt, sind es Heime kleineren Umfangs, die sich im Aufbau und Durchführung von den großen Heimen unterscheiden. Man kann sagen, daß die Kleinheime kaum Heimcharakter haben, schon deswegen, weil die Gruppen viel kleiner sind. Ebenfalls kann es vorkommen, daß die Erzieher nicht nur im Schichtdienst dort arbeiten, sondern auch ständig dort leben.
Die Kleinheime sind meist in Wohngegenden integriert. Das begünstigt den Abbau von Vorurteilen, die Vermeidung von Stigmatisierung und ermöglicht eine günstigere Sozialisation der Kinder und Jugendlichen.
Regeln werden nicht, wie in Großheimen vorgegeben, sondern die Gruppenabsprachen und -regelungen entstehen aus den individuellen Bedürfnissen. Dadurch haben die Jugendlichen die Chance, Strukturen vorzufinden und diese auch zu verändern. Zwänge und Forderungen sind auch nicht anzutreffen, was für die Jugendlichen die Chance bietet in freiheitlicher Kleinatmosphäre von ihren Störungen und Auffälligkeiten abzulassen. Sie haben die Möglichkeit sich mit den Erziehern abzusprechen, sie lernen gegenseitig Rücksicht zu nehmen und Konflikte entweder auszuhalten oder sie zu verarbeiten. Außerdem werden im Gegensatz zu den Großheimen individuellbezogene Entscheidungen getroffen. Die Kinder und Jugendliche werden somit als Individuen angenommen und akzeptiert, was wiederum die Identitätsbildung begünstigt. Auch die Tatsache, daß Selbstversorgung, Haushaltsführung und höhere Beteiligung eine wichtige Rolle spielen, erzieht die Heiminsassen zu mehr Selbstverantwortung.
Ein weiterer Vorteil ist die regionale Verfügbarkeit und der starke Wunsch nach Elternarbeit, die Eltern sollen also in die pädagogische Arbeit mit einbezogen werden.
Neben den Vorteilen darf man aber nicht die Nachteile vergessen. Die Kleinheime weisen eine familienähnliche Beziehungsstruktur auf. Da aber Heimkinder oft aus unglücklichen und zerrütteten Familienverhältnissen kommen, brauchen sie erst einmal Freiraum und werden sich wahrscheinlich deswegen schlecht in dieser Heimform einleben können.
2.3.2. Außenwohngruppen
Außenwohngruppen sind Gruppen, die aus dem großen Heim in andere Gebäude verlegt werden. Das sind entweder Einfamilienhäuser oder größere Etagenwohnungen. Man kann sie auch als “Mischtypen zwischen Heim und Pflegefamilien” (A. von Bülow 1987, Seite 88) bezeichnen. Ein Vorteil ist somit die Alltags- und Realitätsnähe.
Die Gruppen bestehen meist aus 5 bis 8 jungen Menschen, die durch Pädagogen im Schichtdienst betreut werden oder direkt in der Wohngruppe leben, also eine Lebensgemeinschaft von Kindern und Erziehern.
Es gibt eine rationelle, nicht dominierende Verwaltung (vgl. A. von Bülow 1987, Seite 87), und die Wohngruppenmitglieder müssen sich selbst versorgen, können aber Serviceleistungen des Stammheimes in Anspruch nehmen. Die Jugendlichen haben Mitbestimmungsmöglichkeiten und die Erzieher können eigene pädagogische Vorstellungen verwirklichen, sie haben ja keine Vorgesetzte, wodurch Verhaltensauffälligkeiten stark reduziert werden können. Das Ziel ist es, diese Außenwohngruppen unauffällig in ein normales Wohnumfeld zu integrieren und Stigmatisierung zu reduzieren.
Eine Gefahr der engen emotionalen Beziehungen von Jugendlichen und Erziehern, die entstehen kann, ist der mögliche Verlust der professionellen Distanz, was wiederum die Reintegration in die Herkunftsfamilie erschwert. Ein letzter Nachteil ist, daß die Außenwohngruppen in die Abhängigkeit vom Stammheim kommen können, da sie von ihm Leistungen in Anspruch nehmen können.
2.3.3. Wohngruppen/Wohngemeinschaften
Die Wohngruppen sind “vollkommen selbständige Institutionen der stationären Jugendhilfe (R. Guender 1995, Seite 45). Es ist eine Form, in der Jugendliche wohnen. Die Aufnahme ist freiwillig und die Jugendlichen müssen sich selbst versorgen. Außerdem entstehen die Regeln durch die Selbstbestimmung der Bewohner. Serviceleistungen, wie bei der Außenwohngruppe, werden nicht in Anspruch genommen.
Die Nachfrage der Kinder und Jugendlichen nach einem Platz in einer Wohngruppe ist sehr groß.
2.3.4. Betreuung in Tagesgruppen
In einer Tagesgruppe arbeitet ein Erzieher mit drei bis vier Kindern zusammen, wobei auch der Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule eine große Bedeutung zugemessen wird. Es sind meist Kinder mit Störungen und Auffälligkeiten im Verhaltens- und /oder Leistungsbereich (vgl. R. Guender 1995, Seite 46).
Das Kind befindet sich in der Regel vom Unterrichtsschluß bis zum frühen Abend in der Tagesgruppe. Es werden spezifische heilpädagogische Methoden in der Einzel- und Gruppenpädagogik von den Erziehern angewendet, mit dem Ziel die stationäre Heimunterbringung zu vermeiden.
2.3.5. Betreutes Wohnen
Es gibt zwei verschiedene Arten von Jugendlichen, die in einem betreuten Wohnen untergebracht werden. Zum einen sind es Jugendliche und junge Volljährige, die bislang in Heimen oder Wohngruppen gelebt haben. Zum anderen sind es Jugendliche und junge Volljährige, die mit der Heimerziehung nicht zurecht gekommen sind.
Bei beiden Gruppen leben die Jugendlichen in einer eigenen Wohnung, mit dem Ziel sich weiter zu verselbständigen. Außerdem erhalten sie Beratung und Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte.
2.3.6. Intensive sozialpädagogische Einzelhilfe
Hier wird jungen Menschen geholfen, die mit sich selbst und der personalen und sachlichen Umwelt nicht zurechtkommen. Sie haben meist keine Frustrationstoleranz und keine persönlichen Perspektiven. Diese jungen Menschen leben entweder in einer eigenen Wohnung oder bei den Eltern.
2.3.7. Gegenwärtige Heimerziehung
Wenn man jetzt neue Heime plant oder alte reformieren will, wird eine große Bedeutung auf die reale Orientierung von Kindern und Jugendlichen, also die lebensweltorientierte Heimerziehung, gelegt. Man zielt auf die milieunahe/milieuorientierte Unterbringung. Eine weitere Beschreibung von Milieunähe könnte “aktive Beteiligung der früheren Lebensumwelt des Kindes und Jugendlichen in den Veränderungsprozeß” (R. Guender 1995, Seite 34) sein, denn eine Entfremdung vom Herkunftsmilieu während des Heimaufenthaltes birgt die Gefahr von übersteigerten Erwartungen für das Lebensmilieu. Das zieht wiederum Anpassungsschwierigkeiten nach der Entlassung nach sich.
Die heutigen Wohnräume und Ausgestaltungen orientieren sich an den Bedürfnissen der Bewohner, mit dem wichtigen Aspekt, daß die Wohnbedingungen die Heimkinder nicht diskriminieren dürfen. Die Gesamtatmosphäre soll menschliches Streben nach Geborgenheit und Sichwohlfühlen zulassen und unterstützen.
In den heutigen Heimen findet man eine gruppenstrukturierte Wohnform vor. Die Gruppen umfassen meist 7 bis 10 Kinder, wobei zwei Kinder sich ein Zimmer teilen. Gemeinsam benutzen sie eine Gruppenküche und das Gruppenzimmer, das überschaubar ist.
2.4. Rechtliche Rahmenbedingung
Die Heimerziehung ist im § 34 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) verankert, wo gesagt wird, daß den Eltern ein Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung zusteht. Seit der Jugendhilfereform im Jahre 1990 ist es eine freiwillige Maßnahme.
Das Ziel der Heimerziehung ist die Rückkehr in die Ursprungsfamilie, die “Vorbereitung auf die Erziehung in einer anderen Familie” (Chassé 1999, Seite 175), meist eine Pflegefamilie oder die Verselbständigung.
Die Entscheidung, ob ein Kind oder ein Jugendlicher in ein Heim kommt wird im Rahmen einer Hilfeplanung nach § 36 KJHG getroffen. Die Hilfeplanung ist ein fachliches Instrument zur Problemklärung, aufgrund einer sozialpädagogischen Problemanalyse. Dies geschieht durch Gespräche mit den Eltern und in Zusammenarbeit mit Fachkräften. Es müssen abstrakte Erziehungsziele in einfache nachvollziehbare, auch für die Eltern, Teilziele untergliedert werden. Bei der Entscheidung, ob ein Kind oder ein Jugendlicher in ein Heim kommt, sind auch die Fachkräfte des betroffenen Heimes beteiligt. Das Jugendamt vor Ort ist immer zuständig dafür und trägt auch die Kosten der Heimunterbringung. Finanziert wird dies über Pflegesätze, die sich aus den Leistungen der Personalkosten, Einrichtungskosten und Unterhaltskosten auf Platz und Tag errechnen. Die stationäre Heimunterbringung ist bei weitem die teuerste. Die Pflegesätze liegen durchschnittlich bei DM 200 pro Tag, das heißt DM 73.000 im Jahr.
2.5. Statistische Angaben
Um sich ein ungefähres Bild von Fremdplazierung und besonders der Heimerziehung zu machen, werde ich anhand weniger Zahlenangaben, die heutige Situation verdeutlichen.
Folgende statistische Angaben sind aus der Internet-Homepage von Moses- Online.
Um eine allgemeine Entwicklung in den letzten Jahren zu zeigen, mache ich Angaben von 1970 bis 1993. In diesem Zeitraum hat sich der prozentuale Anteil von Kindern unter 18 Jahren, die fremdplaziert sind verringert. So sank vom Jahr 1970 auf 1988 die Zahl von 0,82% auf 0,77%, und betrug 1993 nur noch 0,67%. Hingegen ist aber der prozentuale Anteil der Kinder unter 18 Jahren, die im Heim oder in Pflegestellen lebten, gestiegen. 1970 waren es 29% der Kinder, und in den folgenden Jahren bis 1993 hat sich der Anteil fast durchschnittlich bei 48/49% eingepegelt (Anhang 1).
Als nächstes möchte ich die Fremdunterbringung nach Alter und Art der Unterbringung in den neuen Ländern und Berlin Ost (Stand 31.12.1995) aufzeigen. Insgesamt sind 28.913 Kinder und Jugendliche bis zu einem ungefähren Alter von 21 fremdplaziert. Der größte Teil, nämlich 17.899 der Kinder befinden sich im Heim, die anderen Teile in Tagesgruppen (1.529) und Pflegefamilien (9.485). Die Kinder von 15 bis 18 Jahren sind insgesamt am häufigsten vertreten. Das trifft auch auf die Heimunterbringung (6.392) und die Pflegefamilie (2.170) zu. Bei den Tagesgruppen (578) ist das Durchschnittsalter 9 bis 12 Jahre (Anhang 2).
In den Alten Bundesländern sieht die Verteilung der Fremdunterbringung (Stand 31.12.1995) verhältnismäßig ganz ähnlich aus. Die Gesamtzahl der Kinder bis 21 Jahren liegt bei 101.364, wobei auch hier der größte Teil (53.495) in Heimen untergebracht ist. Bei den Pflegefamilien sind es 38.536 und bei den Tagesgruppen 9.334. Auch in den alten Bundesländern liegt das Durchschnittsalter der fremduntergebrachten Kinder bei 15 bis 18 Jahren. Dies trifft auch auf die Heime (18.198) zu. Bei den Pflegefamilien (7.119) liegt jedoch das durchschnittliche Alter bei 12 bis 15 Jahren, und bei den Tagesgruppen (3.565) von 9 bis 12 Jahren (Anhang 3).
Für das gesamte Deutschland (Stand 31.12.1995) kann man angeben, daß 130.277 Kinder von 0 bis 21 Jahren fremduntergebracht sind, wobei sich der größte Teil auf die Heime (71.393) verteilt. Der nächst geringere Teil lebt in Pflegefamilien (48.021) und ist in Tagesgruppen (10.863) untergebracht. Das gesamtdurchschnittliche Alter beträgt 15 bis 18 Jahre (Anhang 4). Als letztes möchte ich Angaben über Dauer der Unterbringung der verschiedenen Altersgruppen machen, die in Heimen untergebracht sind (Stand 31.12.1995). Die durchschnittliche Dauer, in der sich Kinder im Heim befinden, liegt bei ein bis zwei Jahren, wobei dann die Zahl der länger oder kürzer untergebrachten Kinder abnimmt. Insgesamt kann man sagen, daß die 15- bis 18-Jährigen sich in deutschen Heimen am häufigsten befinden.
3. Schlußteil
Die zentrale Fragestellung war, wie sich die Institution Heim im Laufe der Jahre verändert hat. Zusammenfassend kann ich sagen, daß sie großen Veränderungen unterlag. Die Anfänge waren die großen Heime, wo die Kinder in großen Schlafsälen und Speisesälen untergebracht waren und nur unzureichend auf ihr Leben nach dem Heim vorbereitet wurden. Die Struktur entsprach der einer totalen Institution, wo nur Disziplin und Ordnung herrschen sollte, aber kein Bedarf nach Individualität und Selbständigkeit der Jugendlichen war.
Diese Großheime standen dann Ende der 70-er Jahre, Anfang der 80-er Jahre im Mittelpunkt der Heimkritik, als diese Institution stark angegriffen wurde. Kritikpunkte waren der hierarchische Aufbau, die Größe, die schlechten Sozialisationsbedingungen für die Kinder und Jugendlichen, die Zentralisierung und die mangelnde Demokratisierung der Großheime.
Folgen aus dieser Heimkritik ist die Entstehung von Kleinheimen, die sich wesentlich von den Großheimen unterscheiden. Sie sind kleiner, beziehen ihre Heimkinder mit ein, bereiten sie besser auf das Leben nach dem Heim vor, und sie sind dezentralisiert angelegt, wodurch Stigmatisierungsprozesse reduziert oder gar vermieden werden. Andere Reaktionen aus der Heimkritik sind die heutigen Formen der Heimerziehung, Außenwohngruppen, betreutes Wohnen, ect. ,bei denen viel Wert auf die Milieuorientierung und Verselbständigung der Kinder und Jugendlichen gelegt wird.
Nun möchte ich mich aber noch einmal auf das Gedicht von Erich Fried beziehen. Er sprach in ihm, von den Autoritäten loszulassen, weil man dadurch nur sein Gedächtnis gebraucht, aber nicht seinen Verstand. Im Zusammenhang mit der Heimerziehung sollten als Autoritäten vermutlich die Erzieher des Heimes gemeint sein, die über die Kinder herrschen und von ihnen absoluten Gehorsam und Einfügung in die Ordnung verlangen. Diese Autorität eignet sich zwar gut für das Drillen von Soldaten, ist aber für Kinder und Jugendliche völlig ungeeignet. Für die Kinder stellen die Erzieher Bezugspersonen und auch gewisse Vorbilder dar, was aber durch diese Art von Autorität völlig kaputt gemacht wird. Die Kinder werden sich vermutlich auch unterordnen und gehorchen, aber nur um Strafen zu entgehen, und nicht weil sie es als richtig ansehen.
Demzufolge wird man kaum positive Lernergebnisse erwarten und die Kinder nicht zu verantwortungsvollen, selbstbewußten Erwachsenen erziehen können. Abschließend möchte ich sagen, daß ich Heime als sinnvoll ansehe und sie für viele Kinder und Jugendliche eine Chance darstellen. Ihnen wurden die Möglichkeiten geboten, sich aktiv mit ihren Problemen zu befassen, sich ihr Leben neu zu ordnen und sich für ihre Zukunft neu zu orientieren, egal ob sie bis zur Volljährigkeit im Heim bleiben oder zurück zu ihren Familien gehen.
4. Anhang
Anhang 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Angang 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhang 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Angang 4
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhang 5
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5. Literaturverzeichnis
- von Bülow, Albrecht: Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland. Zum Wandel der Konzepte stationärer Erziehung. Profil Verlag. München 1987
- Prof. Dr. Chassé, Karl August/Prof. Dr. Wensierski, Hans-Jürgen: Praxisfelder der Sozialen Arbeit. Juventa Verlag. Weinheim 1999
- Dörner, Klaus: Aufbruch der Heime. Verlag Jakob van Hoddis. Gütersloh 1991
- Guender, Richard: Praxis und Methoden der Heimerziehung. Dt. Verein für Öffentliche und Private Fürsorge. Frankfurt am Main 1995
- Krüger, Heinz-Hermann/Rauschenbach, Thomas (Hrsg.): Einführung in die Arbeitsfelder der Erziehungswissenschaft. Leske + Budrich, Opladen 1995
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit über stationäre Erziehung?
Die Hausarbeit untersucht die Veränderungen der Institution Heim im Laufe der Jahre. Sie betrachtet verschiedene Heimformen von mittleren und großen Heimen bis hin zu aktuellen Formen wie Wohngruppen und betreutes Wohnen. Dabei werden sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch statistische Angaben zur aktuellen Situation berücksichtigt. Der Fokus liegt auf dem Heim als Institution und nicht auf den sozialarbeiterischen Aufgaben.
Was waren die Merkmale von mittleren und großen Heimen?
<Mittlere und große Heime, oft als "Kinderheime" bekannt, wurden als "totale Institutionen" betrachtet. Sie wiesen Hierarchien, Reglementierungen und Heimordnungen auf, die oft nicht den Bedürfnissen der Kinder entsprachen. Dies führte zu Anpassung, Lethargie und dem Erlernen von Umgehungsstrategien. Die Kinder hatten wenig Möglichkeit, Selbstständigkeit zu erlernen, und es gab eine Tendenz zur Stigmatisierung.
Was war die Kritik an der Heimerziehung Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre?
Kritisiert wurde die Größe der Gruppen, die fehlende Dezentralisierung, die mangelnde Beteiligung der Kinder an Entscheidungen und die Dominanz der Verwaltung über pädagogische Belange. Gefordert wurden kleinere Gruppen, die Regionalisierung von Heimen und die Demokratisierung der Heimerziehung.
Was sind Kleinheime und wie unterscheiden sie sich von Großheimen?
Kleinheime sind Heime kleineren Umfangs, die kaum Heimcharakter haben. Die Gruppen sind kleiner, und die Erzieher leben oft dort. Sie sind meist in Wohngegenden integriert, was den Abbau von Vorurteilen begünstigt. Regeln entstehen aus den individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen, und es wird Wert auf Selbstverantwortung und Elternarbeit gelegt.
Was sind Außenwohngruppen?
Außenwohngruppen sind Gruppen, die aus dem großen Heim in andere Gebäude verlegt werden, oft Einfamilienhäuser oder Etagenwohnungen. Sie bieten Alltags- und Realitätsnähe. Die Jugendlichen versorgen sich selbst, können aber Serviceleistungen des Stammheimes in Anspruch nehmen. Ziel ist die unauffällige Integration in ein normales Wohnumfeld.
Was sind Wohngruppen/Wohngemeinschaften?
Wohngruppen sind selbstständige Institutionen der stationären Jugendhilfe. Die Aufnahme ist freiwillig, und die Jugendlichen müssen sich selbst versorgen. Die Regeln entstehen durch die Selbstbestimmung der Bewohner. Es werden keine Serviceleistungen in Anspruch genommen.
Was ist Betreuung in Tagesgruppen?
In einer Tagesgruppe arbeitet ein Erzieher mit drei bis vier Kindern zusammen. Es werden spezifische heilpädagogische Methoden angewendet, um die stationäre Heimunterbringung zu vermeiden. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule ist von großer Bedeutung.
Was ist Betreutes Wohnen?
Jugendliche und junge Volljährige, die zuvor in Heimen oder Wohngruppen gelebt haben oder mit der Heimerziehung nicht zurechtgekommen sind, leben in einer eigenen Wohnung und erhalten Beratung und Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte, um sich weiter zu verselbstständigen.
Was ist Intensive sozialpädagogische Einzelhilfe?
Jungen Menschen, die mit sich selbst und ihrer Umwelt nicht zurechtkommen, wird geholfen. Sie haben oft keine Frustrationstoleranz und keine persönlichen Perspektiven. Sie leben entweder in einer eigenen Wohnung oder bei den Eltern.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten für die Heimerziehung?
Die Heimerziehung ist im § 34 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) verankert, wo gesagt wird, daß den Eltern ein Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung zusteht. Seit der Jugendhilfereform im Jahre 1990 ist es eine freiwillige Maßnahme.
Was sind die Ziele der heutigen Heimerziehung?
Die heutige Heimerziehung legt großen Wert auf die reale Orientierung von Kindern und Jugendlichen und zielt auf eine milieunahe Unterbringung. Die Wohnräume und Ausgestaltungen orientieren sich an den Bedürfnissen der Bewohner, und die Gesamtatmosphäre soll Geborgenheit und Wohlbefinden unterstützen.
Welche statistischen Angaben werden zur Heimerziehung gemacht?
Die Hausarbeit gibt statistische Angaben zur Fremdplazierung und Heimerziehung in Deutschland. Es werden Zahlen zum prozentualen Anteil fremdplazierter Kinder und Jugendlichen, zur Art der Unterbringung (Heim, Pflegefamilie, Tagesgruppe) und zur Dauer der Unterbringung in Heimen angegeben.
- Quote paper
- Sandra Hutter (Author), 2000, Das Heim - eine Form der stationären Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104507