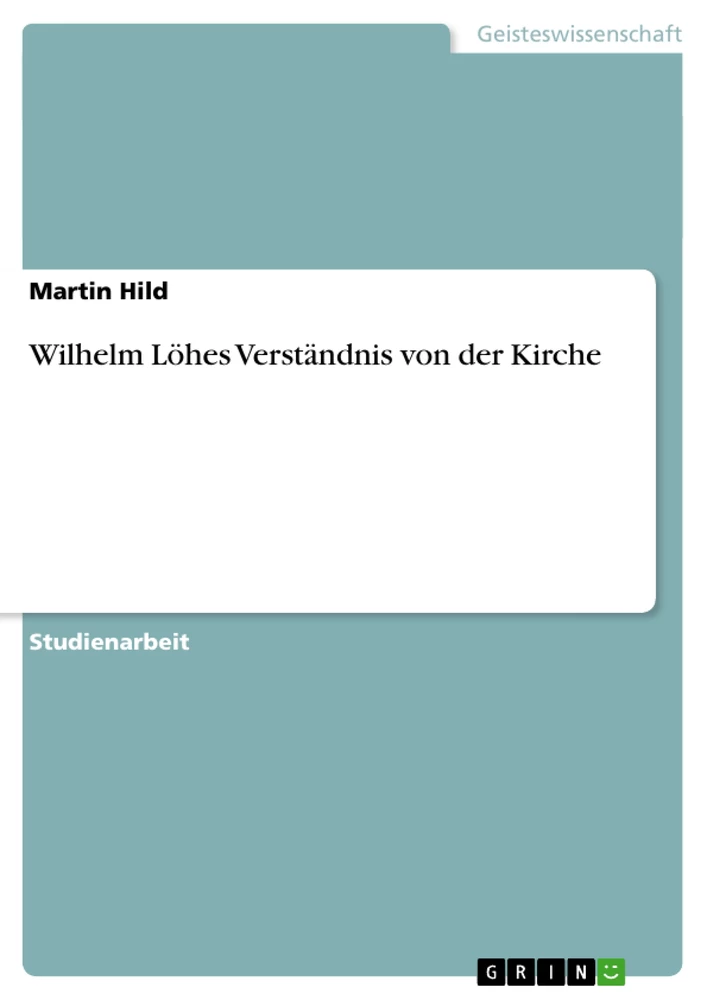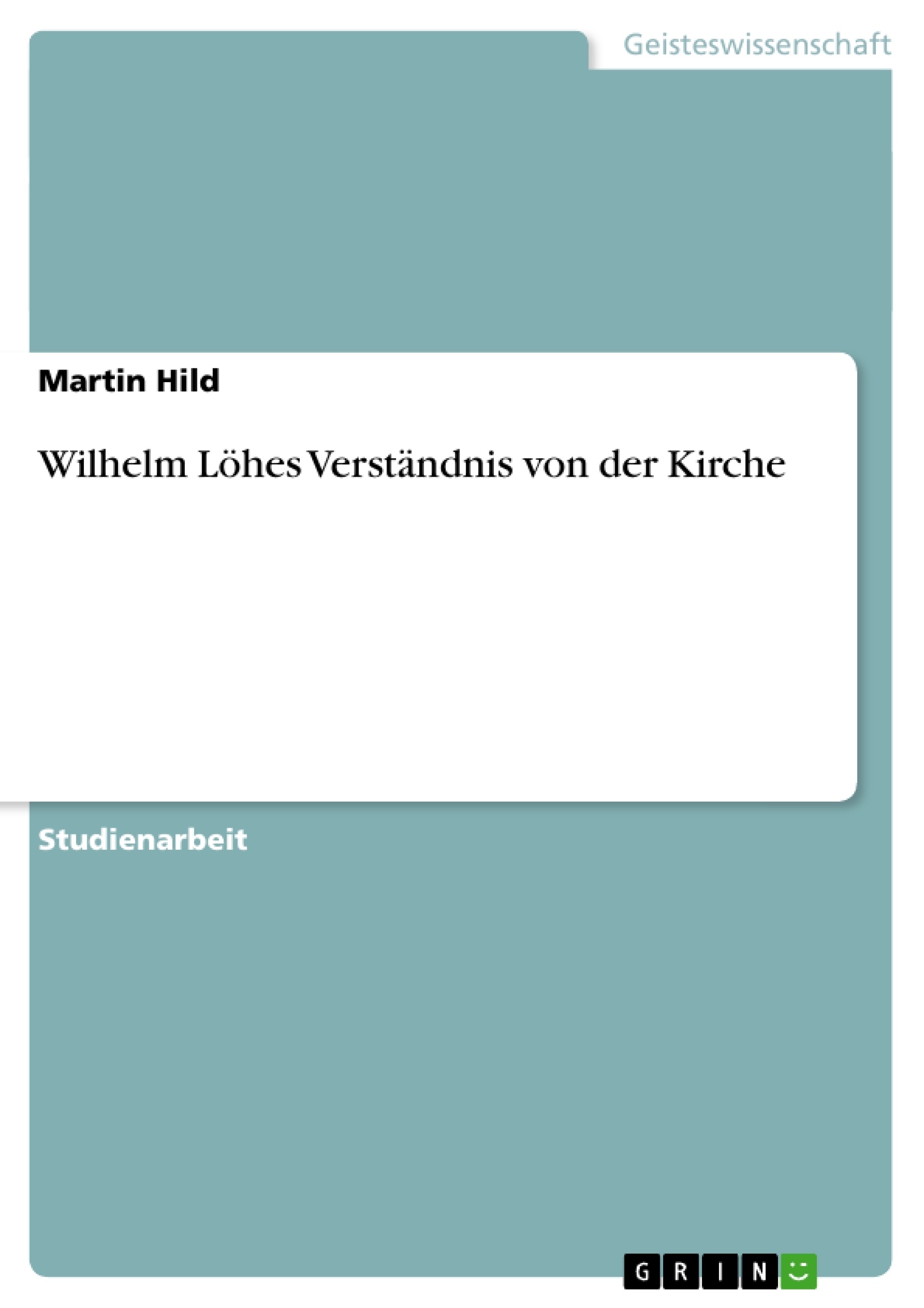Inhalt
1 Einleitung: Kirchenvater Wilhelm Löhe
1.1 Biografische Linien
a) Vertrautheit mit dem Tod
b) Ästhetischer Sinn
c) Sichtbarer Glaube: Bekenntnis, Mission, Diakonie
d) Charismatisches Dienen
e) Organisches Denken
1.2 Die Zeitsituation der »Drei Bücher von der Kirche«
2 Darstellung und Kritik der »Drei Bücher von der Kirche«
a) Entstehungsgeschichte
b) Quelle
c) Gliederung
d) Stil
e) Vorwort
2.1 Buch I Von der Kirche
a) Die Eine, heilige, katholische Kirche
b) Die Kirche ist apostolisch: Sie kommt aus dem Wort Gottes
c) Die Gestalt der Kirche ist eine sichtbare
2.2 Buch II Von den Kirchen
a) Die Partikularkirchen
b) Die vorzuziehende Partikularkirche ist die lutherische Kirche
2.3 Buch III Von der lutherischen Kirche
a) Der Gehalt der lutherischen Kirche
b) Die Gestalt der lutherischen Kirche
c) Die Hoffnung der lutherischen Kirche
3 Ansätze zur Würdigung von Löhes Kirchenlehre
3.1 Löhe als Kirchenmann des Luthertums
3.2 Löhe als Verfechter des lokalen Gemeindeprinzips
3.3 Der sakramentale Ekklesiologe Löhe
3.4 Versuch einer ästhetisch-biografischen Würdigung
4 Schlußbemerkungen
5 Literaturverzeichnis
5.1 Verwendete Primärliteratur
5.2 Verwendete Sekundärliteratur
a) Zur Person
b) Zur Sache
1 Einleitung: Kirchenvater Wilhelm Löhe
Man könnte Wilhelm Löhe wohl mit gutem Recht als einen lutherischen Kirchenvater des 19. Jahrhunderts bezeichnen. Seine Autorität und sein Charisma strahlten erstaunlich weit in die Welt hinaus aus dem damals kleinen und unbedeutenden Dorf Neuendettelsau. Nicht nur für die bayerischen, sondern auch für die Lutheraner im übrigen Deutschland und in Amerika war Löhe eine Gestalt, aus der sie Kraft bezogen, an dessen Eigenart sie sich aber auch rieben und so oft in Abgrenzung zu ihm ihre Identität bildeten. Es schien fast, als gäbe es da mit diesem Dorfpfarrer wieder einen ehrwürdigen Bischof der Alten Kirche, einen Basilius oder Gregor, der Wesentliches zu Lehre und Leben der lutherischen Kirche zu bekennen hatte. Und der auch eine klare und sichere Vorstellung davon hatte, was lutherische Kirche NICHT sei.
Um zu verstehen, wie Löhe so wichtig werden konnte für die lutherische Kirche und in welchem persönlichen und zeitlichen Zusammenhang er seine »Drei Bücher von der Kirche« schrieb, möchte ich in diesem Kapitel zunächst einige Linien seines Lebens nachzeichnen, dann die Zeitsituation etwas erhellen, in die hinein Löhe seine Persönlichkeit entwickelte und für die er die »Drei Bücher von der Kirche« schrieb.
1.1 Biografische Linien
Ich wende hier keine chronologischen Kriterien an, sondern versuche einige Merkmale von Löhes Persönlichkeit herauszuheben. Diese Persönlichkeit war ungeheuer markant, so daß es erstaunlich ist, daß bisher eigentlich nur der organische Charakter seines Denkens besonders untersucht wurde1. Für die Persönlichkeitsforschung eignet sich vor allem Deinzer2, der Löhe persönlich gut kannte und die ausführlichste Biografie erstellte. Zweck dieser biografischen Linien ist es, die Auswirkungen dieser Persönlichkeitsstruktur in der Kirchenlehre sichtbar machen zu können. Im Rahmen dieser Arbeit müssen einige Grundwahrnehmungen genügen, die hier auch nur bis in die Zeit der Verfassung der »Drei Bücher von der Kirche« gezeichnet werden: Vertrautheit mit dem Tod, Ästhetischer Sinn, Sichtbarer Glaube, Charismatisches Dienen und Organisches Denken.
a) Vertrautheit mit dem Tod
Wilhelm Löhe wurde am 21. Februar 1808 in Fürth geboren. Er stammt aus einer bürgerlichen Familie, die mehr angesehen als wohlhabend war. Sein Vater starb schon am 28. Oktober 18163. Immer wieder war er mit dem Tod in seiner Familie konfrontiert, was angesichts der 13 Schwangerschaften seiner Mutter an und für sich nicht ungewöhnlich ist. Er kam aber zu einem recht eigenartigen Verhältnis zum Tod.
Für ihn strahlte der Friedhof anscheinend eine erholsame Ruhe aus, einen tiefen Gottesfrieden. Immer wieder sucht er ihn auf: »Ist er daheim, so ist sein Lieblingsgang am Abend zum Gottesacker läßt er sich nieder, um dem armen Herzen Ruhe und Trost zu holen.«4 Für ihn scheinen die gestorbenen geliebten Menschen mit dem Tod nicht einfach ihre Existenz und Relation zu ihm zu verlieren.
Schon früh kann er sein eigenartiges, fast freundschaftliches Verhältnis zum Tod artikulieren, so 1821 nach dem Tod seiner epileptischen, aber bei allem Leiden tiefgläubigen Schwester Anna: »Beste Mutter! Freude mehr als Schmerz war die Empfindung beim Empfang Ihres Briefes, und eine Thräne derselben Empfindung lief über mein schreckenanzeigendes Gesicht, und warum sollte ich denn trauern? Ihr ist wohl, und sie als eine Todte, die in dem Herrn starb, ist selig. Ruhe denn auch sanft in der Erde kühlem Sande, ruhe sanft, und ruhe von den Leiden und Mühen Deines so kurzen Lebens. Dein Glaube hier Dein Lohn, dort das Schauen und freudig entzückende Anbetung des Lenkers der Schicksale. Du stehst am Throne, herbeigeführt durch seine heiligen Boten. Er der Göttliche, hat Deine Fackel niedergetaucht und zündet eine schönere an.«5
Dieses Verhältnis zum Tod ist geprägt von tiefem, feierlichem Ernst. Und der Tod begleitet ihn auch weiterhin, bleibt ihm vertraut und zugleich schrecklich. Am schlimmsten trifft ihn der Tod seiner geliebten, fast vergötterten Frau Helene (geborene Andreae), mit der ihm nur die glücklichen Jahre 1837-1843 vergönnt waren. »Alljährlich begieng Löhe den Todestag Helenens mit stiller, ernster Feier. In dem Sterbegemach Helenens waren dann die Vorhänge niedergelassen und auf dem Hausaltar brannten die Kerzen von Morgen bis Abend.«6
Bei allem Schrecken nahm er doch den Tod wie etwas zum wahren Leben dazugehörendes an. Der Tod scheint für ihn wie ein Vorzeichen von Vollendung und Eschaton zu sein: »Was hat mich in solchen Fällen die reiche Fülle der Offenbarung über das Leben nach dem Tode, das selige Seelenleben, erfreut und getröstet! Der Schmerz um Heimgegangene war die Anfechtung, welche mich lehrte, auf dies Gebiet des Wortes zu achten. Ich genas an Gräbern von dem Spiritualismus der alten Lutheraner, und der Todesschmerz, an Gräbern der Meinigen gefühlt, erschloß meine Seele für alle Freuden unserer großen `Hoffnung`. Die Zukunft hier, die geschichtliche, und dort, die ewige, ist die Gegengabe geworden, welche mir der Herr schenkte, wenn er mir ein liebes Angesicht nach dem andern entzog.«7 In diesem Bewußtsein vermochte er auch an Sterbebetten immer wieder echten und heilsamen Trost zu spenden, so daß »Löhe bekannte, daß er seine seligsten Stunden an Sterbebetten seiner Pfarrkinder verlebt hatte.«8 So schien es ihm denn im Rückblick 1866 in einem Aufsatz »Der Tod zu Dettelsau«, »...daß der Tod zu Dettelsau vom Herrn schon oftmals ganz besonders gesegnet und wie ein Erweis und eine Blüte des schönsten Lebens hingestellt wurde.«9
b) Ästhetischer Sinn
Von klein auf fühlt sich Löhe zum stillen Reichtum der Natur hingezogen. Er erfährt über sich aus Erzählungen seiner Familie: »Ich sei ein ganz artiges, stilles, frommes Knäblein gewesen, voll Lieb und Lust zu meiner Mutter ... Ich war erbärmlich schüchtern und zitterte auch vor fremder Strafe.«10 So liebte er die einsame Stille und Wahrnehmung seiner heimatlichen Landschaft, selbst am Tag seiner Konfirmation, während die anderen Kinder fröhlich feierten: »Es war ein herrlicher Abend worden. Alles blühte - wie schön. Außen vor Fürth, auf der Westseite, bildet ein Teich mit dem Flusse fast eine Insel. Da war ein Erlenwäldchen voll schöner Wiesenblumen und üppigen Grases. Dahin gieng ich in meiner Jugend gern und that es auch an jenem Abend. Alles feierte, ich konnte gut lesen und beten: war es doch eine Festzeit wie noch nie.«11
An landschaftlicher Schönheit konnte er sich immer, auch auf langen Fußreisen durch Deutschland, begeistern. Dagegen muß er in Neuendettelsau sehr leiden an der Kargheit der Landschaft und spricht bei seinem ersten Aufenthalt dort: »Nicht todt möcht´ ich in dem Neste sein«12. Da er aber vergeblich sich um städtische Stellen bewirbt, schickt er sich in Gottes Fügung und gewinnt sogar der Landschaft von Dettelsau ein wenig ab, indem er die Geschichte der Landschaft erforscht und hierin einigen Reichtum entdeckt. »... vor seinem Geistesauge wurde die unbedeutende Gegend belebt und geweiht durch das Andenken an eine größere Vergangenheit, deren Schauplatz sie einst gewesen und deren Denkmäler noch von einstiger Größe und Gegenwart Zeugnis geben.«13
Diesen ästhetischen Sinn nutzt er vielfach auch im religiös-kirchlichen Bereich. So wird die Schönheit seiner Sprache vielfach gerühmt, besonders beim Predigen: »An hohen Festen ... schwebte auch seine Rede wie im Adlerfluge dahin und schien oft mehr Lobgesang und Anbetung als Predigt zu sein.«14. Zur Abfassung seiner Predigtsammlung, der Evangelien- Postille, überlegt er in einem Brief an einen Freund:»... hangt meine Seele doch an dem Gedanken, daß sich alles Wahre und Gute im Schönen vollenden müsse, und da hinaus geht
mir Alles. Es ist ein Schrei nach Vollendung in mir ... ob ich zum Inhalt die Form, die Form der einfältigen Schönheit gefunden.«15
Auch seine Agendenforschung ist bestimmt von der Suche nach dem Schönen, das allein der Wahrheit des Evangeliums angemessen ist. Und so »war es Löhe´s Bestreben, dem Hauptgottesdienste seine in der rationalistischen Zeit ihm abhanden gekommene liturgische Zier wieder zurückzuerstatten nach und nach suchte Löhe seine Gemeinde in den vollen liturgischen Reichtum der lutherischen Kirche einzuleiten.«16 Was das äußerliche betraf, sollte »... nun auch nicht unerwähnt bleiben, was er in äußerer Beziehung zur Verbesserung und Verschönerung der Kirchen und sonstigen heiligen Stätten, sowie der übrigen Stiftungsgebäude der Pfarrei, gethan hat.«17
Es war also ein tiefer Sinn dafür in Löhe, daß äußere Schönheit aus der inneren Schönheit der Wahrheit des Evangeliums hervorstrahlt. Die Bewunderung der Schönheit von Natur und Geschichte wird für ihn relevant in Verbindung mit der Wahrnehmung, daß Natur Schöpfung Gottes und Geschichte Heilsgeschichte ist.
c) Sichtbarer Glaube: Bekenntnis, Mission, Diakonie
Löhes Mutter und Vater erzogen ihn in altem treuem pietistischen Glauben ganz gegen den Rationalismus der Zeit. So zieht sich auch eine große Kontinuität durch seine Glaubenszuversicht, die kaum einmal angegriffen wurde. So beschreibt er bezeichnenderweise als seine größte Anfechtung einen Zweifel an der Existenz der Engel in seiner Schulzeit: »Einmal wankte auch mein Glaube. Ich hörte so Viele zweifeln an dem, was ewig ist, daß es mir fast schien zum guten Ton zu gehören, ein wenig zu zweifeln. Ich besann mich, woran ich zweifeln sollte, und fand, es gienge am leichtesten, ungestraftesten, an den Engeln... Bei Tisch ... sprach ich meine Zweifel dahin... Als ich in meine Stube gieng, schämte ich mich des elenden Treibens.«18
Allerdings machte dieser Glaube doch einige Entwicklungsstufen durch: Der einfache pietistische Glaube des Elternhauses wurde in der Universitätszeit unter dem Einfluß des reformierten Erlanger Professors Krafft stark in die Erweckung hineingezogen. Zu dieser Zeit tritt er denn auch Missionskränzlein und Bibelgesellschaften bei. Dann wieder wird der lutherische Glaube in ihm stark, wie er ihn bei den altprotestantischen Dogmatikern sich anliest.
Sein Glaube ist stets ein bekennender und so zutiefst missionarisch. So ist auch die Diakonie für ihn eine zutiefst missionarische und bekennende. An diesem Glauben hat sich dann auch christliches Leben auszurichten: In (Abendmahls-) Zucht, (Güter-) Gemeinschaft und (geistlichem) Opfer übt die Gemeinde ihren Glauben. Diese Gedanken führt er aber erst nach 1845 systematisch in der Öffentlichkeit aus. Zunächst hat ihn Gott »in die Gemeinde gewiesen, in der er zum Gestalter der Inneren Mission im Sinn der Lutherischen Kirche werden sollte. Das war nicht sein Programm, als er 1837 dort aufzog sein Ziel war, den verschütteten Reichtum des evangelischen Gottesdienstes wieder freizulegen und Wort und Sakrament als die beiden Gipfel im Gottesdienst zum Leuchten zu bringen. Das lutherische Bekenntnis war ihm dafür die unentbehrliche Richtschnur.«19
Hebart faßt die Kontinuität seines Glaubens so zusammen, »daß die Grundprinzipien der lutherischen Reformation zu allen Zeiten auch die Löhes waren. Schriftmäßigkeit war ihm oberstes Gesetz... Zum anderen wurde all sein Denken, auch das über die Kirche, stets von der lutherischen Rechtfertigungslehre getragen ... Trotz der zugegebenen Entwicklungsfähigkeit bekannte er sich zu sämtlichen Symbolen mit quia.«20
d) Charismatisches Dienen
In der Schule gewann er auf einmal an Autorität und Verständnis. Von da an war er immer der Beste seiner Klasse: »Bis in mein zehntes Jahr habe ich trotzdem, daß ich über alles urteilte, in Schulen wenig Lob geerntet. Von da an stand ich bis zur Universität meinen Mitschülern voran.«21 Dennoch bleibt er aber auch hier in gewissem Maße einsam, schließt sich auch an der Universität den Freuden der Mitstudenten nicht an. »Löhe studierte fleißig ... Das Studium der Theologie eröffnete ihm also neue und zugleich verschiedene Perspektiven: Neben die Aufklärung trat die Erweckungsbewegung und neben die Mystik das Luthertum Wenig Einfluß besaß auf ihn dagegen das studentische Leben ... Er war vielmehr ganz stark auf seine eigene Arbeit konzentriert und weder ein Freund des Tabaks noch des Biers.«22
Löhes Vorliebe für das Pfarramt begann früh: Mitschülern hielt er Predigten, seine Mutter bestärkte ihn im Wunsch, einst Pfarrer zu werden. Interessant ist das Verständnis vom Amt, das er entwickelt. Er fühlt sich als zu seinem Amt von Gott Berufener und nimmt seine Berufung an. Die Ordination bleibt ihm immer unvergeßlich.
Dennoch wird ihm der Pfarrdienst nicht leichtgemacht. »Die Verwendungen Löhes im kirchlichen Dienst vor Antritt seiner ersten Pfarrstelle in Neuendettelsau im Jahre 1837 zerfallen in insgesamt zwölf Vertretungen, Vikariate und Aushilfen ... als Vikar in Kirchenlamitz ... stieß er auf zahlreiche Leerfelder der Volkskirche... Löhe engagierte sich weit über das übliche Maß ... Einige fühlten sich betroffen und reagierten negativ auf den übereifrigen Prediger. Sie bedienten sich des Landrichters, der Löhe beim Bayreuther Konsistorium verdächtigte und anklagte.«23 Solche Querelen mit der Kirchenleitung/ dem Staat begleiten ihn zumindest bis zum Amtsantritt Harleß´ als Präsident des Oberkonsistoriums immer wieder.
Seine Amtslehre war eigenartig unzeitgemäß: »Aus der Heiligen Schrift hat er den Nachweis zu erbringen versucht, daß nicht nur das Amt, sondern auch der Berufsstand göttlichen Ursprungs ist. Er führt das auf das in den apostolischen Kirchenordnungen des Neuen Testaments enthaltene göttliche Element zurück.«24 Die berühmten Streitigkeiten um sein Amtsverständnis mit den Erlanger Theologen und der Missouri-Synode beginnen erst nach den »Drei Büchern von der Kirche«.25
Es geht Löhe dabei aber immer um die Würde des Amtes, das aus seiner Funktion der Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung hervorgeht, nicht etwa um »die Macht des geistlichen Amtes«26. Es ist eine sanfte, wort- und liebegebundene Kraft, die Löhe, mit natürlicher und geistlicher Autorität begabt, ausübte und forderte: »Löhe geht von einer Kirche aus, die zugleich sichtbar und unsichtbar ist ... Es gibt ´eine göttliche Heilsordnung und etwas Göttliches in der apostolischen Kirchenordnung´ ...Eine Kirchenordnung, die dergestalt der Heilsordnung dienstbar ist, kann niemals zum Zeremonialgesetz und zur Bedrohung des Rechtfertigungsglaubens werden ... Die Sakramente empfangen ihre Kraft nicht vom Amt; dieses ist vielmehr lediglich Diener der Gnadenmittel.«27
Kirchenzucht fordert er allein um der Liebe willen: »Die Kirche hat die von der Liebe Matth. 18 gebotene Zucht so lange liegen lassen, daß man ihr das Recht, dieselbe zu üben ,von nicht wenigen Seiten her völlig abstreiten wird Allein die Schuld, welche so viele durch ihren Abendmahlsgenuß auf sich laden, - die Liebe zu den Seelen, denen das heilige Mahl nur dann mit Segen wird gereicht werden können, wenn man ihnen zuerst verwehrt hat, es im Unsegen zu nehmen, - der Gehorsam gegen Matth. 18., - die Verantwortung der Seelsorger, - der Vorgang der Väter, - die nicht geringe Entwürdigung des heiligen Mahles, wie sie sich jetzt unwidersprechlich häufig findet, - - sind, andere Dinge zu verschweigen, Gründe genug, das Gute zu tun und darüber zeitliche Unruhe zu leiden und Haß zu tragen.«28
Eine Besonderheit ist noch zu erwähnen: Erwartete Löhe von der Ordination die Übertragung einer besonderen Amtsgnade, so bestärkte ihn die Fülle seiner eigenen Talente in bezug auf das Amt, ob in Predigt, Katechese, Seelsorge, Mission oder Diakonie noch mehr in seinem Amtsverständnis, das letztlich alles von Gott erwarten konnte. Das geht soweit, »daß Löhe an eine Fortdauer der Charismen in gewissem Maße glaubte und daß er namentlich dem Jac.5 befohlenen Amtsgebet an Krankenbetten eine besondere Kraft und Erhörlichkeit zuschrieb. Sein Glaube half ihm zu reicher Erfahrung dieser Art und die Erfahrung bestätigte rückwirkend wieder seinen Glauben.«29 Tatsächlich wird in bezug auf Kranken- und Bessenenheilungen von einer »großen Zahl wunderbarer Gebetserhörungen, die Löhe erfahren durfte«30, berichtet.
Somit ist sein Amt für Löhe der von Gott angeordnete Lebensberuf und erfüllt von Verantwortung: Die Heilsmittel, die ihm mit dem Amt übergeben wurden, verpflichten ihn zur möglichst vollkommenen Ausbreitung und Verwaltung von Wort und Sakrament. Die Amtsgaben verpflichten ihn zum treuen Hirtendienst an seiner Gemeinde. Die apostolische Kirchenordnung gibt ihm zusätzliche Möglichkeiten, etwa in bezug auf Diakonie, Mission oder Seelsorge (Krankensalbung und Beichte) vor, die anzuwenden er sich verpflichtet fühlt. Dabei fühlt er sich zugleich immer aus dem Evangelium ermahnt, zu dienen statt zu herrschen. Angesichts dieser Fülle von Aufgaben steht selbst ein begnadeter Kirchenmann wie Löhe vor sich selbst unvollkommen und sündig da.
e) Organisches Denken
»Löhe war sein Leben lang in außergewöhnlicher Konsequenz mit einem einzigen Thema beschäftigt: mit dem ´Gedanken einer fortschreitenden organischen Entwicklung der Kirche und insofern auch einer Fortbildung des Luthertums´«31. Über dieses organische Denken (das eng verflochten ist mit seiner Kirchlichkeit) und dessen Ursprung gab es einigen Streit:
Hebart stellte einst dazu die Sätze auf: »Daß Löhe von Anfang an einen organischen Kirchenbegriff hat, ist bei ihm selbstverständlich. Bei Scheibel und Vilmar mag das organische Denken auf den Einfluß der Romantik zurückzuführen sein. Löhe war es angeboren. Ein Mann, der so geschichtlich von Jugend auf dachte, wie er, und so an Volk, Familie und Sippe hing, mußte organisch denken.«32 Für Hebart kommt dieses Denken rein aus dem biblischen Denken heraus und er belegt dies unter anderem mit Zitaten von Briefen von 1828, 1834 und 1841: »Die Gemeinschaft der Heiligen ist ein Leib, dessen Haupt Christus ist. Christus ist der ewige Weinstock, in den die Gläubigen durch den Heiligen Geist eingepflanzt werden, er ist der Leib, an dem sie durch die Taufe Glieder werden Ja sie bilden eine Gemeinde, die auch mit den vollendeten Heiligen im Jenseits eins ist«33. Somit ist Hebart wieder beruhigt, daß Löhe ein echter Lutheraner ist, denn diese »Gedanken Löhes über das Wesen der Kirche sind im Grunde eine Wiedergabe der Lehre der lutherischen Bekenntnisse und der alten Dogmatiker.«34
Kantzenbach dagegen macht geltend, daß der Organismusgedanke Löhes »in Anknüpfung an die zeitgenössischen Verwendung der Organismusvorstellung auf die Dogmengeschichte geschieht und nicht etwa durch episodische Lehrstreitigkeiten, in die Löhe hineingezogen wurde, bedingt ist Gerade Löhes Entwicklung zum sakramentalen Luthertum ... hängt mit dem Organismusdenken zusammen.«35 Kantzenbach stellt die Frage, »ob eine mit Hilfe des organischen Entwicklungsdenkens geltend gemachte theologische Fortbildung ohne weiters als biblisch bezeichnet werden kann.«36
Zunächst hebt Kantzenbach Löhes Ergriffenheit vom Totaleindruck der Natur schon in der Kindheit hervor, auch die Liebe zur Geschichte. Deshalb operiere Löhe dann auch mit organischen Bildern aus der Natur und betone die schon geschehenen geschichtlichen Ergebnisse der Vergangenheit. Aus diesem organischen Denken heraus ergäbe sich dann auch die spätere Fortentwicklung von Löhes Kirchendenken von einem rein konfessorischen hin zu einem sakramentalen: »Die Reserve gegenüber einem nur schriftlich geltenden Bekenntnis wuchs bei ihm in dem Maße, wie das sakramentale Luthertum in ihm Gestalt gewann.«37 Kantzenbach hebt dann die Bedeutung des organischen Denkens für Löhes Ekklesiologie, Amtslehre, Eschatologie und Sakramentenlehre hervor und kommt zum Schluß: »Löhes sakramentales Luthertum als ausgesprochener Konfessionalismus ist ein Ergebnis des für das Neuluthertum typischen organischen Denkens.«38 Diesen Konfessionalismus wertet Kantzenbach negativ ab: »Löhes grundsätzliches Mißverständnis besteht darin, daß er das Bekenntnis, besser die theologische Meinung, an die Stelle setzt, die die Gnadenmittel allein in Anspruch nehmen können, so daß die Kirche Christi mit einer Konfessionskirche verwechselt zu werden droht.«39 So führt also Kantzenbach den Beweis des Organismusdenkens Löhes, bleibt aber das schuldig, was ja eigentlich seine Anfrage war: Ist dieses Denken nun reformatorisch/biblisch oder nicht?
Fagerberg hebt hingegen die positiven Aspekte des konfessionellen Organismusdenkens hervor: »Die konfessionellen Theologen konnten mit Hilfe dieses Entwicklungsgedankens auf drei falsche Aspekte hinweisen. Der erste ist vorhanden, wenn man die Existenzberechtigung des Bekenntnisses verneint, der andere, wenn man behauptet, einen Entwicklungsgedanken zu vertreten, der doch in der Praxis eine Aufhebung der angenommenen Symbole bedeutet. Der dritte liegt vor, wenn man ein starres Festhalten an den angenommenen Lehrformeln fordert. Auf Grund der alten Bekenntnisse ist Entwicklung möglich und wünschenswert. Die bestehenden Symbole bilden ja ein organisches System, welches in keiner Weise eine Entwicklung ausschließt. Im Gegenteil setzt dieses System Wachstum und Reife voraus. Doch das Neue ... muss auf dem alten Stamme wachsen.«40 Den letzten Aspekt hatte Löhe zur Zeit der »Drei Bücher von der Kirche« noch zu stark betont, hörte aber hier auf die Kritik der Erlanger konfessionellen Theologen (und so wurde Löhes eigene Entwicklung zum sakramentalen Luthertum erst möglich).
Man könnte von einer Überbetonung von Kirche und damit des dritten Glaubensartikels bei Löhe sprechen. Das war sicher der Fall. Dennoch war dieser Artikel für ihn untrennbar mit den beiden ersten verbunden. Das sichtbare Leben als Kirchenmann, das ihm so sehr zu eigen ist, war aber immer ein Ausleben, ein Sichtbarmachen des dritten Artikels.
Markant dafür ist da z.B. der Grabstein Löhes, der mit diesem Artikel geschmückt ist.41 Allerdings rührt das wohl auch einfach von den letzten Worten seiner Frau her: »Sie rief laut und mit dem ihr eigenen freundlichen, edlen Ernst: ´Ich glaube an den heiligen Geist, Eine heilige, christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben! Amen.´... Endlich - gieng ihr der Herr entgegen. Sie entschlief unter dem lauten, gemeinsamen Segen der anwesenden Priester und Hausgenossen. Ich dankte ihr für die zahllosen Wohlthaten ihrer aufopfernden Liebe, - ich wurde der ärmste unter der Sonne, während sie ewigen Reichtum ererbte.«42
Berühmt wurden einige Äußerungen, in denen er gegen Lebensende zusammenfassend sein Wirken und Wollen in bezug auf Kirche zusammenfaßte: »Wenn ich höre, daß irgendwo eine bessere Kirche entsteht als die lutherische, so verschreibe ich mich sterbend noch der neuen Kirche, noch fünf Minuten vor dem Tod Wenn man wissen will, was wir eigentlich wollten ..., so muß man die Diakonissenanstalt ansehen, nur daß man nicht blos an Schwestern denken müßte. Wir wollten eine apostolisch-episkopale Brüderkirche Worin wir aus voller Seele lutherisch sind, das ist das Sacrament und die Lehre von der Rechtfertigung Wir sind ganz antik und ganz modern. Eine Fortbildung des Luthertums zu einer apostolisch-episkopalen Brüderkirche - das ists, was wir im letzten Grunde wollten.«43
1.2 Die Zeitsituation der »Drei Bücher von der Kirche«
Nachdem Anfang des Jahrhunderts noch die Aufklärungstheologie alles beherrschte, hatte die Erweckungsbewegung um 1825 gewaltig um sich gegriffen. Diese war zunächst ökumenisch gesinnt, wie auch die Aufklärung und hatte auch den Subjektivismus mit ihr gemeinsam. Zeitgleich erstarkte die geistliche und organisatorische Kraft der römisch-katholischen Kirche nach jahrhundertelanger Lähmung wieder, trotz oder gerade wegen der verheerenden Macht- und Vermögenseinbußen durch die Säkularisation. Doch während auf der reformierten Seite im Gefolge Schleiermachers (um die Jahrhundertmitte dann Wicherns) der Gedanke der Union, der Gedanke einer deutschnationalen Kirche übermächtig wird, treten viele Lutheraner, die sich 1830 zum Jubiläum der CA an ihre Konfession erinnerten, der Konfessionsmengerei entschieden entgegen. Löhe und die Erlanger Theologen waren sich hier einig. Und der Kreis um Löhe unterstützte sogar die lutherischen Freikirchen, die sich im Kampf gegen die Union in Preußen und anderswo in Deutschland bildeten: »Gegen die Mitte der dreißiger Jahre befaßte sich LÖHE intensiv mit ihm (Scheibel, eig.Anm.) und den Ereignissen in Schlesien Löhe teilte die ekklesiologischen Grundsätze Scheibels, das Gemeindeprinzip und die Forderung nach einer Bekenntniskirche.«44 Innerkirchlich kämpft Löhe für die Erneuerung der alten lutherischen Liturgie (gegen Aufklärungs-Agenden), Seelsorge (gegen Zuchtlosigkeit und Moralismus), Predigtweise (gegen historisch-kritische Prediger als Irrlehrer) und Katechese (Luthers kleiner Katechismus).
Löhes Stellung zu seiner Zeit wird z.B. an seinen Beiträgen im Homiletisch-Liturgischen Correspondenzblatt deutlich, in dem er um 1837 bestimmend tätig war. »Löhe brachte eine längere Aufsatzserie heraus... Der Verfall der Kirche wurde auf den Verlust der schriftgemäßen Lehre und ein damit verbundenes ungeistliches Verständnis des Amtes zurückgeführt Die eigene Zeit wurde grundsätzlich als Zeit des kirchlichen und moralischen Verfalls dargestellt. Möglichkeiten, diesen Verfall aufzuhalten, sah man in einer strengen Ordnung der Zulassung zum Abendmahl und in der Einführung der persönlichen Beichte.«45 Zu dieser Zeit war zumindest in der Pfarrerschaft (nicht so in den staatlich ernannten Konsistorien) ein klarer Zug Richtung Konfessionalismus erkennbar. Deshalb »gehörten die Gegner meist zur staatlichen Beamtenschaft Galt der Rationalismus auch in der Pfarrerschaft allgemein als illegitim, so dachten doch Beamte oft noch rationalistisch.«46
So spiegelt Löhes innere Entwicklung in gewissem Maße die Paradigmenwechsel der Theologie wieder, blieb dabei aber immer organisch verbunden mit dem Früheren und gewinnt daraus ihre Unabhängigkeit gegenüber dem Zeitgeist der Theologie. »Mit dem Jahre 1841 war die innere Entwicklung des jungen Löhe abgeschlossen. Von einem bewußten Luthertum hatte er sich durch das Stadium eines irenischen Konfessionalismus zu einem entschiedenen, konfessionell gerichteten Luthertum hin entwickelt. Er war bereit, wenn nötig, durch offene Polemik das Erbe der Väter zu verteidigen gegen jeglichen Indifferentismus im Bekenntnis. Der anfänglich stark bemerkbare Einfluß der Erweckungsbewegung mußte dieser starken lutherischen Linie immer mehr das Feld räumen. Das offene Bekenntnis zu Spener und seinem ehrlichen Wollen verband sich mit dem lutherischen Denken. In der immer wiederkehrenden Mahnung zur reinen Lehre und zum reinen Leben begegnen wir dieser Verbindung Voran aber, als Ziel allen Denkens und Handelns, steht die Idealgestalt der communio sanctorum.«47
2 Darstellung und Kritik der »Drei Bücher von der Kirche«
a) Entstehungsgeschichte
Die Idee, ein Buch über die Kirche zu schreiben, bekam Löhe im Jahr 1843. Einerseits war er schon im Zusammenhang mit der Mission mit dem Thema der Kirche konfrontiert worden. Andererseits hatte er mit seiner Frau nach dem gemeinsamen Besuch einer Betstunde über die Kirche geredet: »Wir verweilten bei dem Gedanken, daß die heilige Kirche einem langen Pilgerzuge gleiche, deren erste Scharen schon in Zion seien, während die anderen noch hienieden wallen.«48
Er hielt dann im Winter 1843/44, auch nach dem Tode seiner Frau, weitere Betstunden zum Thema Kirche. Eine weitere Motivation wird in in einem Brief vom 2. April 1844 deutlich: »Die Idee von Einer heiligen allgemeinen Kirche durchdringt mich ... Ich ärgere mich über das viele Herumreden und Deduzieren, das doch nur ein Beweis ist, daß wir die Perle noch nicht geschaut, noch gefund. Mit unserer Wissenschaft!«49
Im Dezember 1844/Januar 1845 hat er das Manuskript seiner Schrift »Drei Bücher von der Kirche. Den Freunden der lutherischen Kirche zur Überlegung und Besprechung dargeboten« fertig und sendet es an seinen Verleger Liesching. Im Februar/März 1845 ist es bereits gedruckt. Er überlegte noch, den Untertitel so zu gestalten, daß es als erstes Buch einer Pastoralsammlung erscheine, war sich aber zu unsicher, ob er dazu käme. Eine weitere verworfene Überlegung war, den »Zuruf an die deutsch-lutherische Kirche Nordamerikas« anzuhängen. Seinen Freunden Raumer und Scheurl wollte er die Schrift deshalb nicht widmen, weil er »befürchtete, es würde manch böses Wort über das Buch gesagt werden; davor aber wollte er seine Freunde bewahrt wissen.«50 Als mittelbare Anlässe vermutet Ganzert den Kniebeugungsstreit, die Amerikaarbeit und den Tod Helenes.51
Die Motive Löhes, die sich im Voraus für die »Drei Bücher« erheben lassen, sind also vielgestaltig. Im Zusammenhang mit der Amerikaarbeit/Mission war es wichtig, ein deutliches Bild von der zu schaffenden Kirche zu gewinnen. Zugleich war er unbefriedigt über die modernen wissenschaftlichen Versuche einer Definition von Kirche (die die Kirche einfach zu sehr in die Nähe einer allgemeinen soziologischen Erscheinung rückten). Aus dem oben gesagten zur Persönlichkeit Löhes scheint auch das Bild der Kirche zu folgen, wie ein Löhe sie eben entwerfen mußte: Eine Kirche diesseits und jenseits des Todes, eine schön anzuschauende Kirche durch alle Zeiten und Orte, eine ganz und gar biblische und bekennende Kirche, eine dienende, brüderliche Kirche mit allen Verheißungen, eine organische Gemeinschaft aller Heiligen mit dem Herrn der Kirche, Jesus Christus.
b) Quelle
Die verwendete Quelle ist die zweite Auflage von 1845. Fast alle Änderungen sind kleine Schönheitskorrekturen wie das Fettdrucken einzelner kleiner Wörter in Abschnitten, die insgesamt hätten fettgedruckt werden sollen. Lediglich auf einer Seite gab es etwas bedeutendere Änderungen52: Einerseits fügt Löhe eine irenische Fußnote zur Lehre von der allgemeinen Berufung an, andererseits ersetzt er, um die Autorität allein beim Wort Gottes zu lassen, die Bemerkung »Denn die Dogmatik ist über der Geschichte; die Geschichte aber würde der Dogmatik mitnichten widerstreben.« durch »Denn Gottes Wahrheit steht über den Ergebnissen geschichtlicher Forschungen; die Geschichte aber ... würde dem Worte Gottes mitnichten widerstreben.«
Es könnte noch einiges zur Wirkungsgeschichte (besonders zu Delitzsch: »Vier Bücher von der Kirche« und dem Brief Löhes an Delitzsch) gesagt werden, doch das würde im Rahmen dieser Arbeit zu weit führen.53
c) Gliederung
Die Schrift ist schlicht gegliedert: ein Vorwort, ein Psalm, dann 3 Bücher mit jeweils 10 Kapiteln. Dabei gliedert Löhe nicht streng dogmatisch, sondern eher wie in einem biblischen Brief: Er nennt am Anfang Anlaß und Adressat, dann beschreibt er die eine Kirche und ihren Grund, das Wort, dann kommt er zu der sichtbaren Kirche, damit zu den Partikularkirchen, unterscheidet unter diesen die lutherische Kirche als die besonders reine und ist so wieder bei den Adressaten, den Freunden der lutherischen Kirche angelangt, um ihnen einige Paränesen zu liefern, wie denn die lutherische Kirche auszusehen habe. Er schließt mit dem Blick auf die Hoffnung der Kirche und einem Schlußgebet.
d) Stil
Aus der Gliederung ergibt sich bereits, daß hier keine dogmatische Abhandlung vorgelegt wird, sondern ein Bekenntnis Löhes zu seinem Kirchenbegriff. Diesen bildet er organisch aus dem, was ihm in Bekenntnis und Schrift schon vorgegeben ist: (Zum Gedanken der Einheit der Kirche durch alle Zeiten und Orte) »Vielleicht spricht Du : ´Das ist nichts Neues.´ Aber ich habe auch nicht gesagt, daß es etwas Neues sei. Große Gedanken werden nicht in der letzten Stunde der Welt geboren, sondern der Herr gönnt sie seiner Kirche von Anfang Auch mir war der Gedanke dem Klang nach lang bekannt, als er mir neu wurde dem Verständnis nach...«54. Also sagt er neu, was ihm Kirche ist, in seinem ganz eigenen Stil. Dieser ist Löhes schöner brieflicher Stil (oft Anrede 2.Person, wie eben zitiert), der wie aus einem Guß von Gedankenassoziation zu Gedankenassoziation fließt. Dabei bleibt die ordnende Linie immer erhalten, ganz entsprechend der großen Sorgfalt und Strenge Löhes beim Briefschreiben.
Oft schwelgt Löhe in Bildern aus der Natur: »An Pfingsten, am Golgatha entsprungen geht durch die Zeiten herunter die Kirche wie Ein Strom - und derselbe Strom und kein anderer wird auch ferner unverändert durch die Zeiten gehen, bis er sich an jenem großen Tage in das hochberühmte Meer der ewigen Seligkeit vollends ergießen wird.«55 »Gleich einer schönen, wunderbaren Blume, sproßt die Kirche durch alle Zeiten herauf; aus einer Blüte kam von Anfang her immer wieder der Stengel einer neuen, der vorigen gleichartigen, herrlichen Blüte und eine neue Blüte selber. Zu verschiedenen Zeiten verschiedene Blüten Einer Blume, - das sind die verschiedenen Gestaltungen der Einen wahren Kirche in der Zeit.«56 »Die Schrift gleicht dem Sternenhimmel. Wer nur sein Auge vom irdischen Dunkel erhebt, der sieht sogleich jene großen, leuchtenden Sterne erster Größe und die Straße des Lichtes, welche den Himmel gürtet. Des Lichtes gewohnt sieht hernach das Auge der Sterne immer mehr. Endlich scheint auch die Bläue von Licht durchwoben zu sein. So kommen dem Auge des Lesers in der Schrift zuerst jene leuchtenden, mächtigen Sprüche entgegen, deren Sinn sich ohne Mißverstand und unleugbar darbeut. Je länger man gestärkt vom ersten Lichte liest, desto mehr Sprüche werden hell und klar.«57 Die Funktion dieser Bilder ist sowohl glorifizierend als auch pädagogisch.
Die Argumentation benutzt zahlreiche, oft auch längere Bibelzitate. Interessanterweise bleibt er immer beim Adressaten: Für die Rechtfertigungslehre legt er keine großen Schriftbeweise vor, die ist den »Freunden der lutherischen Kirche« gut bekannt. Hingegen die Lehre vom Wesen der Kirche ist ja doch eine gewisse Schwachstelle der Lutheraner, also belegt er hier alles gründlich vom Wort Gottes her. Man merkt dem Schreiber die Ehrfurcht vor dem Wort an, das er zitiert.
Der Stil ist oft poetisch. Hymnenartige Schlußpassagen, das Rühmen Gottes und Gebete finden sich immer wieder. Sie haben dabei immer engen Bezug zum Inhalt der Kapitel.
e) Vorwort
Im Vorwort betont Löhe die Notwendigkeit, das Thema Kirche recht zur Geltung zu bringen: »Alle reden in unsern Tagen von Kirche. Jedermann ahnt, daß Kirche kein bloßer Name sei. Die wenigsten aber wissen, was hinter dem Namen für ein liebes, lichtes Reich verborgen ist.«58
In einem Understatement stellt er heraus, daß es kein anderer getan habe, und er deshalb seine unvollkommene Arbeit tun müsse: »Wie oft hat der Unterzeichnete im Geschwätz der Meinungen gewünscht, ... daß einer einmal dem Publikum der sogenannten Gebildeteren unter den Christen ... die alte Lehre von der Kirche sagte!«59. Er schränkt die Gültigkeit seines Buches dahingehend ein, daß es nur für seine Zeitgenossen geschrieben sei. Damit kontrastiert er zugleich die ewige Gültigkeit des Wortes Gottes und der Kirche Gottes: »Aere perennius sei kein Buch als das Buch der Bücher und kein Werk als das, von dem wir reden, Gottes Kirche.«60
In einem irenischen Abschluß mahnt er zur Einheit: »Friede sei mit denen, die Ja sagen! Friede mit denen, die Nein sagen! Gottes Friede komme zu allen! Möchten wir alle im Frieden Eins, Eine Kirche, Seine Kirche sein!«61.
Als Leitwort stellt er über sein Buch Psalm 87. Das himmlische Jerusalem/Zion (für Löhe: die Kirche) wird darin verherrlicht als die von Gott geliebte ewige Stadt, in der auch die Heiden geboren sind, die Gott selbst baut und in der von der Herrlichkeit Gottes gepredigt und gesungen wird.
2.1 Buch I Von der Kirche
a) Die Eine, heilige, katholische Kirche
In den Kapiteln 1-4 hebt er die Würde und Herrlichkeit der Kirche hervor. Er nimmt dafür die alten Begriffsbestimmungen des Nizänokonstantinopolitanums una, sancta, catholica auf.
In Kapitel 1 (Wir sind zur Gemeinschaft und zur Kirche geboren) wehrt er zunächst jeden Subjektivismus ab: »Alleine mit Christo kannst du nicht selig sein... Es gibt keine einsame Erde und keinen einsamen Himmel, und wer eine völlige, sei´s zeitliche, sei´s ewige Trennung von allen Menschen wünschen kann, in dem ist die Liebe nicht, die aus Gott ist, sondern ein finstrer, hochmütiger Haß, beide, Gottes und der Menschen.«62
Die Kirche ist aber die höchste Form jeder menschlichen Gemeinschaft, weil »jede Gemeinschaft nur eine mißverstandene Weissagung und ein mehr oder minder vollkommener Schattenriß jener Einen von Gott gewollten, von Gott zur Ewigkeit berufenen Gemeinschaft ist Die Kirche ist die von Gott gestiftete ewige Gemeine und Gemeinschaft auserwählter Seelen untereinander und mit ihm.«63
Diese Kirche macht den unsichtbaren Gott und seinen Willen sichtbar: »Die Kirche ist der schönste Liebesgedanke des Herren, in welchem sich seine eigene Menschenliebe und die Liebe zu seinem Sohne mit enthülltem Antlitz zeigt In der Kirche singt und sagt man auch von dieser Herrlichkeit Gottes, die da Liebe heißt Die Kirche ist Vollendung, - hier wird alles erst, was es soll.«64
Dieses Kapitel schließt er mit einem Hymnus auf die Kirche:
»Siehe die Kirche! Sie ist der Gegensatz der Einsamkeit, - selige Gemeinschaft! Millionen Seliger und Gläubiger, die da selig werden, - und unter ihren Lobgesängen der Herr! - Nicht mehr einsam, sondern durchdrungen, befriedigt, - ja selig ist der, welcher Einer ist unter den Millionen, deren jeder Christum ganz und völlig und mit ihm Himmel und Erde hat!«65
Kritik: Löhe schwebt hier in den Sphären der himmlischen Kirche und des Willens Gottes. Das ist berechtigt angesichts einer Zeit, die Kirche nur als soziologischen Begriff bewertet, bleibt damit aber einseitig und auch ein wenig spekulativ. Da er biblizistisch denkt, glaubt er, »die ideale Kirchenverfassung sei dem Neuen Testament selbst zu entnehmen und als solche zeitlos gültig.«66 Den Kirchenbegriff Löhes prägen »daher, dem Trend Löhes zum Objektiven entsprechend, von Anfang an die Züge des Nichtindividualistischen, Objektiven, oder anders gesagt, der Reich-Gottes- und der Gemeinschaftsgedanke.«67
In Kapitel 2 (Die Gemeinschaft der Kirche ist Eine hier und dort) geht er auf die Art der Sichtbarkeit der Kirche in ihren Gliedern ein: »Ja, meine Augen liefern mir den Nachweis zu dem, was ich aus Gottes Munde weiß. Denn ich sehe ja um mich her in näheren und ferneren Kreisen so manche Menschen, welche ich für Gottes Kinder zu halten gute Gründe habe. Ich weiß es freilich nicht mit göttlicher Gewißheit, aber mit einer fast zuversichtlichen Wahrscheinlichkeit, daß der und jener unter meinen Freunden ein ewig gewonnenes Gotteskind ist.«68
Es gibt aber eine unsichtbare Einheit der pilgernden Kirche aus Lebenden und schon Gestorbenen aus allen Zeiten: »Die da leben im Herrn - und die in ihm außer dem Leibe wallen gehen, - die da pilgern, die daheim sind, - die da glauben, die da schauen, sind nicht zwei getrennte Herden Gottes, sondern Eine, Eine vor dem Herrn, Eine nach ihrer eigenen Erkenntnis«69.
Darum bekennt Löhe: »Also gibt es eine ewige Kirche, teils hier, teils dort befindlich. Hier wird sie immer kleiner, dort wird sie immer größer, weil immer mehr der wallenden, streitenden Schar zu ihrem Volke versammelt werden! Dieser ewigen Kirche möchte ich angehören!«70
Kritik: Da Löhe in Bezug auf die sichtbaren Glieder der unsichtbaren Kirche bewußt nur ein menschliches Wahrscheinlichkeitsurteil fällt, mag es angehen. Jedenfalls betont Löhe hier mit einzigartiger Bewußtheit die Einheit der Kirche, »und zwar eine Einheit sowohl in vertikaler (die Einheit zwischen ecclesia militans und ecclesia triumphans) als auch in horizontaler Hinsicht, denn er glaubt an eine Gemeinschaft der Gläubigen in Raum und Zeit.«71
In Kapitel 3 (Die Kirche ist Eine in allen Zeiten) geht er weiter auf die unsichtbare Einheit ein: Die Kirche ist eine organische Kirche durch alle Zeiten bis zum Weltende, denn »in allen Zeiten sondert sich aus den Geschlechtern der Welt eine heilige Schar - und sammelt sich zu einer unvergänglichen Kirche Gottes.«72
Ja, er geht noch weiter: Das einzige Telos der Welt und ihrer Erhaltung ist diese Kirche. Denn dieses »Sondern, dies Sammeln, hört nimmer auf, bis der Herr wiederkommt. Um dieses Sonderns, dieses Sammelns willen wird die Welt gefristet, und nichts Wichtigeres, nichts Folgenreicheres geschieht unter der Sonne als dies Sondern, dies Sammeln.«73 Unter diesen Gesammelten gibt es ein unverbrüchliches Band: »Aller Menschen Geschlechter sind von einerlei Blut entsprossen und darum Eines Geblütes; so sind auch alle Kinder der Kirche von Anfang her Eines Geistes teilhaftig, Eines geistlichen Geschlechtes.«74
Diese Kirche hat Zeiten der besonderen Blüte, so in der Alten Kirche und in der Lutherischen Kirche: »Ich weiß, daß die alte Kirche gegenwärtig blüht, und zwar in dem, was wir ´unsre Kirche´ nennen«.75 Aber abgesehen von der gegenwärtigen Gestalt der Kirche bleibt immer der Trost, daß gleichwie »der Mond abnimmt und zunimmt, aber dennoch am Himmel bleibt, so ist nicht immer einerlei Glanz um die Kirche hergegossen; aber sie geht dennoch unverrückt ihren stillen, verheißungsvollen Gang.«76
Wieder schließt er mit einem Hymnus auf die Kirche:
»Gelobt sei Gott, der ewige König seines unsterblichen Reiches! Gelobet sei er, der ewige Bräutigam der unsterblichen ewigen Kirche! Gelobt sei der Herr, der Heilige Geist, der in allen Zeiten eine auserwählte Schar dem Bräutigam zugeführt! Gelobt sei der dreieinige Herr! Und gesegnet sei seine Kirche! Gesegnet ist sie, daß auch die Pforten der Hölle sie nimmermehr überwältigen werden!«77
Kritik: Eigentümlich ist, daß Löhe die Kirche mit Pfingsten starten läßt, die Juden/Erzväter sind ihm in diesem Zusammenhang keine Erwähnung wert. Gerade sein überzeitliches Konzept sollte doch einen Einschluß der Zeiten des Alten Testaments irgendwie mitbedenken. Dies tut er aber erst im nächsten Kapitel, wo klar wird, daß die Israeliten (früherer Zeiten!) selbstverständlich zur Kirche dazugehören: »im Alten Testament ... war die Kirche in die engen Grenzen der Familie Abrahams und des Volkes Israel zusammengefaßt. Noch zu Zeiten der Geburt des Herrn war die Kirche im eigentlichen Sinne eine Landeskirche, die Kirche Eines Volkes.«78 Eine »bleibende Erwählung des Volkes Israel« als Juden war allerdings der damaligen Zeit und auch Löhe nicht vorstellbar.
In Kapitel 4 (Die Kirche ist Eine, gesammelt aus allen Völkern) geht er auf die Überörtlichkeit der Kirche ein: Die Kirche ist eine weltweite Kirche aus allen Völkern: »Die Kirche des Neuen Testamentes, nicht mehr eine Landeskirche, sondern eine Kirche aller Völker, eine Kirche, die ihre Kinder in allen Landen hat und aus allen Landen sammelt ...«79, diese Kirche ist durchdrungen von ihrem missionarischen Auftrag: »... die allgemeine, die wahrhaft katholische Kirche, die alle Zeiten durchströmt und aus allen Völkern Zufluß hat, - sie ist der große Gedanke, der noch in der Erfüllung ist, das Werk Gottes in der letzten Stunde der Welt, der Lieblingsgedanke aller Heiligen im Leben und im Sterben, für den sie lebten und leben, starben und sterben, - der Gedanke, welcher die Mission durchdringen muß, oder sie weiß nicht, was sie ist und was sie soll. Denn die Mission ist nichts als die Eine Kirche Gottes in ihrer Bewegung, - die Verwirklichung Einer allgemeinen, katholischen Kirche.«80
Kritik: Hier wird Löhes absolute Vorordnung der Mission vor allen anderen Aufträgen der Kirche klar. Schön ist, daß Löhe diesen Gedanken zu einem lebendigen, herrlichen Bild formt, wo wir oft nur noch träge fragen: Mission - ist das noch zeitgemäß?
b) Die Kirche ist apostolisch: Sie kommt aus dem Wort Gottes
In Kapitel 5 (Der Mittelpunkt der Einen Kirche ist das apostolische Wort) nennt er nun den Grund der Kirche, der zugleich der Grund ihrer Einheit ist: »Das Wort der Apostel ist je und je der Einigungspunkt der Kirche gewesen und wird es auch ferner bis ans Ende der Tage sein.«81 Die Kirche ist apostolisch, das heißt sie ruht auf der Lehre der Apostel, denn »alles, alles was sie hat, hat die Kirche aus dem Brunnen des apostolischen Wortes genommen«82. Es geht dabei um die Lehre der Apostel, nicht um die Apostel als Personen. Weil das Wort der Ursprung von Einheit, Mission und Dauer der Kirche ist, deshalb sind nicht »´Ein´, nicht ´allgemein´, nicht ´ewig´ ... die hauptsächlichsten Namen der Kirche, sondern ´apostolisch´. Denn alle Namen verlieren die Bedeutung und hören auf, wenn man die Kirche nicht mehr apostolisch nennen kann; sie bleiben aber alle, grünen und blühen und schmücken die Kirche, wenn sie ´apostolisch´, d.i. auf dem Worte der Apostel bleibt.«83
Kritik: Hier ist Löhe ganz lutherisch, die Kirche ist ihm creatura verbi. Interessant ist bei Löhe das Verhältnis von Wort und Sakrament, dessen Schwergewicht hier noch ganz auf der Seite des Wortes liegt und später immer mehr beim Sakrament liegen wird.84
In Kapitel 6 (Es ist ein heller, klarer Mittelpunkt der Kirche, dies Wort) geht er auf die Eigenschaften dieses Wortes ein: Das Wort ist klar und verständlich für alle, denn »der Allbarmherzige höhnt nicht! Sein und seiner Apostel Wort ist klar und verständlich für alle. Das ist in der Lehre von der Kirche am Ende der wichtigste Punkt Hier ist alle Gefahr Denn wenn die Schrift nicht der Einigungspunkt der Kirche sein kann, so gibt es gar keinen, weil alles andere in sich selber, ohne den Hinterhalt der Schrift, nichtig und eitel ist.«85 Der Wortverstand erkenne leicht die Sache.
Im wesentlichen (den Hauptstücken der Lehre) ist das Wort klar und einfach: »Wir geben zu, daß es in der Bibel, auch im Neuen Testamente, dunkle Stellen gibt. Aber ... Entweder betreffen sie den Weg zum ewigen Leben gar nicht, oder wenn ja, so widerspricht ihr recht erkannter Inhalt den klaren Stellen, die von der gleichen Sache handeln, durchaus nicht, kann es auch nicht, weil sie beide vom Heiligen Geiste stammen, der sich selber nicht widerspricht.«86. Alle Einheit und Wahrheit liegt in der Schrift, »alle Finsternisse, die man der Schrift nachgesagt, sind nicht am Himmel der Schrift, nicht Flecken ihrer Sonne, sondern im Herzen des Menschen und in seinem Auge sind sie.«87
Kritik: Auch Luther hatte ja die claritas der Schrift betont. Bei Löhe wird diese Klarheit ganz wichtig, um die Einheit der Kirche festzuhalten. Der Grund der Einheit kann für ihn nur in der objektiven Schrift liegen, gegen den Subjektivismus seiner Zeit.
Auch wenn man hier Löhe folgt und nicht mit historisch-kritischen Maßstäben die Schrift als reines Menschenwort betrachten und in ihre separaten Einzeltexte zerlegen will, bleibt doch die Frage: Gibt es nicht schon in der Schrift eine große Weite der ekklesiologischen Konzeptionen? Entspricht die Fülle der Kirchen in der Welt etwa nicht schon dieser Weite der Schrift?
Ein anderes Problem der Moderne ist, daß uns Löhes Verheißungs-Erfüllungs-Schema als schwierig erscheint: »das Neue Testament ist ja die Auslegung des Alten, und indem es die Erfüllung aller Weissagungen in Christo Jesu zeigt, wirft es ja ein unwiderstehliches Licht auf jede Dunkelheit.«88
Eine weitere Auffälligkeit ist die soteriologische Engführung analog zu den Reformatoren: Es geht allein um den Weg zum Heil, die Rechtfertigungslehre. Ist da Einheit, so ist man zufrieden. Diese Eindimensionalität kann dann die Stellung zur Welt (der Schöpfung Gottes!) nicht mehr ohne Widersprüche definieren (denn die Welt ist soteriologisch vor allem in Gegnerschaft zu Gott).
In Kapitel 7 (Es fehlte der Kirche niemals ihr heller Mittelpunkt) erläutert er die Kontinuität der Gültigkeit des Wortes Gottes: Immer gab es die Lehre der Apostel für die Kirche: anfangs in mündlicher, später in schriftlicher Form (»Es ist aber ein und dasselbe Wort, welches man am ersten Pfingsten hörte und heutzutage liest.«89 ), und zwar in der kanonisierten Form: »Die Kirche wurde bei dieser Sammlung des Kanons Neuen Testaments von dem göttlichen Ansehen der Schrift überwältigt und in ihrem Zeugnis gab sie nur den Eindruck wieder, den Gottes- und Menschenwort auf sie machen mußte, wie das noch jetzt also ist. Der Kanon würde heute nicht anders bestimmt werden, als er nach Gottes Sinn und Willen und der Beschaffenheit der von ihm stammenden Schriften sich bestimmen mußte und bestimmt hat.«90 Deshalb ist und bleibt immer das Wort der Kirche vorgeordnet: »So hell und schön die Kirche immer sei, weit über ihr schwebt ja doch ihr festes prophetisches, ihr apostolisches Wort, ihr helles Licht, in welchem der Herr selber kommt, zu erleuchten alle, die in die Welt kommen.«91
Kritik: Löhe übergeht mit seinem organischen Denken (daß sich das Wort in der Kirche korrekt als das objektiv richtige durchgesetzt habe) alle historischen Probleme der Kanonbildung und der heutigen Problematik der Kanonautorität. Andererseits ist wohl nur so ein wirkliches Wirken des Heiligen Geistes bei der Verschriftlichung und Kanonisierung des apostolischen Wortes denkbar.
In Kapitel 8 (Das helle Wort kann die Tradition entbehren) schließt er aus dem in 6-7 gesagten, daß nur die Schrift die Norm der Kirche ist. Spätere Tradition ist nicht notwendig, denn die »Schrift ist in ihrem Zusammenhang und in ihren Einzelheiten viel klarer als die Väter. Die Schrift ist ... doch von Mose bis auf Johannes Eine einige widerspruchslose Rede Gottes«92.
Kritik: Löhe bleibt konsequent bei der Behauptung der Einheit, Widerspruchslosigkeit und unumschränkten Autorität des Wortes Gottes. So problematisch das uns als kritischen Menschen erscheinen mag, hat dieser altprotestantische und reformatorische Standpunkt doch seine eigene Faszination. Und vielleicht hat Löhe ja recht, wenn er bei unserer kritischen Werkerei an Bibeltexten als Menschenworten eher menschlichen Lügengeist als Wort Gottes vermutet?
c) Die Gestalt der Kirche ist eine sichtbare
In Kapitel 9 (Das helle Wort beruft alle Völker) wehrt er die Prädestinationslehre trotz ihrer Logik aus praktischen Gründen ab: »Diese Lehre könnte allen Eifer, die Völker mit dem Evangelium Gottes bekannt zu machen, lähmen.«93
Dagegen hebt er die allgemeine Berufung an alle Völker hervor: »Gegenüber dieser Lehre steht die Lehre von der allgemeinen Gnade Gottes, wie sie in unserer Kirche gelehrt wird. Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. ... Darum mußte Christus eine Versöhnung für unsere Sünden stiften, nicht allein aber für unsere Sünden, sondern für der ganzen Welt Sünde. Und eben darum müssen ... Wort und Sakrament ... allen Menschen kundwerden ... Kein Mensch sollte um seiner Sünde willen, die er am Gesetz getan, verlorengehen, denn die sind gebüßt; ... Verlorengehen sollte man nur durch mutwilliges, boshaftes Widerstreben gegen das berufende Wort Darum ist auch die Lehre von der allgemeinen Berufung aller Menschen vor Christo, namentlich aber nach Christo unverbrüchliche Lehre unserer Väter.«94 Sie führt zu Eifer für die Mission.
Sogar die Völker Amerikas hätten von Anbeginn möglichen Zugang zur Offenbarung gehabt. Hier gilt die Vorordnung des geoffenbarten Gotteswillens in biblischen Texten vor aller menschlichen Vorstellungskraft: »Es wäre schlimm, wenn die Unwissenheit der Menschen Beweiskraft gegen Gottes klaren Liebeswillen hätte.«95
Kritik: Aus der Bibel lassen sich nicht nur die Allgemeine Berufung, sondern auch eine Prädestinationslehre (auf jeden Fall die augustinisch-spätlutherische der Prädestination zum Heil) durchaus erheben. Und die Prädestinationslehre muß nicht den Missionsgedanken mindern, kann aber vor wildem Aktionismus bewahren, kann mein betrübtes Herz ruhig werden lassen, wenn es Gott einmal zu dieser Zeit an diesem Ort für mich nicht fügt, bei diesem Menschen Gottes Wort ins Herz zu säen. Um der Theorie der allgemeinen Berufung willen nimmt Löhe hier zuviel in Kauf, auch was die aberwitzige Idee der Mission Amerikas vor der Ankunft der Missionare betrifft. Diese Spekulation widerspricht auch ganz und gar seinem sonstigen geschichtlich- organischen Denken.
In Kapitel 10 (Er beruft sie zu Einer Kirche, die da sichtbar und unsichtbar zugleich ist) führt er die Gedanken zur Scheidung von unsichtbarer (die von Gott Auserwählten, die nach dem nur von Gott erkannten Herzen zur Kirche gehören) und sichtbarer Kirche (die Berufenen sind hier die Mitglieder der Institution Kirche: »die sich äußerlich von der Welt trennen und sich vor jedermann zu Christo und seiner Kirche bekennen«96 ) aus.
Dennoch bilden beide eine untrennbare Einheit: »die auserwählten Kinder der unsichtbaren Kirche gehören genau genommen nicht bloß vorzugsweise, sondern allein zur sichtbaren Kirche die sichtbare und unsichtbare Kirche sind völlig Eine.«97 Eine Unterscheidung gäbe es nur aufgrund der menschlichen Kurzsichtigkeit, vor Gott gibt es also nur die Eine sichtbare und unsichtbare Kirche der Auserwählten. Es finden sich aber keine Auserwählten außerhalb der sichtbaren Kirche.
Zum drittenmal schließt er hymnisch ein Kapitel und damit das erste Buch ab: »Es bleibe uns Eine Kirche - Eine ewig, Eine allezeit, Eine überall, Eine - vereinigt durch Gottes klares Wort, Eine zugleich sichtbare und unsichtbare, - und gesegnet sei ihr Quellort, das Wort, das Himmel und Erde schuf, das auch die Kirche schuf und hält ohne alles Zutun menschlicher Hilfen und Stützen! Gelobt aber sei der Herr, der Gott der Kirche, immer und ewiglich! Halleluja!«98
Kritik: Man beachte den Ausdruck: Gott der Kirche. Fast scheint sich Gott selbst über die Kirche zu definieren und definieren zu müssen, obwohl Löhe doch sonst allen Subjektivismus abwehrt! Aber es ist aus Löhes Sicht ganz selbstverständlich: Die Kirche ist ja der Lieblingsgedanke Gottes.
Insgesamt ist es erstaunlich, wie stark die Bestimmung »una« Löhes Kirchenlehre dominiert und so alle Einzelbestimmungen ganz eng zusammenrückt.
Logisch problematisch ist die unterschiedliche Bestimmung: Hier sind die Berufenen Kirchenangehörige, vorher war einmal von der Allgemeinen Berufung aller Menschen die Rede. Aber solche Definitionsunterschiede (Berufene i.S.von xxx, ...) sind wohl unvermeidlich (vgl. den sehr disparaten Begriff Kirche mit seinen Dutzenden von möglichen Bestimmungen).
Bei den Termini Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der Kirche geht »es Löhe ... einmal um die Sichtbarkeit der Kirche ..., zum anderen um die Existenz der wahren Kirche. Die wahre Kirche existiert; die Personen, die dazu gehören, sind aber für uns nicht auszumachen. Sichtbar für uns ist nur die Gemeinschaft, die sich um Wort und Sakrament sammelt.«99
2.2 Buch II Von den Kirchen
Nachdem Löhe im 1.Buch die Eine unsichtbare und sichtbare Kirche Gottes und seiner Auserwählten beschrieben hat, die ideale abstrakte Kirche, geht es nun um die Unterscheidung der empirischen Kirchen. Er wird ein Kriterium finden, um auch unter ihnen die idealste Form, die am ehesten der idealen Kirche entspricht, herauszufinden.
a) Die Partikularkirchen
In Kapitel 1 stellt er die Universalität der Kirche (bzw. des anbrechenden Reiches Gottes) heraus und nimmt damit den Zusammenhang des ersten Buches auf: »Da die sichtbare Kirche eine Versammlung von Berufenen ist, so muß man zugestehen, daß sie überall ist, wo Gottes Berufung erschallt und wo es deshalb Berufene in dem obenangegebenen Sinne gibt.«100 Aus Philipp Nicolai, Johann Gerhard u.a. belegt er, daß sein milder Standpunkt (daß nämlich überall Kirche im Sinne des 1. Buches sei, wo Gottes Wort ausgebreitet wird) der Tradition voll entspricht: »Man verkümmere sich den Gedanken der Kirche nicht und lasse gelten, was gilt. Ecclesia catholica est temporalibus aeterna, locis infinita, personis innumera! (Tertull.)«101
Kritik: Löhe versichert sich (und seiner kritischen, weil konfesssionell denkenden Leserschaft) der organischen Bildung seiner bisher vorgetragenen Kirchenlehre, indem er die Tradition auf seiner Seite sieht.
In Kapitel 2 (Sie teilt sich in viele Partikularkirchen, unter denen eine den Vorzug vor den andern haben muß) nimmt Löhe wahr, daß die sichtbare Kirche sich in Partikularkirchen zeigt. Die Unterschiede der Zeremonien sind ihm dabei egal, aber »Sie lehren verschieden - und das macht bedenklich! Denn wenn es schon überhaupt unmöglich ist, daß zwei
verschiedene, über Eine Sache abgegebene Urteile zugleich richtig sein können, so ist es insonderheit für unmöglich zu halten, daß Ein göttliches Wort zwei zugleich richtige Deutungen empfange. Nur eine kann richtig sein. Wer die falsche hat, ist in einer größeren Gefahr, als wer mit Feuer und Schießgewehr spielt. Denn falsche Lehre erzeugt falsche Grundsätze, damit falsches Leben, d.i. Sünde; die Sünde aber ist ein Feuer, welches nur Verrückte im Busen tragen und heiler Haut bleiben zu können behaupten.«102
Deshalb ist eine Scheidung nach der Wahrheit der Lehre nötig. In den Lehren sind nämlich Lügen und Wahrheit vermischt. Der Mensch selbst neigt aber zur Lüge hin und kann so bei unreiner Lehre umso leichter verlorengehen. Löhe will kein vorwitziges Gericht halten, aber auch keinen Indifferentismus zulassen. Es geht ja um die ewige Wahrheit, die zur ewigen Seligkeit führt!
Deshalb sucht er nach dem Prüfstein für die Wahrheit der Lehre: »Die Partikularkirche, welcher man den Preis der meisten Wahrheit zuerkennt, ist Königin unter allen, ist Kirche kat´exochen, ist Braut des Herrn, ist Brunnenstube des seligmachenden Wassers, Herd des unauslöschlichen, reinen und reinigenden Feuers!«103
Dieser Kirche gesteht er allen Vorzug, die volle Wahrheit zu und preist sie: »es gibt eine Kirche, die alle Wahrheit hat, welche andere haben, und noch mehr, - in der gesammelt ist, was sich andernwärts zerstreut findet. Es gibt eine, die gleich der apostolischen allen gibt, was sie haben, von deren Besitz alles stammt, was andere haben. Es gibt Eine, - wie es allezeit Eine gab, - und geben wird! Sie ist die Schar, welche die Lade trägt und vor ihr schläft. Sie darbt an vielem andern, aber das kann ihr niemand nehmen, daß sie die Braut des Königs der Wahrheit ist, weil sie die volle Wahrheit besitzt!«104
Kritik: Löhe legt hier einen objektiven Wahrheitsbegriff an. Steht dieser aber nicht allein Gott zu? Muß nicht bei aller Suche nach göttlicher Wahrheit für den Menschen und damit für die sichtbaren Partikularkirchen weiter der Vorbehalt gelten, daß sie die volle göttliche Wahrheit einfach nicht erkennen und (geradezu habitusmäßig!) besitzen können? Löhe betont immer die EINHEIT der göttlichen Wahrheit - und scheint dabei etwas die FÜLLE der göttlichen Wahrheit zu vernachlässigen.
In Kapitel 3 (Kennzeichen der Partikularkirchen sind ihre Bekenntnisse) sucht Löhe nun den Prüfstein in den Bekenntnissen der Partikularkirche, da diese das Wortverständnis und die Sakramentsverwaltung ja bestimmen, die zur Kirche sammeln. »Kennzeichen der Kirche im allgemeinen ist jedenfalls auch das, wodurch sie gegründet, gesammelt, genährt und erhalten wird. Nun ist keine Frage, daß die Kirche im allgemeinen durch Wort und Sakrament gegründet, gesammelt, genährt und erhalten wurde und noch wird. Ebenso aber ist kein Zweifel, daß eine Partikularkirche durch ihr Wortverständnis und ihren Sakramentsbrauch oder kurzweg durch ihr Bekenntnis von der andern Partikularkirche getrennt, gesammelt, genährt und erhalten wird. Ihr Bekenntnis muß deshalb ihr Kennzeichen sein.«105 Die Bekenntnisse sind nämlich Unterscheidungsmerkmal, teuerstes Kleinod und Bindemittel der Partikularkirchen.
Kritik: Kann die Lehre (Bekenntnis) das alleinige Unterscheidungsmerkmal sein? Bekenntnisse sind ja etwas typisch Reformatorisches. Römisch-Katholische Kirche, Freikirchen und Ostkirchen bestimmen sich oft an anderen Kriterien. Allerdings, wenn Löhe hier einfach mit Bekenntnis die Form der Kirche meint, mag die Unterscheidung angehen. Interessant ist die Disparatheit, die er erzeugt, wenn er von Kennzeichen der Kirche redet: Während die CA einfach von notae ecclesiae redet, muß man hier aufpassen, ob Löhe von den notae der Einen Kirche (die in Buch I als una, sancta, catholica und vor allem apostolica genannt wurden) oder den notae der Partikularkirchen (das sind nach Löhe ihre Bekenntnisse, die ihr Leben bestimmen) redet.
In Kapitel 4 (Kennzeichen der reinsten Partikularkirche, der Kirche kat´exochen, ist Schriftmäßigkeit des Bekenntnisses) prüft er nun den Prüfstein, also das Bekenntnis. Prüfmittel, Kennzeichen der reinsten Kirche ist ihm dabei Schriftmäßigkeit des Bekenntnisses. Für seine lutherische Freunde ist es aber eigentlich ganz einfach: »Vergleiche nur vor allen das Bekenntnis der Kirche, zu welcher du dich bisher selbst gehalten hast, mit dem klaren Worte Gottes. Findest du es bewährt, so ist eigentlich deine Arbeit schon geschehen; denn mehr als dem klaren Worte entsprechend kann kein Bekenntnis sein; ... Und damit kommt schon großer Friede.«106 Für sie ist der Weg darum leicht: »Es ist durchs Leben und Erfahren schon viel Vorbereitung geschehen. Auch sind es ja nicht so gar viele und schwere Punkte, auf die es ankommt, - und über alle und jede reden die Bekenntnisse deiner Kirche - und die Schrift so klar, so verständlich, so einfach!«107
Kritik: Löhe hat uns jetzt großartig bis zur Spitze getrieben, dem Prüfen des Bekenntnisses am Wort Gottes. Jetzt erwartet man eigentlich den großen Beweis der Übereinstimmung von Bibel und Bekenntnis. Doch diesen hat Löhe gar nicht nötig und wird ihn auch nicht ausführlich führen, weil er sich in einem hermeneutischen Zirkel befindet: Er verwendet zum Prüfen ja die erlernte lutherische Hermeneutik und stellt mit dieser dann eine klare Übereinstimmung von Bibel und Bekenntnis her. Wegen dieser Übereinstimmung bestätigt sich wiederum die Lehre und damit die Art der Auslegung der Bibel.
Das Vorgehen ist insoweit teilweise berechtigt, als sich in der Tat kein Mensch völlig außerhalb seiner eigenen hermeneutischen Zirkel setzen kann. Es ist eben kein schlüssiger Beweis für jemanden mit einer anderen Hermeneutik. Das hat Löhe hier ja auch bewußt nicht vor.
b) Die vorzuziehende Partikularkirche ist die lutherische Kirche
In Kapitel 5 (Die lutherische Partikularkirche hat das unterscheidende Kennzeichen schriftmäßigen Bekenntnisses) macht er im konfessionellen Sinn alles klar: das lutherische Bekenntnis ist das schriftgemäße. Der Beweis vor den anderen Partikularkirchen ist denkbar einfach: »Sie widersprechen? Mögen sie uns erst die Fahnen und Zeichen der Kirche rauben! Mögen sie erst beweisen,was sie nie beweisen konnten, daß unser Bekenntnis vom Worte weiche! Solange sie das nicht tun, ist bei uns der Herr, und wir sind es, von deren vollkommener Fülle alle andere Kirchen leben!«108. Also ist diese lutherische Kirche », weil sie Wort und Sakrament in reinem Bekenntnis hält, die Brunnenstube der Wahrheit - und von ihren Wassern werden in allen andern Kirchen gesättigt, die gesättigt werden! - Die Kinder dieser Kirche stehen in heiterer Ruhe mit leuchtenden Angesichtern und scharfen Schwertern um die Quelle, von welcher alle selig werden, die da selig werden.«109
Kritik: Der Beweis ist für einen Zweifler enttäuschend schwach. Für einen Konfessionellen mag es hingehen, dieser ist sicher längst zu derselben tiefen Überzeugung von der Wahrheit der lutherischen Konfession und damit von der Übereinstimmung mit der ewigen Wahrheit des Wortes Gottes gekommen. Hier schreibt Löhe bedenkenlos der eigenen Kirche soviel Fülle zu, daß die anderen nur wie ein schwacher Abklatsch der wahren, lutherischen Kirche wirken. Die lutherische Kirche (als Landeskirche oder als Freikirche) selbst wird diesem Anspruch kaum Genüge tun können. Dies wird Löhe später im Kampf um die Gestaltung der lutherischen Kirche mühsam lernen müssen.. Er wird feststellen, daß Leben und Lehre nicht so einfach übereinstimmen, wie er das hier noch annimmt..
In Kapitel 6 bis 10 prüft Löhe andere mögliche Kennzeichen der reinen Kirche und weist sie ab.
Kennzeichen der reinen Kirche sind also nicht:
Altertum und Dauer (6) - sie war ja einstmals jung und die Zukunft ist unabsehbar. Weite Ausbreitung (7) - sie war ja einstmals klein.
Einigkeit und Sukzession im Sinn der Römer (8) - das wäre zu äußerlich.
Heiligkeit des Lebens im Sinn der Römer (9) - das wäre zu äußerlich. Wunder und Weissagungen (10) - das kann auch der Teufel.
Obwohl all dies nicht die Kennzeichen der reinen Kirche sind, sind es doch in gewisser Hinsicht auch die Kennzeichen der lutherischen Kirche: Sie beruft sich auf die Alte Kirche, sie missioniert in aller Welt, sie hat volle Lehrsukzession, sie fordert mit der Berufslehre ein heiliges Leben und sie prüft Wunder und Weissagungen an der reinen Lehre (hier habe sie aber noch Defizite darin, die Gaben zu erwecken!).
Kritik: Löhe weist vor allem die von der römisch-katholischen Kirche angeführten Argumente für ihren Vorrang ab und spricht diesen Vorrang stattdessen der lutherischen Kirche zu. Die lutherische Kirche ist ihm die wahrhaft katholische Kirche, die die Fülle der Wahrheit hat. Die Kritik an den Römern fällt ihm insofern schwer, weil er das doch auch gern alles für sich und die lutherische Kirche hätte. Man wird auch »nicht an der Tatsache vorbeigehen können, daß er stellenweise das Ethos wie eine nota ecclesiae behandelt.«110 Seine Ausführlichkeit hier ermüdet etwas den Leser, der doch bis Kapitel 5 des 2. Buches bis auf den Höhepunkt der Herrlichkeit der lutherischen Kirche geführt wurde, nun aber mit Löhe die Vorwürfe der Neuheit, Kleinheit, Uneinigkeit, Ungeistlichkeit, Unheiligkeit und des Charismenmangels der lutherischen Kirche wegdefinieren muß.
2.3 Buch III Von der lutherischen Kirche
a) Der Gehalt der lutherischen Kirche
In Kapitel 1 (Kirchlicher Charakter ihrer Reformation) erklärt Löhe die Reformation (hin zurück zur Alten Kirche) als geschichtliche Gottesfügung: »Da die Zeit erfüllet war, reichte der Herr die erkleckliche Hilfe. Er hatte verschafft, daß eben griechisches und hebräisches Sprachstudium einen neuen, zuvor unbekannten Aufschwung nehmen mußte. So war denn auch ein Zurückgehen auf die Erkenntnisquellen der Religion, auf das Alte und Neue Testament, ganz nahegelegt hinreißend war der Gegensatz der Schrift gegen die damalige Gestalt der Lehre und Kirche. Schriftmäßigkeit wurde das ernste dringende Erfordernis der Reformatoren.«111 Somit ist die lutherische Kirche die rechte Nachfolgerin der Alten Kirche: »Die uralte reine Kirche des Abendlandes lebt da, wo die uralte, reine Lehre der uralten, reinen Kirche gepredigt wird.«112
Kritik: Hier erklärt Löhe geschichtlich-organisch die Notwendigkeit der (lutherischen) Reformation und ihre Kontinuität zur Alten Kirche. Wenn er von Lehre spricht, meint er wohl auch das daraus folgende Leben, den Gottesdienst der Kirche, da er schon 1838 schrieb: »Reformation ist Wiederherstellung der Lehre und des Gottesdienstes der ersten Kirche.«113
In Kapitel 2 (Ihre Reformation ist teils vollendet, teils unvollendet) konstatiert Löhe für die lutherische Kirche: »Sie ist vollendet in der Lehre, sie ist unvollendet in den Folgen der
Lehre.«114 Denn »die Reformation der Lehre ist geschehen, aber die Kirche erfreut sich des Reichtums ihrer reinen Lehre nicht, wie sie soll, und fühlt nicht die Bedeutung, die sie dadurch hat Sie erkennt nicht, daß sie, nachdem sie die reine Kirche geworden, vor andern eine Erbin aller göttlichen Verheißungen ist. Sie ist sich selbst zu sehr bloß Dogma, zu wenig Person, zu wenig sich ihrer selbst, ihrer Gnade, ihrer Würde, ihrer Kräfte bewußt. In kirchlichem Bewußtsein, Leben und Werk ist sie noch lange nicht wieder, was die reine Kirche der ersten Jahrhunderte war! Hier gibt es noch zu reformieren! Und hier reformiere uns der Herr und sein Geist!... Er führe uns in unwandelbare Demut, aber auch zum Genusse alles dessen, was der reinen Kirche gebührt!«115
Kritik: Hier wird Löhes tiefe Unzufriedenheit mit der konkreten Gestalt, mit dem Leben der lutherischen Kirche deutlich. Der Geist dieser Unzufriedenheit ist ein durchaus reformatorischer, wenn auch die Reformatoren und Neulutheraner kaum in solchem Maße wie Löhe sich die Alte Kirche zum Vorbild nehmen..
In Kapitel 3 (Sie ist die einigende Mitte der Konfessionen) stellt Löhe die lutherische Lehre als gerechte Mitte zwischen den Unterscheidungslehren (z.B. in Abendmahlslehre und Lehre vom freien Willen und der Notwendigkeit) dar. Sie ist daher die »Union der Gegensätze«116 und selbst die »wahre Union«117.
Weil sie schon die Union ist und die Fülle der Wahrheit hat, darf sie nichts von sich preisgeben: »Sie, die Wächterin der reinen Lehre, kann von der erkannten Wahrheit, von der rechten Mitte aller göttlichen Gedanken, von der Arzenei der Welt, nichts aufgeben, ohne dem Gott, der sie so hoch betraut, untreu und eine Übertreterin ihres Berufes zu werden. Sie kann auf die Stunde ihrer Verherrlichung warten, scheut sich aber, menschliche Unionsgedanken ins Werk zu mischen.«118
Auch die Confessio Augustana allein sei keine Unionsformel, da sie ja geschichtlich notwendig zur Konkordienformel führte und also selbst zuviel offenläßt.
Kritik: Löhe ist jede institutionelle Unioniererei ein Greuel. Er erwartet zu Recht, daß »der Herr , welcher die Herzen der Menschen in seiner Gewalte hat, ... uniert ... und zwar auf Grund der Wahrheit und durch die Wahrheit.«119 In Zeiten wildentschlossenen Ökumenismus (heute ähnlich wie damals) ist dieses retardierende Moment notwendig und ein Trost vor aller menschlichen Werkerei und Unvollkommenheit.
In Kapitel 4 (Sie soll sein ein Segen der Heiden) betont Löhe wieder, was er als Kernpunkt des Kircheseins definiert hatte und was ihm selbst sehr am Herzen liegt: Die Mission an den Heiden. Sie soll eine lutherische nach der reinen Lehre sein: »Wir verfolgen mit Wohlwollen und innigem Verlangen die Erfolge aller Missionen und freuen uns alles Guten, das andere durch die Lehren tun, welche sie aus unsrer Fülle genommen haben. Aber dabei bleibt´s nicht! Wir bitten den Herrn um Vergebung der Sünde, daß wir zu wenig getan haben zum Heile der Heiden. Wir erkennen, daß es anders werden muß, - und nachdem wir durch unser Vermögen lange genug andere ermächtigt haben, unreinere Lehren zu predigen, gehen wir nun selbst hinaus und predigen das reine Wort des Lebens allen Völkern.«120
Hier stimmt er hoffnungsfroh eine Fürbitte an: »ER wird mehr tun, als wir sagen und annoch sagen können! ER wird seine Kirche verklären - und ihr eine heilige Mission verleihen! ER tue es, auf daß man ihn preise zu Jerusalem und in Zion sein Lob erhöhe!«
Kritik: Die lutherische Mission (statt der ökumenischen Missionsvereine) lag Löhe sehr am Herzen und schwingt auch hier offen mit. Richtig an dieser Ansicht mag bleiben, daß ich ja in der äußeren Mission nicht anders lehren kann als in der inneren Mission. Problematisch wird es aber, wenn sich konkurrierende christliche Missionen gegenseitig verteufeln und damit der christlichen Sache insgesamt schaden. Diese Ansicht ist ja bei Löhe keinesfalls der Fall.
In Kapitel 5 (Maß ihrer Mittel und Reichtum ihrer Werke innerhalb ihrer Grenzen) leitet er über zu den Mitteln dieser Kirche: »Sie wirkt viel durch wenige Mittel!«121 Diese sind »das Wort, das Sakrament, das heilige Amt der Hirten.«122
Vereine dagegen neigen zur Werkerei. Deshalb sind Armenpflege, Schule, Krankenpflege, Pilgerwesen, Waisenbetreuung , Unterbringung eigener Leute und die Betreuung heiliger Orte ganz Kirchensache.
Bischöfe und Pfarrer haben dabei aber das göttliche Amt zur Einheit. Sie »vereinigen die Gemeinen zu allem Guten und pflegen in ihnen alles Gute nach der Machtvollkommenheit ihres göttlichen Amtes; sie geben jedem guten Werk je nach Ort und Zeit das wortgetreue Maß; sie leiten und weiden die Gemeinden zu allem Guten! - Die Kirche im ganzen, die Gemeinden im einzelnen umfassen alle guten Werke, - und was geschieht, geschieht in Einigkeit der Herden mit den Hirten.«123
Kritik: Das Hirtenamt als medium salutis?! In der Tat, da Wort und Sakrament recht verwaltet und ausgeteilt werden müssen, also durch das Hirtenamt, steht dieses als Mittler zwischen den Gnadenmitteln und der Gemeinde. Das ist vielleicht ein bißchen zuviel des Guten, wie dann später auch der Streit um die Amtslehre mit den Erlangern zeigt. Bei Löhe selbst, der mit allen Gaben des Pfarramtes reich begnadet war und auch mit dem Drang, diese auszuüben, ist der hohe Amtsbegriff verständlich. Ich würde mich als »normaler« Pfarrer mehr auf die Selbstwirksamkeit des Wortes in der Gemeinde verlassen wollen.
b) Die Gestalt der lutherischen Kirche
In Kapitel 6 (Ihre Predigt) widmet sich Löhe der Homiletik. Die Predigt ist das höchste Mittel der Kirche: »Unter den Mitteln, welche die Kirche zum Heile der Seelen gebraucht, steht die Predigt obenan. Sie ist das Mittel, die da ferne stehen, herbeizurufen, und die Herbeigerufenen und Herbeigekommenen in Beruf und Erwählung festzumachen.«124 Sie wirkt dabei hauptsächlich durch das Wort Gottes selbst, nicht durch Menschenrhetorik: »Bei der Predigt legt es die Kirche nicht eben darauf an, das heilige Wort durch menschliche Kunst zu unterstützen, sondern die Hauptsache ist, seine Kraft und Wirkung nicht zu hindern und dem Worte keine Art und Weise des Wirkens aufzudrängen, welche sich für dasselbe nicht eignet. Der Prediger verkündet das Heil in Christo Jesu mit dem Bewußtsein, daß nicht seine Zutat, sondern der edle Inhalt des Wortes die Seelen von der Welt sondern und Gotte nahbringen müsse.«125 Da der Prediger sich so selbst zurücknimmt, kann und soll er unerwecklich bescheiden predigen. Er beschreitet den von Luther vorgezeichneten Weg der Einfalt auch bei der Perikopenauswahl, um vor allem mit den klaren und eindeutigen Stellen der Bibel »zu treiben das Evangelium des Friedens und den Einen Glauben; und das ist nötig den schwankenden Gemütern, beides, der Laien und der Verständigen.«126
Kritik: Hier hat sich Löhe von der Erweckungsbewegung und Krafft abgewandt. Er zieht wirklich seine Predigtkraft vor allem aus der einfachen Ausdeutung des Evangeliums. Allerdings schmückt er es selbst immer wieder mit Bildern und Pracht aus. Die Vorteilhaftigkeit der lectio continua sah er aber durchaus ein und benutzte sie in seinen Predigten unter der Woche.
In Kapitel 7 (Ihr Katechismus) geht es Löhe um Katechetik. Das beste Bekenntnis ist dabei der Kleine Katechismus: »Der kleine Katechismus Luthers ist ein Bekenntnis der Kirche, und zwar unter allen Bekenntnissen dasjenige, welches dem Volke am angenehmsten und geläufigsten ist. Es ist eine Sache, welche niemand leugnet, daß kein Katechismus der Welt gebetet werden kann als der.«127. Deshalb soll er auch nicht übermäßig erklärt werden, sondern man »soll vielmehr den Katechismus zum Zweck des Unterrichts machen. Er ist ein reiner Widerschein des göttlichen Worts, eine Laienbibel und eine Lust der Theologen.«128
Diese regula fidei soll Haus, Schule und Kirche einen. »Er soll empfohlen, in seinem göttlichen Grunde, seiner norma normans nachgewiesen, immer aufs neue an Gottes Wort gehalten, in der Predigt angeführt, gepriesen werden, auf daß er die Einheit der Kirche stärken helfe und groß und klein, gelehrt und ungelehrt etwas haben, worin sie einig sind und sich im Wirrwarr der Zeit einig wissen!«
Kritik: Löhe weist hier selbst wieder mal nicht nach, sondern setzt voraus (die Schriftgemäßheit des Kleinen Katechismus). Seine Lutheraner haben das ja selbst erfahren. Weil der Kleine Katechismus so nahe am biblischen Wort ist, dient er selbst mit beim Einen der Kirche. Deswegen soll er nicht zerredet werden, nicht in der Fülle religiösen Unterrichtsstoffs untergehen, sondern den Sammelpunkt der Katechese bilden. Die Beschränkung ist hier eklatant, das Ziel der Einheit klar.
In Kapitel 8 (Ihre Seelsorge) sorgt sich Löhe um die Poimenik: Die ständigen Neuerungen und Experimente seien schädlich. »Man vergaß, daß Predigt und Sakrament und Katechese, ja auch die Liturgie in Wahrheit und auf recht großartige Weise für die Seelen sorgen, und daß die Seelsorge des einzelnen von ... der Frucht der Predigt, des Sakraments, der Katechese, abhänge. - Dazu hatte man vergessen, daß die Privatseelsorge eine große Tugend, Weisheit und Gabe voraussetze ... Durch Laufen, Rennen und Reden wird der Mangel an Weisheit nicht ersetzt, nicht der Mangel an Gabe und Tugend.«129
Dagegen wurde das Zentrum der (Einzel-)Seelsorge, der Beichtstuhl/ die Privatbeichte übersehen. Für die Hingabebereitschaft und damit die Wirksamkeit der Einzelseelsorge sei aber das alte institiutionelle (natürlich göttliche, nicht menschliche Institution) heilige Verhältnis von Beichtvater und Beichtkind nötig. Daher wird von ihm »die Privatbeichte, die Exploration, die Vermahnung, die Privatabsolution ... gebieterisch gefordert, wenn man recht für die Seelen sorgen soll.«130
Zugleich muß der Pfarrer aber auch an der Gemeindezucht beteiligt sein: »Indes ist die Privatbeichte eine halbe Maßregel, wenn nicht zugleich der Bindeschlüssel dem überlassen bleibt, der den Löseschlüssel führt. Verweigerung der Absolution und des heiligen Abendmahles muß in der Hand des einzelnen Pfarrers liegen. Es muß auf festen Bestimmungen ruhen, wem die Absolution und das Sakrament zu verweigern ist und in welcher Weise zu verfahren sei. Die Verweigerung selber aber im einzelnen Fall muß dem Pfarrer zustehen, obschon so, daß er der Kirche für sein Tun verantwortlich bleibt.«131
Kritik: Löhes Seelsorge ist vom Zuchtgedanken getragen: »Seelsorge ohne Erziehung und Zucht ist ein Unding. Der Väter Sanftmut wirkt nur, wenn sie im rechten Fall auch streng sind, gleichwie die Strenge nur bei einem Manne, der sanft zu sein vermag zum Heil der Seinen, den rechten Eindruck macht.«132 Die oft nicht wortgebundene Methodenvielfalt der Praktischen Theologie deutete sich in Löhes Zeit schon an und ist heute noch um ein Vielfaches gewachsen.
Für Löhe, der wirklich ein Geistlicher für sich und die Umwelt war, war die Wiedereinführung von Gemeindezucht und Privatseelsorge nötig und möglich. Fraglich erscheint mir allerdings die Bindung der Schlüsselgewalten an das Pfarramt. Für Löhe war sie nötig, um die volle Einheit von Hirte und Herde beizubehalten. Und das Dazwischenstehen des Kirchenregimentes (der Konsistorien) hat in der Tat keinerlei geistlichen Sinn. Die geforderte Gewalt ist nicht so stark wie sie auf den ersten Blick erscheint, wenn man bedenkt, daß Löhe in der Privatseelsorge sich gegen den Parochialzwang aussprach.
In Kapitel 9 kümmert sich Löhe um die Liturgik. Er will eine betende Kirche, die am Alten lernt und es zugleich reinigt, wie es schon in der Reformation geschah. Deshalb hat auch hier die Lehre den Vorrang. Nur so bildet sich der Glaube: »Der wahre Glaube wird nicht allein in der Predigt laut werden, sondern er wird durch Gebet eingebetet, durch Gesang eingesungen werden. Die Liturgie wird alsdann der Kirche zu neuer Befestigung gegen ihre Feinde dienen. Sie wird eine heilige Schutz- und Trutzwaffe in des Herrn Kriegen sein.«133
Kritik: Löhe sieht hier die streitende Kirche im Vordergrund. Ihr ist ihr Gottesdienst ein Bollwerk Gottes in der Welt und eine Waffenrüstung gegen alle Lügen, mit denen der Teufel uns schmeichelnd umwirbt. In der Tat haben Beten, Singen und liturgische Rituale eigentümliche tiefe Wirkungen auf Menschen. Wie immer ist Vorsicht angebracht, wenn Gottesdienst dann zur Methode wird.
c) Die Hoffnung der lutherischen Kirche
Im letzten Kapitel des letzten Buches spricht Löhe die Hoffnung auf einen neuen Ehrentag der lutherischen (=wahrhaft katholischen) Kirche aus (»was hindert´s denn, zu glauben, daß wir im Morgenrote ihres Ehrentages stehen?«134 ). Er soll sichtbar werden in der Einheit der Lutherischen Kirche: »Laßt uns einig sein, Brüder, und unsre Einigkeit in der uralten Wahrheit und die Freude am Herrn sei unsre Stärke! Laßt uns die heilige Kirche in Mitte der Konfessionen würdiglich vertreten, in Lieb und Ernst! Laßt uns die Aufgabe unsrer Kirche in Betreff der Missionen erkennen und ihre Fackel in alle Lande tragen! Laßt uns einig sein! Laßt uns einig sein vor unserm Volke! Einerlei Wort und Lehre, einerlei Praxis der Lehrer, einerlei Lobgesang sei unter uns! Laßt uns eifern für die Einigkeit Unsre Einigkeit ist im allmächtigen Wort des Allmächtigen, welches alle Feinde niederlegt! ... die Welt aber wird erkennen, daß wir seine Jünger sind. Denn es hat unsrer Kirche nie etwas gefehlt, um mit vollsten Händen Segen über die Welt auszustreuen, als die Einigkeit.«135
Er schließt mit einem apellativen Schlußgebet:
»
Ein Gott! Ein Herr! Ein Glaube! Eine Taufe!
Ein Ausgang, Ein Weg, Ein Eingang!
Was wird uns fehlen?
Gelobet sei Gott, der uns hilft!
Amen.
«
Kritik: Hier ist der Gedanke der una ecclesia wieder ganz stark, wie im 1.Buch. Löhe sieht also seine Aufgabe im Sammeln und Sondern der »Freunde der lutherischen Kirche«. Mit ihnen will er sich eins sehen, mit ihnen will er für einen neuen Ehrentag der lutherischen Kirche in widriger Zeit kämpfen.
3 Ansätze zur Würdigung von Löhes Kirchenlehre
3.1 Löhe als Kirchenmann des Luthertums
Siefried Hebarts Untersuchung »Wilhelm Löhes Lehre von der Kirche, ihrem Amt und Regiment« ist geprägt vom Interesse am konfessionellen Luthertum. Leicht treffen Hebart die Anwürfe der Dialektischen Theologie und des Liberalismus, die konfessionelle Theologie sei entweder zu subjektiv oder zu ungeschichtlich, in jedem Fall aber von einem »Geist des unduldsamen Konfessionalismus und der Lieblosigkeit«136 geprägt. Diese Vorwürfe sollen ja das Luthertum überhaupt treffen. Für den Lutheraner aber muß die Hauptfrage die sein, ob die Lehre lutherisch (=schriftgemäß!) ist: »Wir müssen das ´Neuluthertum´ einer gerechten historisch-theologischen Untersuchung unterziehen, bei welcher wir die immer wieder gemachten Vorwürfe berücksichtigen. Erst auf Grund des Ergebnisses einer solchen Untersuchung können wir beurteilen, inwiefern diese Vorwürfe berechtigt sind, erst dann wissen wir, ob wir an jenen Vätern der lutherischen Kirche etwas als schriftwidrig preisgeben müssen oder nicht.«137. Er nimmt als einen der bedeutendsten Kirchenmänner Löhe heraus, weil »er eigentlich zwischen den zwei einander oft widersprechenden Richtungen und Extremen des ´Neuluthertums´ stand und in einem gewissen Maße dieselben in sich vereinigte. Vor allem aber war Löhe ein Mann, der auch kirchlich handeln konnte und dessen praktische Tätigkeit bis zum heutigen Tage ihre Nachwirkungen zeigt. Dabei ist für unsere Untersuchung nicht unwichtig, daß diese praktische Tätigkeit ... sich ... über die ganze lutherische Ökumene erstreckte.«138 Hebart stellt also die Frage: Ist Löhes Kirchenlehre lutherisch?
Hebart fällt an Löhes Kirchenlehre besonders positiv auf, »daß er in einer Zeit, da man das ganz vergessen hatte, wieder auf den neutestamentlichen und genuin lutherischen Gedanken von der Kirche als einer Koinonia, einer communio hinweist.«139 Löhe weiß »von der in Christo triumphierenden und stellvertretenden Liebe Gottes, durch die Gott die Gemeinschaft mit den Menschen wieder hergestellt und damit die Menschen zur Gemeinschaft miteinander wieder frei gemacht hat. Nur in Christo wird die Einsamkeit und die Selbstsucht des Menschen wieder aufgehoben. Das heißt aber für Löhe: Nur in der Kirche gibt es wirkliche Gemeinschaft, denn Christus ist nur in seiner Kirche gegenwärtig. Durch seine Realpräsenz in Wort und Sakrament bewirkt er diese einzigartige Gemeinschaft«140.
Hebart fährt fort, daß für Löhe »im Gedanken der communio sanctorum als der gliedlichen Gemeinschaft der Gläubigen auch der Gedanke von dem Christen als sittlicher Persönlichkeit mitinbegriffen ist Vor allem weist er aber auf Luthers Lehre vom Beruf hin. Die rechten guten Werke sind die des Berufes, in dem Gottes Wort und Befehl zu erblicken ist. In den Berufswerken beweist der Christ seinen Glauben.«141 Fehle es aber an der Bruderliebe in der communio, sei die Kirche dem inneren Zerfall preisgegeben. »Löhe bringt die Bruderliebe auch in Verbindung mit der theologia crucis. Am Kreuz offenbart sich Gottes Liebe zu den Menschen. Das Kreuz soll wiederum den Gläubigen zur Liebe zum Mitmenschen und Bruder bewegen.«142 Für Löhe sei »die Bruderliebe und alle Tätigkeit der Inneren Mission im letzten Grunde Zeichen des Glaubens, der in der Kirche lebendig ist, Bekenntnisakt der Kirche.«143 Auch das Altarsakrament und die Wiedereinführung der Privatbeichte (Zucht) stehen in engem Zusammenhang mit dem communio-Gedanken.
Die Kirche ist aber »nicht nur gottmenschliche Gemeinschaft, sondern sie ist auch nach ihrer objektiven Seite ... von Gott gestiftete Anstalt So ist also die Kirche nicht nur gottmenschliche Heilsgemeinschaft, sondern auch gottmenschliche Heilsanstalt, sie ist aber nie das eine ohne das andere, sie ist immer beides zugleich. Sie entsteht durch Sammeln und Gesammeltwerden, sie ist Versammlung der Gläubigen und Versammlungsort derjenigen, welche erst glauben sollen, sie ist Sammlung und Sammlerin in eins.«144
Löhe hat »unter den Eigenschaften die Einheit der Kirche ganz besonders hervorgehoben Allein dieser trostreiche Gedanke konnte Löhe über den von ihm so schmerzlich empfundenen Verlust seiner frühverstorbenen Gattin hinweghelfen So weitet sich sein Blick, und er sieht die Kirche als die Gemeinschaft aller Heiligen im Himmel und auf Erden.«145 Im Abendmahl aber hat Christus die Gemeinschaft von streitender und triumphierender Kirche gestiftet, »denn wir empfangen auf Erden im heiligen Abendmahl denselben Leib, den die selig Vollendeten im Himmel schauen.«146
Bei der Unterscheidung von sichtbarer Kirche als coetus vocatorum und unsichtbarer Kirche als coetus electorum rezipiert Löhe problematischerweise das refomierte Schema. Aber im »Sinne der lutherischen Väter betont er ... wieder die völlige Einheit der ecclesia visibilis und invisibilis.«147 Diese Einheit ist keine Gleichsetzung, »sondern die unsichtbare Kirche ist von der sichtbaren umgeben, umhegt Fragt man also Löhe, wo die unsichtbare Kirche zu finden sei, so antwortet er: dort, wo die sichtbare ist. Das heißt, sie ist für Löhe wie für Luther dort, wo Wort und Sakrament ist. Damit hatte Löhe die unselige, aufklärerische Trennung von sichtbarer und unsichtbarer Kirche aufgehoben.«148 Das Verhältnis beider sei nicht kausal, sondern gleichzeitig (in Form von Wechselwirkung).
Aus diesem ergebe sich für Löhe der Reichsgedanke: »Das Reich ist ein ewiges Reich. Hier auf Erden muß es immer mehr verwirklicht werden. Vollendet wird es aber erst dort in der Ewigkeit es findet in der Kirche ein unaufhörlicher Kampf statt um die Verwirklichung des Reiches Christi, um das Sichtbarwerden der unsichtbaren Kirche, um die Kirche im Idealzustand. Das Reich, die unsichtbare Kirche, ist der Maßstab, an dem die Kirche immer wieder ihre Empirie zu messen, ihr Selbsturteil zu fällen hat. So stehen sichtbare und unsichtbare Kirche für Löhe letzlich zueinander im Verhältnis der ungeheuren Spannung, der Spannung zwischen dem Wesen der Kirche und ihrer Empirie.«149
Also »ist das Reich Christi, der coetus electorum, an der reinen Lehre wie auch am Ethos seiner Glieder erkennbar.«150 Aber eine Ethisierung des Kirchenbegriffs weist Hebart ab: »Allein die Rechtfertigung und Sündenvergebung, allein die Glaubensgerechtigkeit bedingt die Gliedschaft im Reiche Christi ... Mit dem durch das Wort erzeugten Glauben ist das Ethos zugleich schon gesetzt Die Kirche ist für Löhe keine Zuchtanstalt, aber sie darf auch nicht zur Stätte der sittlichen Gleichgültigkeit werden.«151
Problematisch bleiben Hebart zwei Punkte: »Erstens, daß die lutherischen Reformatoren die wahre Kirche nicht als etwas Unsichtbares auffassen, das sichtbar werden müßte, und zweitens, daß für sie dieselbe stets Glaubensartikel, nie aber Sehartikel ist.«152 Es gehe Löhe aber ja gar nicht um die Begriffe sichtbar-unsichtbar, sondern Sehartikel heiße: »weil wir an die Realität der wahren Kirche, wie sie in ihrer geschichtlichen Wirklichkeit von Gott gesetzt ist, glauben, deshalb haben wir diese wahre Kirche in ihrer Vollendung hier und jetzt zu wollen.«153
Die pastorale Amtslehre wird zum großen Streitpunkt. »Ist also das Amt für Löhe ein Gnadenmittel, das neben Wort und Sakrament heilsnotwendig ist? Wird es für ihn zum Mittleramt? Das ist nicht Löhes Meinung. Es geht ihm nur darum, zu zeigen, daß das Heil an das gepredigte Wort und die verwalteten Sakramente gebunden ist. Das Amt gehört seinem Wesen nach zur Heilsordnung, es ist ein Verbindungsglied, also ein organisches Amt, das Glauben, Versöhnung und Gnade vermittelt, ... allein durch den an die Gnadenmittel gebundenen Geist. Niemals also ist für Löhe die Wirkungsfähigkeit der Gnadenmittel vom Amte abhängig. Christus und sein Geist sind es allein, die durch Wort und Sakrament wirken. So weit befindet sich Löhe also auf dem Boden der lutherischen Bekenntnisse.«154 Dennoch bleibt für Hebart »das Kirchenregiment ... eine menschliche Einrichtung und darf nicht zu einer klerikalen Amtsauffassung führen.«155 Keller nimmt dagegen die Amtslehre positiv auf:»Die Amtsdebatte des vorigen Jahrhunderts lehrt ..., daß das Amt der Diener Jesu Christi nicht aus der Gemeinde abgeleitet werden kann, sondern aus dem Mandat Jesu Christi. Aber der Amtsträger ist selbst Bruder der ganzen Gemeinde, Sünder wie alle Geschwister im Glauben, allein aus Gnaden begnadigt wie alle Erlösten. Löhe versuchte ..., dies im Verständnis des ´Dualismus´ aufzunehmen.«156
Hebart kommt zum Schluß: »Die Schwächen im Denken Löhes über die Kirche sind aufgezeigt worden. Was wir als unlutherisch an seiner Lehre vom Amt preisgeben müssen, ist angedeutet worden wir sind der Überzeugung, daß er trotz der Mängel und Fehler in seiner Ekklesiologie einer der größten Kirchenmänner des Luthertums gewesen ist und bleiben wird.«157
3.2 Löhe als Verfechter des lokalen Gemeindeprinzips
Schoenauers Monographie »Kirche lebt vor Ort. Wilhelm Löhes Gemeindeprinzip als Widerspruch gegen kirchliche Großorganisation« kämpft gegen den Indifferentismus unserer Zeit im Gemeindeaufbau in bezug auf das Wesen der Kirche und holt sich dazu Löhes Unterstützung: »Wilhelm Löhe ist einer, dem es zeitlebens ... Mühe gemacht hat, der theologischen Verantwortung nachzukommen, der diesen Hiatus zwischen theologischer Bearbeitung und praktischer Handlungsanweisung zu überbrücken versuchte. Dabei war es bei ihm der dauernde Widerspruch zwischen Recht und Geist, den er ständig angriff und bekämpfte. Kirchenverfassung, rechtliche Ordnungen und rechtliche Vollzüge in der Kirche wollte er geistlich am Wort ausgewiesen haben oder ihnen kein Recht einräumen.«158 Ausführlich beschäftigt Schoenauer sich mit der Löherezeption und ist mit ihr unzufrieden: »Die praktische Seite seines Schaffens, seine Persönlichkeit, seine Gaben als Prediger, Organisator, Seelsorger usw. werden in gebührender Weise anerkannt, bestimmte Forderungen und Aussagen Löhes zu Verfassung und Aufbau der Kirche werden jedoch kritisiert, der Zusammenhang zwischen beiden Bereichen wird gar übergangen. Ob sich das aber so trennen läßt? Sind nicht gerade Löhes Gedanken über die Kirche der Mittel- und Ausgangspunkt, von dem aus sich sein Werk erst zu solcher Größe entwickeln konnte?«159 So werden die Konsequenzen aus dem nicht gezogen, worüber eigentlich Einigkeit besteht: »Einmal sind Theorie und Praxis bei Löhe nie zu trennen ... Weiter ist man sich einig darin, daß Löhes Kriterium und Norm stets Schrift und Bekenntnis gewesen sind. Schließlich machen die Löheforscher auf die ekklesiologische Ausrichtung seiner Praxis aufmerksam.«160 Am meisten ärgert Schoenauer die immer wieder aufgestellte Behauptung (die wohl in der Tat durch Wiederholung nicht wahrer wird), er sei »am Schluß einer der treuesten Söhne seiner Landeskirche, nicht nur durch Geburt, sondern auch durch Überzeugung«161.
Dagegen versucht Schoenauer, ein Gemeindeprinzip Löhes herauszuarbeiten: »Die primäre Gestalt der Kirche ist für Löhe die Einzelgemeinde und nicht die Landeskirche Man könnte hier sagen, daß Löhe das Gemeindeprinzip vertrat, ... daß der Einzelgemeinde Priorität vor der Landeskirche einzuräumen ist, daß also der Gemeinde eine hervorragende und prinzipielle Bedeutung zukommt und daß die Kirche in Form der Gemeinde zu verfassen ist.«162 Dabei ist das Verhältnis von Amt und Gemeinde zentral: »Unter Gemeinde versteht Löhe also nicht allein die Versammlung der Laien gegenüber dem Amt, sondern nur beide zusammen ergeben ein Ganzes, sind eine Gemeinde. Löhe spricht hier von einem Dualismus zwischen ministerium und Volk. Die Gemeinde ist Eins aus Zweien. Dabei kommt dann den Laien ein großes Recht zu, nämlich sich gegen falsche Lehre zu wehren ...Umgekehrt braucht die Gemeinde aber auch das Amt. Durch das Zusammenwirken beider Teile besteht die Kirche. Das Amt predigt das Evangelium, spendet die Sakramente, erteilt die Absolution, die Gemeinde hört das Evangelium, prüft die Lehre, empfängt Sakramente und Absolution Beide, Gemeinde und Amt, unterstehen dem Evangelium.«163 Schoenauer sieht diese beiden Elemente im Zusammenhang: »Für Wilhelm Löhe ist die Einzelgemeinde die primäre Gestalt der Kirche, nicht die Landeskirche, weil sich allein in der Versammlung um Wort und Sakrament, wie sie eben in der Einzelgemeinde geschieht, die Kirche realisiert.«164 Da alles gemeindliche Leben dem Evangelium untersteht, ist die »Kirchenordnung ... der Heilsordnung unterzuordnen.«165
Schoenauer stellt sich nun die Aufgabe, »zu überprüfen, ob zu Recht für den Werdegang der bayerischen Landeskirche auf Löhe verwiesen wird oder ob sich die weitere Entwicklung der bayerischen Landeskirche von Löhes Kirchenverständnis entfernt hat und man sich zu Unrecht auf ihn beruft.«166 Die Antwort ist für Schoenauer klar negativ: »Der weitere geschichtliche Gang der bayerischen Landeskirche - bis auf den heutigen Tag - ist jedenfalls nicht mit Löhes Vorstellungen von der rechten Gestalt der Kirche zusammenzubringen. Wer dies unternimmt, mißbraucht seine Lehre von Kirche, Amt und Kirchenregiment. Schon sein zweiter Nachfolger in Neuendettelsau, Hermann Bezzel, beschritt einen völlig anderen Weg als den von Löhe zum Neuaufbau der Kirche vorgezeigten.«167 Er betrat »den von Harleß vorgezeichneten Weg und führte Neuendettelsau in die landeskirchliche Ordnung zurück. Zugleich gab er damit Löhes Versuch, die äußere Gestalt der Landeskirche zu ändern, auf. Löhes Ansatz, das Gemeindeprinzip zu realisieren, war damit beendet.«168
Im folgenden zeigt Schoenauer an einigen Beispielen die stark kirchenregimentliche Struktur, bei der Dekan und Kirchenleitung der Vorrang oder die Alleinherrschaft für Entscheidungen zu Lehr- und Amtszucht, Gottesdienstgestaltung und Kirchenzucht zugesprochen wird.169 Er kritisiert hier die Landeskirche scharf: »Kirchenordnungen sind und bleiben von Menschen gemacht (CA XV). Aber es geht auch nicht an, hier strikt zu trennen. Rechtliche Vollzüge müssen sich den geistlichen anpassen, sonst entwickeln die rechtlichen Vollzüge eine Eigendynamik, aus der der Geist geflohen ist. ´Geistliches Handeln ist rechtswirksam.´ Das bedeutet aber, daß sich z.B. Entscheidungen der Kirchenleitungen auch geistlich am Wort ausweisen müssen und nicht einfach bestimmen, verordnen und in Kraft setzen können. Trotz aller Beteuerung, daß Ordnung und Recht in der Kirche ja von ihrem Auftrag geprägt sein müssen, kommt es faktisch doch zu einer Trennung in geistliche und rechtliche Vollzüge.«170 Ebenso problematisch stellt sich die Lage für Schoenauer beim Gemeindeaufbau dar (also der inneren und äußeren Mission in der Terminologie Löhes): »Es gibt, so würde Wilhelm Löhe heute wohl sagen, nicht nur etwas Göttliches in der Kirchenordnung, sondern ebenso etwas Göttliches für die Ordnung des Gemeindeaufbaus. Man muß, um es mit Löhes Distinktionen auszudrücken, das Ordentliche vom Außerordentlichen unterscheiden können. Zum Ordentlichen hinsichtlich des Gemeindeaufbaues gehört dann aber die rechte Verkündigung des Evangeliums und die Verwaltung der Sakramente, eben der Gottesdienst. Er ist das entscheidende Ereignis für den Gemeindeaufbau, weil sich da die Gemeinde versammelt, zu der der Herr der Kirche reden kann Es ist an der Zeit, wieder das Ordentliche zu tun.«171
Keller bemerkt dazu treffend: »Ihm ging es nicht um ein Gemeindeprinzip an sich, das im Gegensatz zur organisierten Landeskirche zu stehen habe. Ihm ging es um die Reinhaltung des lutherischen Bekenntnisses und um die damit zusammenhängende Ablehnung der »Abendmahlsmengerei«, das heißt, er wollte aus seelsorgerlichen Gründen nur Glieder der lutherischen Kirche zum Empfang des Altarsakramentes zulassen. Darin bestand sein Konflikt mit der Landeskirche. Aus den gleichen Gründen förderte er die Zusammenarbeit mit den freien Kirchen lutherischen Bekenntnisses.«172 Einschränkend muß auch bemerkt werden, daß der Löhe von 1845 (also vor den Streitigkeiten um die Amtslehre und mit den Deutsch- Amerikanern) noch viel Hoffnung in die Lebens- und Sammlungskraft in seine lutherische Kirche auch als Landeskirche hatte.
3.3 Der sakramentale Ekklesiologe Löhe
Man wird Rau nach dem Lesen von Schriften Löhes zur Kirchenlehre nur zustimmen können, wenn er konstatiert: »Die Amts- und Kirchenlehre Löhes ergeben eine ideale strukturelle Konstellation für eine Pastoraltheologie.«173 Sie wird in einem späteren Stadium Löhes zu einer sehr sakramentalen Ekklesiologie, von der wir in den »Drei Büchern« erst die Ansätze sehen: »Löhes Ekklesiologie konkretisiert sich besonders schön in seinem Bild von der Abendmahlsgemeinschaft. In ihr werde die vollkommene Gemeinschaft mit Christus schon jetzt verwirklicht, das Abendmahl stelle mithin die real-ideale Gemeinschaft der Christen untereinander und mit ihrem Herrn dar.«174
Martin George erstellte einen schönen Vergleich der Kirchenlehre Löhes und Aleksej Chomjakovs, eines orthodoxen Theologen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in der römisch-katholischen (Johann Adam Möhler: Die Einheit in der Kirche, 1825), anglikanischen (John Henry Newman und Edward Pusey: Von der Kirche, 1838, lutherischen (Löhe, s.o.) und orthodoxen (Aleksej Chomjakov: Die Kirche ist eine, 1845) Kirche Theologen, die sich auf ihre Konfession besannen: »Allen diesen Theologen war eine doppelte Blickrichtung gemeinsam. Sie blickten zurück in die Zeit der Kirchenväter, zum Ideal der ´Alten und Ungeteilten Kirche´, und entdeckten dort eine mystische und organische Schau der Kirche; und sie blickten in die Zukunft und glaubten an eine organische Entfaltung der Kirche zu größerer Einheit und Fülle Eigentümlich und doch wiederum charakteristisch für ihre Zeit ist es, daß alle genannten Theologen nicht nur gedankliche Vorkämpfer der Einheit der universalen Kirche waren, sondern zugleich die ausgeprägtesten Konfessionalisten ihrer Zeit.«175 George nimmt wahr, daß Löhe beim Gemeinschaftsgedanken für sein Kirchenverständnis einsetzt: »Der Mensch ist dazu geboren, in Gemeinschaft selig zu werden. Löhe definiert die Kirche als von Gott zur Ewigkeit berufene Gemeinschaft ... Solche Gemeinschaft von Gott her bedeutet immer Liebe, Liebe Gottes zu den Menschen und Liebe der Menschen zu Gott und untereinander Solche Gemeinschaft bedeutet immer auch Einigkeit im Glauben, im Bekenntnis und im täglichen Zusammenleben.«176 Dabei sei der Heilige Geist die Grundlage und das bewegende Prinzip der Kirche als Gemeinschaft der Heiligen. Daraus ergeben sich auch organisch die Konsequenzen für den Kampf gegen die Abendmahlsmengerei mit Unierten und Reformierten: »Abendmahlsgemeinschaft und Bekenntnisgemeinschaft sind keine Alternativen der Ekklesiologie Löhes, sondern bedingen sich gegenseitig. Die Kirche als örtliche Abendmahlsgemeinschaft findet ihre universale Einheit erst in der Gemeinschaft mit anderen Kirchen des gleichen Bekenntnisses; und das gleiche Bekenntnis ist die Voraussetzung der Abendmahlsgemeinschaft, nicht ... deren Wirkung. Auch für den späten Löhe bleibt ein unterschiedliches Abendmahlsbekenntnis kirchentrennend. Andererseits macht die Bekenntnisgemeinschaft, auch das gemeinsame rechte Bekenntnis des Altarsakraments, noch nicht die Kirche aus. Sie muß durch das Abendmahl und in der beständigen Feier des Abendmahls leben, um Kirche zu sein.«177
Denn in »der Feier des Abendmahls wird der Glaubensartikel von der Gemeinschaft der Heiligen erfahrbare Wirklichkeit Die sichtbare Kirche ist für den reifen Löhe die schriftgemäße Abendmahlsgemeinschaft der Gläubigen mit Christus und untereinander.«178
Aleksej Chomjakov war Löhe in vielem ähnlich: »Die theologische Wirkung beider liegt nicht eigentlich in ihren ekklesiologischen Anschauungen im einzelnen, sondern in dem festen Zusammenhang kirchlicher Lehre und kirchlichen Lebens in Liturgie und Diakonie, den sie betont haben. Dies ist der eigenständige Weg ihres kirchlich-organischen Denkens, das sie von der Universitäts- oder Akademietheologie ihrer Zeit unterscheidet Gegen die konfessionelle Eingrenzung des Kirchenbegriffs betonen beide die mystische Realität der einen, zugleich sichtbaren und unsichtbaren, irdischen und transzendenten Kirche und begründen sie pneumatologisch und christologisch. Die Kirche ist für beide die apostolische und altkirchliche Gemeinschaft der Heiligen, deren Einheit in der Abendmahlsgemeinschaft manifest wird. Sie ist kein vergangenes Ideal, sondern begegnet beiden in der Eucharistiefeier in ihrer Kirche In der erneuten Verwurzelung der Ekklesiologie in der neutestamentlichen Sicht der Kirche als Leib Christi und in der Feier des Abendmahls sehen wir die bleibende Gültigkeit des organischen Denkens sowohl Löhes als auch Chomjakovs.«179
Chomjakovs Wirkung war ungleich nachhaltiger als die Löhes, entdeckte die orthodoxe Kirche doch mit Begeisterung ihre verschütteten altkirchlichen Wurzeln wieder. Man kann aber die folgenden Ausführungen Felmys zu Chomjakov durchgehend für Löhe nachbuchstabieren: »Ihm wurde für seinen ekklesiologischen Neuansatz die Übersetzung des Wortes ´katholisch´ im nizänokonstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis ins Slawische wesentlich. Im Slawischen steht ... das Wort ´sobornaja´. Es ist abgeleitet vom Stamm ´s-br´, sammeln (vgl. Missionsgedanke Löhes!). Chomjakov definiert so die Kirche von der Versammlung her, von der Gemeinschaft von Bischöfen, Priestern und Volk in seiner Gesamtheit. (Vgl. die Bedeutung der communio bei Löhe)... In dieser Versammlung hat die Hierarchie zwar eine besondere, vor allem sakramentale Funktion. (bei Löhe zunächst vor allem pastorale - diese hat aber durchaus sakramentalen Charakter)... Aber diese von den Bischöfen definierte Lehre ist nur dann gültige orthodoxe Lehre, wenn das orthodoxe gläubige Volk sie als authentisch annimmt. (Vgl. Löhes Meinung, die Gemeinde müsse die Schriftmäßigkeit der Lehre prüfen)... Chomjakov hatte in der orthodoxen Kirche des Ostens die ideale Synthese des protestantischen Prinzips der Freiheit ohne dessen Tendenz zur Willkür und des katholischen Prinzips der Einheit ohne dessen Tendenz zur Unfreiheit gesehen. (Vgl. Löhes Meinung, die lutherische Kirche habe überall den gesunden Mittelstandpunkt inne) Die ideale Sicht der orthodoxen Kirche stieß sich freilich hart an der Wirklichkeit der Russischen Orthodoxen Kirche seiner Zeit. (!) ... Die Wirkung seines Denkens ist sehr groß geworden. Das von Chomjakov selbst noch gar nicht gebrauchte, aber zur Kennzeichnung seiner Lehre von seinen Schülern geprägte Wort ´sobornost´ wird nicht mehr allein im russischen, sondern im gesamtorthodoxen Bereich im positiven Sinn verwendet. (Hier war Chomjakov wohl erfolgreicher als Löhe mit seinem Gedanke äußerer und innerer Mission im Sinne der lutherischen Kirche, der Sammlung zur episkopalen Brüderkirche etc.)«180 In der Folge entwickelten etliche orthodoxe Theologen eucharistische Ekklesiologien, die Kirche ganz von der Eucharistiefeier her definieren und heute orthodoxe Theologie mitprägen.181
3.4 Versuch einer ästhetisch-biografischen Würdigung
Die Problematik dieser dogmatischen Wertungen zeigt Rau sehr schön auf: »Als ein kritischer Punkt bei der Bewertung von Löhes Theologie zeigt sich die Bestimmung des Anteils seiner Person an seinen theologischen Lehrmeinungen. Der Reichtum seiner natürlichen und geistlichen Gaben, das fränkische Gepräge und der patriarchalische Zug in seinem Denken und Handeln, vor allem aber seine ausgesprochen charismatische Erscheinung: alle diese Faktoren sind unlöslich mit seiner Theologie verknüpft, so daß sich schwerlich objektive abstrakte Lehrinhalte fixieren und ohne Verkürzung in die Theologiegeschichte einordnen lassen.«182 Löhe war nun mal kein Dogmatiker, sondern ein charismatischer Kirchenvater. Die gemachten Beobachtungen um Person und Werk (»Drei Bücher« ) Löhes lassen auch ohne komplette dogmatische Einordnung (wie sie die drei vorgenannten Konzeptionen versuchen) einige Schlüsse zu. Aus den formalen Beobachtungen ergab sich, daß das Werk eine Art pastoraler Brief an die Freunde der lutherischen Kirche ist. Diese Freunde werden an die alte Lehre von der Kirche erinnert, diese wird ihnen neu verdeutlicht und bekannt. Diese Freunde werden ermahnt, sich an dem, was in Löhes Kirchengemeinde schon praktiziert wird (Privatbeichte, Gemeindezucht etc.) ein Vorbild zu nehmen. Schließlich werden sie zur Hoffnung und zur Einheit ermahnt. Eine Vielzahl von Hymnen, Gebeten und Lobpreisen Gottes ist ins Werk organisch eingearbeitet. Mit den dogmatischen Termini, auch den selbst aufgestellten (z.B. reine/reinste Kirche, allgemein Berufene/Berufene als Kirchenmitglieder) geht er nicht sorgfältig genug um, um dogmatischen Anfragen voll Rechenschaft geben zu können.
Die Maßstäbe für ein solches Werk sollten daher eher poetischer und ästhetischer Art sein als dogmatischer. Das Werk ist ein schönes Beispiel für die Sprachmächtigkeit Löhes, die bei ihm immer die Schönheit der Einfalt impliziert. Die Vielzahl der Bilder stellen jedem Löhes Vorstellung von der Kirche auf ihrem Pilgerzug durch die Zeiten und Orte hin zum himmlischen Jerusalem plastisch vor Augen. Die Beschreibung der lutherischen Kirche setzt dann allerdings zu viele Beweise als bekannt voraus, um aus sich verstanden zu werden.
Wo die Bibel als Beweis zitiert wird, geht er sorgsam und liebevoll mit diesem Wort um. Die Sprache selbst ist vielfältig biblisch geprägt. Das ist auch ein gewisser Kritikpunkt, denn man kann Löhe durchaus hier pastorale, weltferne Sprache vorwerfen (und diese ist ja gerade für sein Ziel der Mission nicht von vornherein sinnvoll, zumindest was den Kontakt mit Kirchenfernen betrifft).
Entspricht nun diese Kirchenlehre der Persönlichkeit Löhes (zur Zeit der Abfassung)? Dazu nehme ich nochmal die eingangs festgestellten Merkmale der Persönlichkeit Löhes auf: Vertrautheit mit dem Tod, Ästhetischer Sinn, Sichtbarer Glaube, Charismatisches Dienen und Organisches Denken.
Die Vertrautheit mit dem Tod spiegelt sich in dem ewigen Pilgerzug der Kirche. Es gibt für Löhe eine tiefe Verbundenheit in der Gemeinschaft der Gläubigen, auch die schon Entschlafenen betreffend. Der Ästhetische Sinn findet sich vielfach in Bildern aus der Natur und Beschreibungen der Geschichte, wobei beide immer ganz klar Gottes Schöpfung und Gottes Geschichte mit der Welt sind. Der Glaube wird mehr als durchsichtig: Löhe bezeugt seinen Glauben an die Kirche vor den Freunden dieser Kirche offen und frei. Der charismatische Pastor Löhe ordnet sich selbst und seinen Lebensberuf in diese Kirchenlehre ein, findet seinen Platz und seine Aufgabe. Dabei wird alle Lehre in organischer Kontinuität zum Wort Gottes, der Alten Kirche und der Bekenntnisse fortgeschrieben, die alte Lehre zu einer neuen Blüte gebracht.
Ein Teil der Schönheit dieser Kirchenlehre kommt also auch von dem Gefühl her, daß da jemand mit seiner ganzen Person und Erfahrung dafür einsteht, zeugt, daß diese Geschichte von der Kirche, wie sie ist, wie sie war und wie sie werden soll, wahr und echt ist.
4 Schlußbemerkungen
Wir haben unter vier Perspektiven Löhes Kirchenlehre betrachtet und kommen zum Schluß: Ja, Löhe ist ein Kirchenmann des Luthertums, aber mit einer ganz eigenen Vorstellung vom Luthertum. Ja, Löhe ist ein Verfechter des lokalen Gemeindeprinzips, aber das ist ihm nicht das Wesentliche an der Kirchenlehre. Ja, Löhe denkt die Kirche als eine sakramentale Gemeinschaft, allerdings in vielen Aspekten erst nach den »Drei Büchern von der Kirche«. Ich habe eine weitere Perspektive versucht aufzuzeigen, die des ästhetischen Werts und der hohen biografischen Glaubwürdigkeit seines Zeugnisses.
Am Schluß möchte ich noch auf die Frage der »ökumenischen Weitschaft« Löhes eingehen. Jeder, der bisher mitgelesen hat, kann sich gut vorstellen, wie Löhe auf den Vorstoß unseres Landesbischofs reagieren würde, den Papst als Sprecher der Christenheit anzuerkennen. Er würde sich wohl im Grab umdrehen. Wo also würden wir Löhe im Feld der Ökumene heute unterbringen?
Das moderne Verständnis von Ökumene ist ja das der »Versöhnten Verschiedenheit«. Wir unterzeichnen gemeinsame Erklärungen, in denen wir alles so elegant formulieren, daß sich der Partner nicht verletzt fühlt und seine eigene Anschauung in unsere hineinlesen kann. Dabei geht vor lauter vor sich hergetragenem Respekt vor dem Anderen das wirkliche Verständnis des Anderen als eines Anderen verloren.
Da ist Löhes Ökumene ehrlicher. Er bekennt das, was er erkannt hat, seinen Brüdern. Den Anderen kann er nur sagen: »Nach meinem Verständnis habt Ihr nicht die volle Wahrheit. Hört mein Zeugnis und widerlegt mich mit der Schrift, so will ich zu euch überlaufen!« Er sagt offen, daß er seine Kirche für die Braut des Herrn, für die reinste Kirche hält. Ansonsten wäre er längst zu einer anderen gewechselt.
Ich schließe mit Löhes Eingangspsalm über Die Kirche Gottes (Psalm 87):
»
Ein Psalmlied der Kinder Korah
Sie ist festgegründet auf den heiligen Bergen.
Der Herr liebet die Tor Zion über alle Wohnungen Jakob.
Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes. Sela.
Ich will predigen lassen Rahab und Babel, daß sie mich kennen sollen.
Siehe, die Philister und die Tyrer samt den Mohren werden daselbst geboren.
Man wird zu Zion sagen, daß allerlei Leute drinnen geboren werden
und daß er, der Höheste, sie baue.
Der Herr wird predigen lassen in allerlei Sprachen, daß der etliche
auch daselbst geboren werden. Sela.
Und die Sänger wie am Reigen werden alle in dir singen, eins ums ander. »183
5 Literaturverzeichnis
Abkürzungen von Zeitschriften und Reihen folgen dem Abkürzungsverzeichnis der Theologischen Realenzyklopädie, zusammengestellt von S. Schwertner, Berlin New York 21994.
5.1 Verwendete Primärliteratur
Die im folgenden angeführten Werke befinden sich in: Löhe, W., Gesammelte Werke, hrsg. Im Auftrage der Gesellschaft für Innere und Äußere Mission im Sinne der lutherischen Kirche e.V. von K. Ganzert, Neuendettelsau 1951-1986, (GW).
Band 5: Die Kirche im Ringen um Wesen und Gestalt.
5.1.: Neuendettelsau 1954.
5.2.: Neuendettelsau 1956.
Als Hauptquelle ist zitiert:
Löhe W., Drei Bücher von der Kirche. Den Freunden der Lutherischen Kirche zur Überlegung und Besprechung dargeboten, 1845, GW 5.1, 85-179.
5.2 Verwendete Sekundärliteratur
a) Zur Person
Deinzer J., Wilhelm Löhes Leben. Aus seinem schriftl. Nachlaß zusammengestellt, Bd. I-III, Neuendettelsau 41935.
Kantzenbach F.W., Wilhelm Löhe (1808-1872): Klassiker der Theologie Bd. 2, München 1983, 174-189.
Müller G., Wilhelm Löhe, GK 9,2, Stuttgart 1985, 71-86
Schlichting W., Löhe, Johann Konrad Wilhelm (1808-1872), TRE Bd. XXI, Berlin New York 1991, 410-414.
Schober T., Wilhelm Löhe 1808-1872. Gestalten der Inneren Mission im Sinne der Lutherischen Kirche, in: Leipziger K. (Hsg.), Helfen in Gottes Namen. Lebensbilder aus der Geschichte der bayerischen Diakonie, München 1986, 44-69.
b) Zum Thema
Fagerberg H., Amt/Ämter/Amtsverständnis VII. Von ca.1600 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, TRE Bd. II, Berlin New York 1978, 574-593.
Fagerberg H., Bekenntnis, Kirche und Amt in der deutschen konfessionellen Theologie des 19. Jahrhunderts, Uppsala 1952.
Felmy, K.Chr., Die orthodoxe Theologie der Gegenwart: eine Einführung, Darmstadt 1990.
Ganzert K., GW 5.2, 963-966 (Erläuterungen).1135-1141 (Fußnoten).
George M., In der Kirche leben. Eine Gegenüberstellung der Ekklesiologie Wilhelm Löhes und Aleksej Chomjakovs, KuD 31, Göttingen 1985, 212-248.
Hebart S., Wilhelm Löhes Lehre von der Kirche, ihrem Amt und Regiment. Ein Beitrag zur Geschichte der Theologie im 19. Jahrhundert, Neuendettelsau 1939.
Kantzenbach F.W., Wilhelm Löhe als organischer Denker (Zum Verständnis seiner theologischen Entwicklung), ZbKG 31, Neustadt/Aisch 1962, 80-104.
Keller R., August Vilmar und Wilhelm Löhe. Historische Distanz und Nähe der Zeitgenossen im Blick auf ihr Amtsverständnis, KuD 39, Göttingen 1993, 202-223.
Rau G., Pastoraltheologie. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur einer Gattung praktischer Theologie, SPTh 8, München 1970.
Schindler-Joppien, Das Neuluthertum und die Macht. Ideologiekritische Analysen zur Entstehungsgeschichte des lutherischen Konfessionalismus in Bayern (1825-1838): CthM C 16, Stuttgart 1998.
Schoenauer G., Kirche lebt vor Ort. Wilhelm Löhes Gemeindeprinzip als Widerspruch gegen kirchliche Großorganisation, CthM C 16, Stuttgart 1990.
Anmerkungen:
[...]
1 Vor allem: Kantzenbach, Wilhelm Löhe als organischer Denker.
2 Deinzer, Wilhelm Löhes Leben.
3 Nach der Selbstbiografie Löhes in Deinzer I, 14.
4 Deinzer I, 38.
5 Zitiert nach Deinzer I, 5-6 (Anmerkung zur Selbstbiografie).
6 Deinzer II, 51.
7 Zitiert nach Deinzer II, 62.
8 Deinzer II, 175.
9 Zitiert nach Deinzer II, 178.
10 Zitiert nach Deinzer I, 12-13.
11 Zitiert nach Deinzer I, 28.
12 Zitiert nach Deinzer II, 240.
13 Deinzer II, 241.
14 Deinzer II, 110.
15 Zitiert nach Deinzer II, 125.
16 Deinzer II, 127.
17 Deinzer II, 213.
18 Zitiert nach Deinzer I, 35.
19 Schober, 49.
20 Hebart, 293.
21 Zitiert nach Deinzer I, 20.
22 Müller, 73.
23 Kantzenbach, Wilhelm Löhe, 179.
24 Hebart, 300.
25 Ausführlich dargestellt sind sie bei Deinzer III, 77-125.
26 Schinder-Joppien, 155. Hier mißversteht Schindler-Joppien Löhe, obwohl er andernorts selbst Löhes Bewertungsmaßstab des »Liebe üben«s anführt (151).
27 Fagerberg, Amt/Ämter/Amtsverständnis VII, 589-590.
28 GW 5.1, 57 (Mitteilung der Windsbacher Predigerkonferenz. Vom Abendmahlsgenuß, 7.November 1837).
29 Deinzer II, 201.
30 Deinzer II, 201.
31 Schlichting, 411.
32 Hebart, 49-50.
33 Hebart, 50.
34 Hebart, 50.
35 Kantzenbach, Wilhelm Löhe als organischer Denker, 81-82.
36 Kantzenbach, Wilhelm Löhe als organischer Denker, 82.
37 Kantzenbach, Wilhelm Löhe als organischer Denker, 85.
38 Kantzenbach, Wilhelm Löhe als organischer Denker, 103.
39 Kantzenbach, Wilhelm Löhe als organischer Denker, 104.
40 Fagerberg, Bekenntnis, Kirche und Amt, 153.
41 Vgl. Deinzer III, 331.
42 Zitiert nach Deinzer II, 45.47.
43 Zitiert nach Deinzer III, 327-328.
44 Schindler-Joppien, 150-151.
45 Schindler-Joppien, 144-145.
46 Schindler-Joppien, 146.
47 Hebart, 75-76.
48 Zitiert nach GW 5.2, 963.
49 Zitiert nach GW 5.2, 1136.
50 GW 5.2, 964.
51 Vgl. GW 5.2, 964.
52 GW 5.1, 112. Die Änderungen zur ersten Auflage sind aufgeführt in GW 5.2, 965-966.
53 Vgl. GW 5.2, 964-965. 1137-1141 und die zahlreichen Hinweise Schoenauers zur Löherezeption.
54 GW 5.1, 91, Z. 37-43.
55 GW 5.1, 93, Z. 22-27.
56 GW 5.1, 94, Z. 1-6.
57 GW 5.1, 103, Z. 14-22
58 GW 5.1, 85, Z. 6-8.
59 GW 5.1, 85, Z. 22-28.
60 GW 5.1, 86, Z. 10-11.
61 GW 5.1, 86, Z. 12-14.
62 GW 5.1, 89, Z. 14-40
63 GW 5.1, 90, Z. 5-15.
64 GW 5.1, 90, Z. 16-26.
65 GW 5.1, 90, Z. 28-33.
66 Rau, 218.
67 Rau, 221.
68 GW 5.1, 91, Z. 3-8.
69 GW 5.1, 91, Z. 29-32
70 GW 5.1, 92, Z. 40-43.
71 Rau, 222.
72 GW 5.1, 93, Z. 15-17.
73 GW 5.1, 93, Z. 17-21.
74 GW 5.1, 93, Z. 29-32.
75 GW 5.1, 94, Z. 18-19.
76 GW 5.1, 94, Z. 27-30.
77 GW 5.1, 94 Z.37 - 95 Z.3
78 GW 5.1, 95 Z. 5-8.
79 GW 5.1, 96, Z. 12-14.
80 GW 5.1, 96, Z. 15-25.
81 GW 5.1, 98, Z. 14-16.
82 GW 5.1, 98, Z. 36-37.
83 GW 5.1, 99, Z.39-44.
84 Damit nähert er sich Delitzsch´s Hochschätzung des Sakraments in den »Vier Büchern von der Kirche« an, vgl. Schoenauer, 45.
85 GW 5.1, 100, Z. 17-27.
86 GW 5.1, 102, Z. 32-39.
87 GW 5.1, 104, Z. 15-17.
88 GW 5.1, 101, Z. 18-21.
89 GW 5.1, 105 Z.45 - 106 Z.1.
90 GW 5.1, 105, Z. 27-33.
91 GW 5.1, 106, Z. 27-30.
92 GW 5.1, 109, Z. 13-17.
93 GW 5.1, 111, Z. 5-7.
94 GW 5.1, 111, Z. 8-31.
95 GW 5.1, 115, Z. 3-5.
96 GW 5.1, 115, Z. 15-16.
97 GW 5.1, 116, Z. 11-16.
98 GW 5.1, 118, Z. 7-12.
99 Schoenauer, 64.
100 GW 5.1, 119, Z. 5-7.
101 GW 5.1, 121 Z. 46- 122 Z. 2.
102 GW 5.1, 125, Z. 23-32.
103 GW 5.1, 127, Z. 29-33.
104 GW 5.1, 128, Z. 20-28.
105 GW 5.1, 129, Z. 10-18.
106 GW 5.1, 131, Z. 13-19.
107 GW 5.1, 132, Z. 37-40.
108 GW 5.1, 135, Z. 38-43.
109 GW 5.1, 135, Z. 18-23.
110 Schoenauers, 62.
111 GW 5.1, 158, Z. 15-27.
112 GW 5.1, 160, Z. 6-8.
113 GW 5.1, 61 (Brief an das kgl. Dekanat, 16. Mai 1838).
114 GW 5.1, 160, Z. 15-16.
115 GW 5.1, 162, Z. 3-18.
116 GW 5.1, 163, Z. 11.
117 GW 5.1, 163, Z. 12.
118 GW 5.1, 163, Z. 29-34.
119 GW 5.1, 165, Z. 21-24.
120 GW 5.1, 167, Z. 1-9.
121 GW 5.1, 169, Z. 2-3.
122 GW 5.1, 170, Z. 4-5.
123 GW 5.1, 169, Z. 37-44.
124 GW 5.1, 170, Z. 8-11.
125 GW 5.1, 170, Z. 11-18.
126 GW 5.1, 172, Z. 20-22.
127 GW 5.1, 172, Z. 24-27.
128 GW 5.1, 173, Z. 10-12.
129 GW 5.1, 174, Z. 33-41.
130 GW 5.1, 175, Z. 26-27.
131 GW 5.1, 175, Z. 37-44.
132 GW 5.1, 176, Z. 19-23.
133 GW 5.1, 178, Z. 9-13.
134 GW 5.1, 179, Z. 4-5.
135 GW 5.1, 179, Z. 6-20.
136 Hebart, 5.
137 Hebart, 6.
138 Hebart, 6.
139 Hebart, 100.
140 Hebart, 102.
141 Hebart, 105.
142 Hebart, 106.
143 Hebart, 112.
144 Hebart, 114.
145 Hebart, 115.
146 Hebart, 115.
147 Hebart, 121.
148 Hebart, 122.
149 Hebart, 125.
150 Hebart, 126.
151 Hebart, 129.
152 Hebart, 131.
153 Hebart, 136.
154 Hebart, 158.
155 Hebart, 301.
156 Keller, 221.
157 Hebart, 309.
158 Schoenauer, 13.
159 Schoenauer, 19.
160 Schoenauer, 35.
161 Hebart, 307. Vgl. dagegen S.8 dieser Arbeit seine Aussage, er würde noch 5 Minuten vor dem Tod die Kirche wechseln.
162 Schoenauer, 77-78.
163 Schoenauer, 102.
164 Schoenauer, 116.
165 Schoenauer, 125.
166 Schoenauer, 53.
167 Schoenauer, 132.
168 Schoenauer, 134.
169 Vgl. Schoenauer, 136-138.
170 Schoenauer, 139
171 Schoenauer, 154.
172 Keller, 207.
173 Rau, 225.
174 Rau, 224.
175 George, 214.
176 George, 216-217.
177 George, 224.
178 George, 225.
179 George, 247-248.
180 Felmy, 149-150 (Alle Anmerkungen in Klammern von mir).
181 Vgl. Felmy, 151-166.
182 Rau, 205.
Häufig gestellte Fragen zu "Drei Bücher von der Kirche"
Was ist der Hauptinhalt der "Drei Bücher von der Kirche" von Wilhelm Löhe?
Die "Drei Bücher von der Kirche" ist eine umfassende Darstellung der Kirchenlehre Wilhelm Löhes, die sich mit dem Wesen, der Gestalt und der Hoffnung der Kirche auseinandersetzt. Es gliedert sich in drei Hauptteile: das erste Buch behandelt die Eine, heilige, katholische Kirche; das zweite Buch befasst sich mit den Partikularkirchen und der lutherischen Kirche; das dritte Buch widmet sich der lutherischen Kirche selbst, ihrem Gehalt, ihrer Gestalt und ihrer Hoffnung.
Welche biografischen Aspekte haben Löhes Kirchenlehre beeinflusst?
Mehrere biografische Linien prägten Löhes Denken: seine Vertrautheit mit dem Tod, sein ästhetischer Sinn, sein sichtbarer Glaube, sein charismatisches Dienen und sein organisches Denken. Diese Einflüsse spiegeln sich in seiner Ekklesiologie wider, die die Einheit der Kirche über den Tod hinaus, ihre Schönheit und ihren biblischen Charakter betont.
Was sind die Hauptmerkmale von Löhes Kirchenverständnis?
Löhe betont die Einheit der Kirche (una), ihre Heiligkeit (sancta), ihre Katholizität (catholica) und ihre Apostolizität. Er sieht die Kirche als eine Gemeinschaft, die sowohl sichtbar als auch unsichtbar ist, und deren Grundlage das apostolische Wort Gottes ist.
Wie unterscheidet Löhe zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche?
Löhe unterscheidet zwischen der sichtbaren Kirche (der Versammlung der Berufenen, die sich öffentlich zu Christus bekennen) und der unsichtbaren Kirche (der Gemeinschaft der Auserwählten, deren Herzen nur Gott kennt). Er betont jedoch, dass beide untrennbar miteinander verbunden sind und die wahre Kirche in ihrer Gesamtheit bilden.
Welche Rolle spielen die Bekenntnisse in Löhes Ekklesiologie?
Für Löhe sind die Bekenntnisse das Kennzeichen der Partikularkirchen. Er sieht die Schriftmäßigkeit des Bekenntnisses als das Unterscheidungsmerkmal der reinsten Kirche an. Er betrachtet das lutherische Bekenntnis als das schriftgemäßeste.
Welchen Stellenwert hat die Mission in Löhes Denken über die Kirche?
Die Mission hat für Löhe einen zentralen Stellenwert. Er betrachtet sie als die Bewegung der Einen Kirche Gottes, als die Verwirklichung einer allgemeinen, katholischen Kirche unter allen Völkern.
Was versteht Löhe unter dem "Gemeindeprinzip"?
Löhe vertritt das Gemeindeprinzip, wonach die Einzelgemeinde die primäre Gestalt der Kirche ist und Priorität vor der Landeskirche hat. Er betont das Zusammenwirken von Amt und Gemeinde und die Unterordnung der Kirchenordnung unter die Heilsordnung des Evangeliums.
Wie beurteilt Hebart Löhes Lehre von der Kirche, ihrem Amt und Regiment?
Hebart sieht Löhe als einen bedeutenden Kirchenmann des Luthertums. Er hebt besonders hervor, dass Löhe in einer Zeit, da man das ganz vergessen hatte, wieder auf den neutestamentlichen und genuin lutherischen Gedanken von der Kirche als einer Koinonia, einer communio hinweist.
Was kritisiert Schoenauer an der Entwicklung der bayerischen Landeskirche nach Löhe?
Schoenauer kritisiert, dass die bayerische Landeskirche sich von Löhes Kirchenverständnis entfernt hat und eine stark kirchenregimentliche Struktur entwickelt hat, bei der Dekan und Kirchenleitung Vorrang vor dem Gemeindeprinzip haben.
Welche Rolle spielt das Abendmahl in Löhes Kirchenlehre?
Das Abendmahl wird im reifen Löhe immer wichtiger. Die sichtbare Kirche ist für den reifen Löhe die schriftgemäße Abendmahlsgemeinschaft der Gläubigen mit Christus und untereinander.
In welchem Verhältnis steht Löhes Denken zum ökumenischen Denken der Gegenwart?
Löhe würde moderne Versuche der "versöhnten Verschiedenheit" im ökumenischen Dialog wahrscheinlich kritisch sehen. Er befürwortet eine ehrliche, auf biblischer Wahrheit basierende Auseinandersetzung, bei der man sich zu seinen Überzeugungen bekennt und andere auffordert, diese zu widerlegen oder sich anzuschließen.
- Arbeit zitieren
- Martin Hild (Autor:in), 2001, Wilhelm Löhes Verständnis von der Kirche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104722